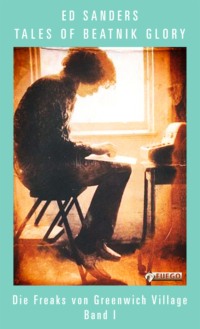Kitabı oku: «Tales of Beatnik Glory, Band I (Deutsche Edition)», sayfa 5
K OMMANDO KARTOFFELSALAT
I
Die ölig glänzende Außenwand des Dampfbades erinnerte an eine alte Kenmore-Waschmaschine. Immer wenn es in Betrieb war, so wie heute Morgen, blieben von seinen wuchtigen Stößen ein paar hässliche Kratzer auf dem seidig schimmernden Parkettfußboden zurück. Emil Cione hockte im kochend heißen Dampf und ließ sich von seiner Sekretärin Keats vorlesen. Visionen von düsteren Burgsälen und kühlen Schlafräumen aus The Eve of St. Agnes prallten wie Tennisbälle gegen die Mauern seines gepeinigten Schädels. Er merkte, wie er anfing, vor Hitze langsam zu zerfließen. Cione war der Autor eines berühmten Gedichtbandes mit dem leicht übertriebenen Titel Am I Goethe Or Am I Schiller – oder Am I Nothing, wie man den Wälzer in der Gedichte-Abteilung im Tiefgeschoss des Buchladens in der Achten Straße zu nennen pflegte – für den er im vergangenen Jahr den Pulitzerpreis gewonnen hatte. Im Augenblick arbeitete er an seiner Biografie »Meine Spannkraft« und bereitete sich nebenher auf das Symposium vor. Um seine Spannkraft machte er sich nämlich ziemliche Sorgen, besonders seit in letzter Zeit gewisse Studentinnen aus seinen Kursen die saft- und kraftlose Figur ihres Meisters immer kritischer musterten. Tja, der jahrelange Alkoholkonsum war eben nicht spurlos an ihm vorübergegangen, und nun beulte sich sein Fettwanst wie ein nasser aufgequollener Sack über dem Gürtel.
Plötzlich fiel ihm etwas ein. »Was hatten sie noch mal gesagt, was sie zahlen?«, fragte er und unterbrach seine Sekretärin, kurz bevor die beiden Liebenden aus dem Schloss fliehen konnten.
»Zweihundert Dollar.«
II
»Wie sehe ich aus?«, fragte im gleichen Moment in einem anderen Teil der Stadt eine besorgte Stimme.
»Wie Kopernikus, Cheevy, wie Einstein ...« beruhigte ihn augenblicklich ein liebevoller Wortschwall und bestätigte damit wieder einmal seine angebliche Ähnlichkeit mit den Großen der Wissenschaft, über die ja sonst nur gemunkelt wurde. »Wie glitzernde Gletscher auf zerklüfteten Felsen ...«. Nach diesem ganz besonders treffenden Vergleich versiegte der Redefluss für einen Moment und wirbelte wie ein Strudel gegen einen Deich.
»Und wie höre ich mich an?«, fragte Cheevy ein paar Minuten später und hielt in der bardischen Totenklage inne, die er nur bei ganz speziellen Gelegenheiten zum Besten gab. Er war nämlich gerade dabei, sein umwerfendes dreiteiliges Eröffnungs-Statement einzuüben, das er auf dem Symposium zum Tod der Beat-Generation vortragen würde. Ehrlich gesagt war er eigentlich so von sich überzeugt, dass er sich eine derartige Frage wirklich schenken konnte — schließlich hatte er sich nicht umsonst unzählige Stunden abgerackert, ins Tonbandgerät gebrummelt und dabei unmerklich seine Stimme so trainiert, dass er sie nach Belieben verändern konnte. Er schaffte es jetzt schon, seine Sprechstimme, die normalerweise als näselndes Gewimmer zu bezeichnen wäre, auf Kommando in einen wirklich wahnwitzigen russisch-orthodoxen Kirchenchor-Bass zu verwandeln, und wenn er ganz besonders gut drauf war, in ein tiefkehliges Summen. Ein paar Jahre später musste die NBC ein ziemlich dickes Bündel Scheine dafür hinblättern, dass er ihnen ihre Dokumentarberichte über das wilde Leben der Schakale sprach. Cheevys Kritiker allerdings hielten seine Versuche, sich mit Mel Torme zu messen, bloß für albernes Shakespear’sches Getue — ihrer Meinung nach riss er ganz einfach sein Maul ein bisschen zu weit auf.
Unvermittelt brach jetzt die Tormesche Sturzflut ab. »Eigentlich bin ich ja ganz froh, dass diese Macker endlich tot sind — diese hirnrissigen Stinkstiefel — diese kleinen Möchtegern-Rimbauds ...« — »Tot ist natürlich nur symbolisch gemeint, ist doch klar«, fügte er schnell hinzu, als er das leicht verwirrte Gesicht seiner Frau bemerkte, und dabei raffte er sich sogar zu einem breiten Grinsen auf.
III
Doris L. Malek, verantwortlich für die Fiction-Abteilung von Schlips & Kragen, Das Magazin für den Herren, verbrachte den Tag vor dem Symposium in ihrem kleinen Büro und ackerte sich durch zweihundertfünfundsiebzig Kurzgeschichten. Ein Gutes hatte es ja: Wenigstens brauchte sie sich heute nicht um den schwankenden, fast zwanzig Zentimeter hohen Stoß von zerknitterten Gedichten und anonymen Briefen zu scheren, der sich während der vergangenen Woche auf ihrem Schreibtisch angesammelt hatte.
Ab und zu schauderte sie zusammen, schüttelte den Kopf oder pfiff abfällig durch die Zähne — tss tss tss! »Ist denn das die Möglichkeit«, dachte sie verächtlich, »in dieser ganzen Sammlung verschleierter erotischer Fantasien kommt nicht mal ein einziger geiler Höhepunkt vor — gottverdammte Angsthasen!«
IV
Die übrigen Diskussionsteilnehmer zerbrachen sich die Köpfe, warum wohl die Banane krumm sei.
Warner Cleftine befand sich am späten Nachmittag auf einer Party des Living Theatre. Blöderweise schien es völlig unmöglich zu sein, an Judith Malina ranzukommen. Es war also auch zwecklos zu versuchen, ihr mit seiner außerordentlichen Intelligenz zu imponieren — oder, besser gesagt, mit dieser faszinierenden Mischung aus Geilheit, Witz, Scharfsinn und Wichtigtuerei, die er sich für sie ausgedacht hatte.
V
Mal kopfschüttelnd, mal starr vor Schreck überflogen sie die druckfrische Ankündigung mit den diversen Themen für das Symposium, die soeben mit der morgendlichen Post gekommen war. Ganz unten am Rand des Programms hatte jemand einen Gruß hingekritzelt und sie zum Auftakt der Feier zu einer Cocktailparty im Club der Fakultät eingeladen.
Andere hätten sich wer weiß was darauf eingebildet, zu den wenigen Auserwählten zu gehören, die einer solchen Einladung für würdig befunden worden waren — nicht aber Ron und Al. Beide versteinerten, ihre Gesichter wurden kreidebleich und in ihren Köpfen überschlugen sich die Gedanken. Ron presste vor Wut Ober- und Unterkiefer aufeinander und knirschte mit den Zähnen, bis die Wurzeln knackten.
»Das kann doch nicht ihr Ernst sein!«, flüsterte Al schließlich.
»Und ob das ihr Ernst ist!«, meinte Ron.
»Diese blöden Punks! Die scheinen es ja ganz schön eilig zu haben, die Sache endgültig unter die Erde zu bringen. Das bedeutendste literarische Ereignis, seit Pound nach Venedig abdampfte, und die können’s gar nicht abwarten, das Ende an die große Glocke zu hängen!«
Rons Gesicht hatte sich vor Wut knallrot verfärbt. Er konnte sich kaum noch beherrschen. »Ich habe fast den Eindruck«, sagte er dann plötzlich langsam und fast feierlich, »dass es angebracht ist, einen kleinen praktischen Test des Unternehmens Kartoffelsalat steigen zu lassen ...«. Worauf sie beide gleichzeitig in ein hämisches Gekicher ausbrachen, das dem Glöckner von Notre-Dame alle Ehre gemacht hätte.
Kurze Zeit später standen Al und Ron über die Glastheke von Smiler’s Deli am Sheridan Square gebeugt und kämpften mit der Qual der Wahl. Sollten sie nun zwei Pfund von dem öligen deutschen Kartoffelsalat nehmen oder doch lieber die andere Sorte, die mit der vielen Mayonnaise?
Am Ende entschieden sie sich für die weiße glitschige Pampe, und zwar erstens wegen ihrer fotogenen Qualitäten, zweitens wegen ihrer vorzüglichen Gleitfähigkeit und drittens, weil sie wussten, dass dieses Zeug garantiert auf der Haut festpappte. In Gedanken versunken streichelte Al zärtlich die weiße Pappschachtel mit dem Drahthenkel unter seinem Arm. Ron besorgte inzwischen die Plastikteller.
Ein paar Minuten später trainierten sie in Rons Apartment, volle Salatteller gegen eine Büste von Homer zu schleudern.
VI
Es war ein bitterkalter Winterabend. Der Wind draußen machte sie fast genauso high wie die Amylnitrit-Kapseln, die sie sich im Taxi verstohlen in die Nase gepoppt hatten.
VII
In der Lobby der Furie Hall hatte der Crabhorne Bookshop eine kleine, aber außerordentlich interessante Ausstellung mit Büchern der Beat-Generation vorbereitet. Ein überpinselter Ace-Books-Ständer aus Metall war von oben bis unten mit Werken wie The Beat Scene, Casebooks on the Beats und Howl vollgestopft; dazu kamen diverse City Lights Pocket Poets, verschiedene Ausgaben von Beatitude, Semina, Black Mountain Review, zahlreiche Publikationen aus der Jargon Press, einzelne Nummern von Kulchur, Yugen, The Shriek of Revolution, Marx-Ra, Gone Muh-Fu Gone und unzählige Heftchen und vervielfältigte Gedichte der Bewegung.
Gleich daneben stand eine Staffelei, auf der ein eleganter, mit Samt ausgeschlagener Glaskasten zur Schau gestellt war. Darin befand sich, sauber aufgereiht, eine Sammlung von Absagebriefen verschiedener Verlage. Fest davon überzeugt, dass die Literaturgeschichte ihnen eines Tages recht geben würde, hatten diese Banausen insgesamt zwölf Mal das Manuskript von On the Road abgelehnt. Das Ganze war ein bisschen irritierend und mit den dreihundertfünfzig Dollar, die die Sammlung inklusive Glaskasten bringen sollte, hatte Crabhorne offensichtlich ein paar Nummern zu hoch gegriffen.
Eine Abteilung war für »Manuskripte des Himmels« reserviert. (Tatsächlich hätte sie mit ihrem lächerlichen Zeltdach glatt als Kirmesbude durchgehen können.) Hier durften die Besucher — unter strenger Aufsicht, versteht sich — die Originalmanuskripte von Edward Dahlbergs Garment of Ra bestaunen, Ginsbergs Sunflower Sutra, Corsos Vestal Lady, eine wunderschöne Reed-College-Kalligraphie des frühen Phil Whalen und die eher deplatziert wirkende Korrespondenz zwischen Autoren und Verleger, komplett mit Anmerkungen und Kommentaren zur Veröffentlichung von The Beat Generation and the Angry Young Men.
Der Buchhändler hatte keine ruhige Minute. Wenn er seine Bücherstapel zurechtrückte, ließ er gleichzeitig, wie eine versteckte Kamera im Supermarkt, seine Augen nach rechts und links schweifen — immer auf der Lauer nach potenziellen Bibliokleptomanen oder, auf gut deutsch, Bücherklauern. Sein Herz war unter einem Panzer von leeren Alka-Seltzer-Schachteln verborgen. Denn Crabhorne hatte mehr als einmal die traurige Erfahrung machen müssen, dass derselbe junge Poet, der ihm erst vor einer Minute eine tadellose Ausgabe von A Lume Spento verkauft hatte, die offenbar außer zum Signieren noch nie aufgeschlagen worden war; auf dem Weg nach draußen ein druckfrisches Exemplar von Pommes Pennyeach mitgehen ließ.
Das Geschäft lief nicht schlecht. Es schien fast so, als wollte sich das Symposium mit all seinem Beerdigungsgeschwafel Lügen strafen, denn paradoxerweise fand es grade zu Beginn einer Periode statt, in der die Nachfrage nach der Beat-Literatur, wenigstens seitens der Bibliotheken, enorm anstieg. Urplötzlich stand den Budgets der College-Bibliotheken massenhaft überschüssige Kohle zur Verfügung, um Beat-Relikte und Manuskripte zu erwerben. Am Abend des Symposiums zum Tod der Beat-Generation verhökerte Crabhorne beispielsweise einen kompletten Satz des Magazins Beatitude für fünfundzwanzig Kröten an einen Bevollmächtigten der Ohio-State-Universitätsbibliothek. Und der Kurator der Harris Collection an der Brown University Library — zwinker Howard Hunt zwinker zwinker — ließ am selben Abend ein kleines Vermögen für die frühe Ginsberg-Korrespondenz springen. Eine signierte Erstausgabe von On the Road (»Für Martin Buber«) mit unbeschädigtem Schutzumschlag brachte 17,50 Dollar. Und die ganze Zeit über wimmelte es nur so von Parnassus-Jüngern; mehrere Poeten kamen am Stand vorbei und signierten ihre Bücher gleich stapelweise.
VIII
Inzwischen war auch Emil Cione mit einer devoten und im übrigen recht zynischen Gefolgschaft von Studenten eingetroffen.
IX
Finanziert wurde das Symposium übrigens vom Foment Magazine, das wegen seiner Förderung exzellenter Literatur und liberalen, fast schon sozialistischen Gedankenguts seit siebenunddreißig Jahren an der Spitze aller Literaturzeitschriften überhaupt stand. Foment war in der Tat so radikal, dass es von der Literaturabteilung der CIA regelmäßig übergangen wurde, wenn es um die Gewährung von Zuschüssen oder verkappten Stipendien ging. Nach dem Krieg gab es ein paar Jahre, in denen kaum einer gewagt hätte, das Café Figaro ohne die letzte Ausgabe vom Foment zu betreten. Überall begegnete man Typen mit zusammengerollten Exemplaren, die sie gerade weit genug unter dem Jackett herauslugen ließen, dass man das Cover erkennen konnte.
Für diejenigen, die den Pulsschlag der Kultur aus nächster Nähe beobachteten, war es unmöglich, die Beats zu ignorieren. Die Informationen, die sich in den Köpfen des Verlegerteams vom Foment angesammelt hatten, unterschieden sich jedoch kaum von dem enormen Pressewirbel, den Howl oder On the Road entfacht hatten — und möglicherweise auch das Häuflein von Poeten, das sich in den Mittfünfzigern in San Francisco zusammengefunden hatte. Der Wahnsinnskick an der Sache, Entstehung, Geist und die fieberhafte Erregung des Phänomens waren dem Horizont der Fomenter glatt entgangen. Selbst die, die mit der Bewegung eigentlich sympathisierten, hielten sich zurück; man hatte fast den Eindruck, als schämten sie sich, einen elitären Kreis »neobuddhistischer Spinner, die an Erleuchtung leiden«, mit dem Lorbeerkranz ihrer Anerkennung zu schmücken. Und so kam es, dass man die Literatur der BG mit einer Art weiser Weltkenntnis und zitatenverschmierter Stichelei kritisierte — einer äußerst vorsichtigen Mischung allerdings, mit massenhaft eingebauten Hintertürchen. Denn diese Rezensenten hatten weder Bock, jetzt als Spießer dazustehen, noch später von der Nachwelt als ein Haufen ausgemachter Trottel abgetan zu werden. Schließlich fanden sich ja in der Literaturgeschichte Beispiele genug — man denke nur an die scharfzüngigen Kritiker Keats’.
Oder anders gesagt, das Interesse der aufsässigen Jugend musste sehr sorgfältig gelenkt werden, richtig? Und wenn man seine Autorität nicht ganz verlieren wollte, durfte man sich keinesfalls dazu hinreißen lassen, mitten in einer Tristan-Tzara-Dichterlesung Flugblätter und faule Tomaten auf die Bühne zu feuern, stimmt’s? Schließlich war jedermann klar, wie das Schicksal solcher Literaturverächter häufig genug aussah: Spätere Jahre, gar Jahrhunderte legten sich ganze Zettelkästen über sie an und plötzlich gab es jede Menge spitzer Federn, die geradezu darauf brannten, die Verächter zu erledigen. Eingedenk dessen hielten es die Herausgeber des Magazins für angemessen, zu Ehren ihrer kürzlich verblichenen BG-Kameraden eine fromme Totenwache, wie es so schön heißt, zu arrangieren.
Das Programm des Symposiums zum Tod der Beat-Generation sah folgendermaßen aus: Die erste Hälfte war den Ursprüngen und dem sozialen Hintergrund der Bewegung gewidmet. Es ging los mit (hoffentlich!) kurzen Einführungsstatements der fünf aktiven Teilnehmer, an die sich dann die erste Gesprächsrunde anschließen sollte, bei der den Rednern Gelegenheit gegeben werden sollte, gegenseitig zu ihren Ausführungen Stellung zu nehmen.
Danach folgte eine zwanzigminütige Pause; mit Abstand der Höhepunkt des ganzen Abends. Was konnte aufregender sein, als nach Herzenslust zu klatschen und zu tratschen, zum hundertsten Mal die Vergangenheit durchzukauen, mampf mampf, und nebenbei noch schamlos ein Gesicht nach dem anderen strengstens unter die Lupe zu nehmen?
Die zweite Hälfte der Veranstaltung würde sich mit liebevollem Verständnis den Wurzeln der Krankheit widmen, also dem besagten Verfall und Tod der Beat-Generation. Zum Schluss war noch eine Fragestunde vorgesehen, bei der die Diskussionsteilnehmer auf die Fragen des Publikums eingehen sollten.
Auf den Sitzen der Furie Hall hatten die Veranstalter Programmzettel verteilt und ihnen ein weißes Blatt für die Fragen beigelegt, da man verständlicherweise ein beträchtliches Maß an Bissigkeiten aus dem Publikum befürchtete. Ehe es dann endlich losging, wanderten Handlanger der Foment-Verleger durch die Gänge und sammelten die Blätter wieder ein.
Kurze Zeit später lag der dicke Stoß vor dem Moderator in der Mitte der Runde. Die Frageblätter erinnerten ihn verdächtig an den Abschaum der allmorgendlichen Foment-Leserbriefe. Er überflog ein paar Fragen und fuhr zusammen.
»Kann man bei der modernen Romaninterpretation noch von einem Sinn für das Göttliche sprechen?« lautete die erste Frage. »Wird das göttliche Bewusstsein die Supernova überleben?«
»Hat die Atombombenexplosion von Hiroshima eigentlich auch menschliche Seelen zerstört?«
»Warum wurde Norman Podhoretz nicht in die Gesprächsrunde aufgenommen?« Und, auf dem gleichen Blatt: »Warum hat Mr. Cione 1954, als er noch als Lektor für Random House tätig war, es abgelehnt, seinen Verlag zum Druck des großen amerikanischen Romans Spine of Ferrows Willow zu überreden?«
»Ach du lieber Himmel«, stöhnte der Moderator diskret, »das kann ja heiter werden!«
Unmöglich können wir die intellektuelle Totenwache zu Ehren der Beatniks hier in allen Einzelheiten schildern, schließlich wollen wir euch in dieser Story noch auf der Afterparty des Symposiums sehen. Ihr könnt euch aber für circa zweihundertfünfzig Dollar von der Library of Congress eine Transkription des Ganzen auf Mikrofilm zuschicken lassen. Dort hat die CIA-Abteilung für dichterische Aktivitäten sie nämlich deponiert — nach Inspektion und Analyse wohlgemerkt.
Wichtiger ist es, euch ein paar Kleinigkeiten über die Diskussionsteilnehmer und natürlich auch unsere beiden Partisanen von der Kartoffelfront zu verraten. Aber haltet uns bitte nicht für indiskret, wenn wir dabei auch einige eklatante Knackser in den Facetten ihrer Diamantenseelen zutage fördern.
Sprecher A: Doris L. Malik. Sogenannter Schlaukopf. Texterin, Herausgeberin, Schriftstellerin, Säuferin. Atheistin aus mangelnder Erfahrung auf dem religiösen Gebiet. Sie strengt sich immer mächtig an, in der Öffentlichkeit so gelangweilt wie nur was zu erscheinen, denn schließlich »war ja sowieso alles schon mal da«. Als sie für die Gesprächsrunde ausgewählt wurde, sagte sie spontan zu; allerdings muss dazu angemerkt werden, dass bei den Programmdirektoren offenbar irgendwelche vagen Erinnerungen an die Zeit den Ausschlag gaben, als sie noch jung und knackig war und ihre Jugend mit den Poeten und Radikalen der frühen zwanziger Jahre vertat.
Damals hatten die Cafeterias des Village die Kellergeschosse aller New Yorker Museen reichlich mit Ölschinken eingedeckt, auf denen Doris L. Malik noch heute im Stil der Flintenweiber zu bewundern ist.
Und auch ihr Geheimnis kommt nun ans Tageslicht ... tja, ist nun mal nicht zu ändern: Sie ist ein krankhaftes Klatschmaul! Im Laufe der Zeit hat sie mindestens fünfhundert Briefe losgeschickt, die meisten davon an J. Edgar Flabflab, und darin die »Vergehen« ihrer Freunde und Bekannten ausgeplaudert. Und bei dem ständig wachsenden Drogenkonsum unseres Jahrzehnts konnte sie den Schweinen vom Drogendezernat in den letzten Jahren wirklich ein paar saftige Stories liefern.
Sprecher B: Emil Cione. Alle drei Jahre preisgekrönter Autor eines neuen Gedichtbandes. Er hat auch mal einen Bestsellerroman geschrieben, The Mountain of Reason, und der hat nur deshalb keinen Preis gekriegt, weil die zentrale Figur in diesem Buch einen Prozess in Gang setzte. Das ganze Ding basierte nämlich auf dem Privatleben eines Literaturkritikers, der es gewagt hatte, Ciones ersten Gedichtband anlässlich einer Besprechung im New York Herald Tribune zu verreißen. Aber diese Sache sparen wir uns lieber für eine andere Story auf. Cione betätigt sich nebenbei als Immobilienspekulant, ein Hobby, auf das er schon als junger Bursche stieß, als er in einer Vorlesung über die präsokratischen Philosophen von dem berühmten Oliven-Coup des Thales von Milet erfuhr:
Damals hatte sich irgend so ein neunmalkluger Besserwisser an den berühmten Mathematiker und Astronomen herangemacht und ihn gefragt: »Man sagt, Ihr seid sehr klug, Thales, wie kommt es dann, dass Ihr so arm seid und eure Tage in dieser erbärmlichen Hütte verbringen müsst?« Thales ließ seine Augen über den winterlich verhangenen Himmel schweifen und erkannte, dass die Olivenernte dieses Jahr besonders reich ausfallen würde. Am nächsten Tag kaufte er alle Olivenpressen in Milet und Chios auf, und als die Ernte dann tatsächlich alle Erwartungen übertraf, verpachtete er sie zu Wahnsinnspreisen und sahnte höllisch ab. Und der junge Cione war nur allzu gern bereit, sich dieses Gleichnis auf die Stirn tätowieren zu lassen.
»Meine Olivenpressen sind die Grundstücke und Häuser auf dem oberen Broadway. Die werden eines Tages alle mir gehören!« erzählte Cione einmal einem entsetzten Freund im Vertrauen. Übrigens sind einige der schönsten Verse, die je ein vom CIA finanziertes Magazin zierten, entstanden, während Cione sich in den Büros vom Vermessungsamt herumdrückte, in alten Flurkarten schmökerte und versuchte, die »strittigen Fälle« herauszupicken, d. h. solche, wo möglicherweise ein paar Meter Grenzlinie die tollsten Kontroversen entfachen und vielleicht sogar einen Prozess verursachen konnten.
Cione konsumierte viel zuviel Amphetamin, um nebenher auch noch zum Säufer zu werden — das kam erst später; als er in Todesangst das Speed absetzte, weil ihm die ersten Zehennägel ausfielen. Überall prahlte er mit seiner politischen Überzeugung, die angeblich von Pindar und Simonides abstammen sollte — er verstand sich als ein Poet des Kalten Krieges unter anderen KK-Poeten. Jedenfalls hatte er seine Füße tief ins russenfeindliche Eis getaucht. Aber vielleicht sind wir jetzt ein bisschen unfair, denn andererseits hatte Cione immer ein offenes Ohr für seine Studenten und trauert heute noch den verlorenen Kameraden seiner Jugend nach.
Dafür verabscheute er jede Art von Schmutz und Schund. Schon bei der Vorstellung des »verschwitzten Durcheinanders«, das entstand, wenn sich Proleten zu den schrillen Klängen von lausigen Saxofonen auf ihren fleckigen Matratzen wälzten, schüttelte er sich vor Ekel. Dreck war sein Albtraum. Dabei war alles, was er wirklich vom Ansehen kannte, der Mist, der bei den Hinterzimmerversammlungen der kommunistischen Zelle verzapft wurde, der Dreck unter den Fingernägeln von North-Beach-Bewohnern und vor allem die Verkommenheit der Dirt Road — so hieß damals noch das bulgarische Nuttenviertel am Times Square. Der Gedanke an ein Objekt, das man ihm in den Arsch rammte — ein Akt, der manchmal in den Versen der Beats geradezu verherrlicht wird, — verfolgte ihn bis in seine grellen Träume und brachte ihn fast in die Klapse. Tatsächlich wies auch die psychiatrische Studie, die der CIA von ihm angefertigt hatte, auf die Existenz eines immer wiederkehrenden Albtraums hin, in dem ein stoppelbärtiger Beatnik Cione seinen stinkenden, kotzegeschwängerten Atem in den Nacken bläst, während er ihn in den Arsch fickt und gleichzeitig zwingt, Podhoretz’ Artikel »Die unwissenden Bohemians« aus dem Partisan Review vorzulesen, den er mit zitternden Händen umklammert hält.
Sprecher C: Corgere »Cheevy« Samuelson. Säufer. Vor der Ehefrau verborgen, stapeln sich fünfzehnhundert leere Seagram’s-7-Flachmänner in ihrem nicht benutzten Heizungskeller. Früher war Cheevy mal Amerikas größter Experte für den proletarischen Arbeiterroman gewesen, aber das war zu einer Zeit, als Amerika sich um solche Sachen noch kümmerte. Seine Karriere hatte mit einer so rasanten Explosion begonnen, dass sich die Agenten des New Yorker Verfassungsschutzes als Dichter tarnten und ihm in den Nächten der Großen Depression von einer Kneipe im Greenwich Village zur anderen folgten. Mittlerweile aber hatte Cheevy sich gründlich verändert. Inzwischen pisste er sich beinahe in die Hosen vor lauter Angst, dass man ihn für einen Sympathisanten halten könnte. Wo sollte er denn schließlich seine siebenundzwanzigtausend Bücher unterbringen, falls er eines Tages ganz plötzlich auf Tauchstation gehen müsste?
Insgeheim bewahrte er sich eine große Bewunderung für Stalin und die chinesische Kulturrevolution. Aber seine Empfindsamkeit hatte er inzwischen wenigstens soweit sublimiert, dass er nicht länger Gedichte über Hobo-Camps im Mittelwesten verfasste, derweil er selbst in der Bibliothek der Yale-Universität hockte. Später, während er noch geduldig auf die magentarote Astralprojektion über dem Weißen Haus wartete, wurde er über Nacht zum reichen Mann — seine Familie hatte ihm die Buchladenkette, die sie in verschiedenen Collegestädten aufgezogen hatte, vererbt.
Aber wir dürfen auch nicht allzu hart mit Mr. Samuelson umspringen, denn gerade heute Abend standen ihm die Tränen in den Augen, so unglücklich und verzweifelt war er — just an diesem Tag hatte nämlich Viking Press ein Buch mit Essays von ihm abgelehnt, eine Nachricht, die noch nicht bis zum Tisch der Diskussionsteilnehmer vorgedrungen war.
Sprecher D: Warner Cleftine, Chefherausgeber des Foment-Magazins und Moderator des Symposiums. Sein weißes Haar fiel ihm in einer hübschen weichen Conway-Twitty-Tolle auf die leicht gewölbte Stirn. Ein Muster an Ernsthaftigkeit. Die kleinste Ungerechtigkeit machte ihn rasend. Und keiner konnte ihm das Wasser reichen, als es ein paar Jahre später während des Krieges darum ging, Geldmittel zu beschaffen, mit denen man die Musterungsbehörde schmieren konnte. Er war ein Meister der Strategie. Seine Freunde holte er aus dem Wehrdienst wieder heraus, indem er andere Freunde und ehemalige Kommilitonen im Ausschuss anrief. Aber das ging auch nur so lange gut, bis ’Nam schließlich sogar Freund gegen Freund aufbrachte.
Für befreundete Schriftsteller konnte Warner bei mysteriösen und nie genannten Quellen volle siebenhundertdreißig Tage finanzielle Sicherheit und soziales Ansehen lockermachen. Im ersten Jahr kriegten sie die unglaubliche Summe von zwölfhundert Dollar aus dem Guggenheim-Fonds und im Zweiten ein Rockefeller-Stipendium. Die Ahhhs und Ohhhs seiner Freunde überschlugen sich nur so.
Außerdem war er Spezialist, wenn es um Einladungen zu irgendwelchen staatlich geförderten Konferenzen ging. Unter seinem Bett hatte er immer einen fertig gepackten Koffer liegen.
Sprecher E: John Farraday. Das Äußerste an einem Beatdichter, den man überhaupt dazu bewegen konnte, an dieser Gesprächsrunde teilzunehmen. Im Grunde war Farraday eher ein hartgesottener Hipster als ein Beatnik. Er schwamm im Strom der Energie mit, die von der Bewegung ausging, aber er war kein echter Gläubiger. So was Ähnliches wie diese Macker, die bis 1970 warteten, ehe sie gegen den Vietnamkrieg protestierten.
Farraday fühlte sich mächtig schuldig, weil er es einfach nicht fertigbrachte, spontan zu schreiben. Für jeden Absatz brauchte er tagelang, und das lag nicht etwa am kreativen Kampf eines Josef Conrad, sondern an dem endlosen »Warum? Warum? Warum?«, das er — mit dem Kopf auf der Olivetti vor sich hinmurmelte.
Es war schon merkwürdig, dass Farraday sich bereit erklärt hatte, bei der Diskussion mitzumachen. Manche schrieben das dem Druck seines Agenten zu. Andere glaubten, dass er betrunken war, als man ihn fragte. Dann hatte er es vermutlich vergessen und erst der schreckenerregende Dankesbrief vom Foment half ihm wieder auf die Sprünge. Er hatte übrigens eine selbstquälerische Neigung, andere zu beleidigen, und das war möglicherweise auch ein Grund für sein Erscheinen — sozusagen als Pfeffer für einen ohnehin langweiligen Abend.
Sein Geheimnis: Er ist aktives Mitglied im 26. Grad bei einer Sekte von Kali-Anbetern. Dabei liebt er seine richtige Mutter über alles und schwebt ständig in Angst, dass sie eines Tages durch Zufall hinter seine Affäre mit der Großen Mutter kommt. Säufer.
Die beiden Provokateure des Unternehmens Kartoffelsalat hatten mit Müttern wenig am Hut. Al war ein notorischer Hitzkopf und Unruhestifter. Seine oberste Devise lautete: »Im Zweifelsfall hilft nur Krawall«. Zur Inspiration hatte er sich über seinem Schreibtisch eine Kopie von Degas’ berühmten Absinth-Trinkern aufgehängt. Degas faszinierte ihn und er tat sein Bestes, um seinen Lebensstil so gut es ging zu imitieren. Zur Zeit des Symposiums hatte er seine Frau und vier Kinder in einem mickrigen Rattenloch in der Bronx versteckt. Trotzdem war er von seiner späteren Rechtfertigung überzeugt: Auch ich nur ein miserables Arschloch bin, ein mieser Vater, ein Dreckskerl, ’ne bepisste Wanze, solange meine Dichtung existiert, kann die Geschichte mich nicht unter ihrem riesigen Schutthaufen begraben — selbst wenn sie mir wer weiß, was für Schandtaten anhängen. Nicht mal Poe haben sie geschafft, merkst du was, Mann?
Ron, der zweite Provokateur, war ein hervorragender Übersetzer persischer Poesie und galt außerdem selbst als exzellenter Dichter. Nur eine Sache stand seiner meteoritenhaften Karriere als Übersetzer und Poet im Wege: sein krankhafter Trieb, Kakerlaken zu verspeisen. Aber, aber ... wer wird sich denn da vor lauter Ekel gleich abwenden wollen? So schlimm ist das ja nun auch wieder nicht. Schließlich leckt Emil Cione mit Vorliebe die Vaseline von gebrauchten Besenstielen ab — was ja wohl mindestens genauso fragwürdig ist.
Der Ärger ging los mit traumatischen Erfahrungen, die er beim Überlebenstraining der US Air Force in einem Dschungelgebiet durchstehen musste. Nachdem auch sein Geheimvorrat an Milky Ways aufgebraucht war und er an Flüssen vergeblich nach irgendwelchen kleineren Viechern gesucht hatte, verfiel er auf die feuchten bröckeligen Cafeterias unter dicken Felsbrocken. Und, um die wunderbaren Worte von William S. Burroughs zu zitieren: »Hätten Sie’s nicht genauso gemacht?« Alle hartschaligen Käfer waren okay, besonders die proteinreichen Maikäfer, aber in New York hieß die Devise: »Cucaracha!«
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.