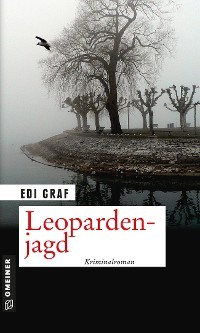Kitabı oku: «Leopardenjagd»
Edi Graf
Leopardenjagd
Linda Roloffs vierter Fall

Zum Buch
Von Rache getrieben Er tötet seine Opfer wie ein Leopard. Die Leichen versteckt er auf Bäumen, seine todbringende Spur zieht sich vom Bodensee über den Schönbuch bis nach Afrika. Die Polizei jagt einen Mörder, der den Namen »Chui« – Leopard – trägt, und nur ein Ziel zu kennen scheint: Rache. Auf der Liste seiner Opfer taucht auch der Name der Tübinger Journalistin Linda Roloff auf. Sie ahnt, dass nur einer sie retten kann: der kenianische Safariführer Alan Scott, der weiß, wie »Chui« denkt. Doch Scott ist seit Wochen in Afrika verschwunden ...
Edi Graf, Jahrgang 1962, studierte Literaturwissenschaft in Tübingen und arbeitet als Moderator und Redakteur bei einem Sender der ARD. Zuhause ist er in Rottenburg am Neckar. Seit über 30 Jahren bereist der Autor den afrikanischen Kontinent und lässt neben seinen Protagonisten, der Journalistin Linda Roloff und ihrer Fernliebschaft, dem Safariführer Alan Scott, die gemeinsam zwischen Schwarzwald, Neckar und Afrika ermitteln, auch Tierwelt und Natur tragende Rollen zukommen. Er greift aktuelle und bewegende Themen auf und liefert dazu detailliert recherchierte Hintergründe, die er geschickt in den Plot integriert. Durch authentisch beschriebene reale Handlungsorte haucht er seinen Krimis Echtheit und Leben ein.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!



Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
info@gmeiner-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von Schwarzvogel, Photocase.de
ISBN 978-3-8392-3048-0
Widmung
Für unsere Tochter Rahel
– afrikanische Sonne in unserem Leben –
Zitat
Rache trägt keine Frucht!
Sich selbst ist sie die fürchterlichste Nahrung,
ihr Genuss ist Mord, und ihre Sättigung das Grausen.
Friedrich Schiller – Wilhelm Tell
PROLOG
Montag, 21. November 1994, Kenya, Südküste
Der weiße Mann sah regungslos zu, wie die Leiche der Frau von der unruhigen Brandung am Riff verschlungen wurde. Der Ozean würde den Rest für ihn erledigen. Er konnte es sich nicht leisten, dass man ihre Leiche fand, zu viel stand auf dem Spiel. Spiel ist der passende Ausdruck, dachte er. Sie hatte mit ihm gespielt, und sie hatte verloren, weil sie das Spiel zum falschen Zeitpunkt beenden wollte.
Ihre letzten Minuten waren grausam gewesen, doch daran mochte er jetzt nicht denken. Das brodelnde Meer hatte seine milchige Gischt wie ein wogendes Leichentuch über ihren Körper gebreitet. Dort, wo noch vor wenigen Sekunden ihr gelbroter Sari aus dem Wasser ragte und ihm ein toter brauner Arm, von den Wogen emporgetrieben, zuwinkte, wie einst Käptn Ahab seiner Mannschaft, als er, an den Weißen Wal gefesselt, in den Fluten versank, war jetzt nichts zu sehen als das ewige Kommen und Gehen der grauen Unendlichkeit des Ozeans.
Der Regenschauer hatte die Touristen kurz vor Sonnenuntergang in die Hotels zurückgetrieben, und er war allein am Strand gewesen, als er das weiße Laken mit der Leiche in dem Auslegerboot verstaut und sich auf den Weg zur Riffkante gemacht hatte. Der Strand war menschenleer gewesen, das Meer eine grau in grau wabernde Wassermasse. Ein düsterer Regenvorhang, aus Süden kommend, entzog das kleine Boot bald dem neugierigen Blick des dunkelhäutigen Jungen, der dem weißen Mann unbeobachtet an den Strand gefolgt war und sich hinter dem Stamm einer Palme versteckt hielt.
Der weiße Mann blieb mit dem Ausleger am Riff, bis er auf die Haut durchnässt war und sicher sein konnte, dass die Leiche nicht wieder auftauchen würde. Hier, 300 Meter vor der Küste, würde niemand nach der Frau suchen. Die zurückgehende Flut würde sie aufs offene Meer hinaustreiben, wo die Räuber des Indischen Ozeans ihr Festmahl abhielten. Bewusst hatte er darauf verzichtet, sie mit einigen Kilo Blei aus dem Tauchcenter zu beschweren; sollte sie wider Erwarten an den Strand gespült werden, würde man sie für eine Ertrunkene halten und kein Mensch würde auf den Gedanken kommen, sie zu obduzieren, niemand würde ihren Körper nach Spuren absuchen, nach dem Sperma, das er in ihr hinterlassen hatte. Die blauen Male an ihrem Körper und die klaffende Wunde an ihrem Kopf, die der letzte, tödliche Hieb mit der Panga verursacht hatte, würde man als Verletzungen aus dem Meer ansehen. Vielleicht war sie im Kampf der Ertrinkenden gegen das Riff geschleudert worden, vielleicht war sie aus einem Boot gefallen und in die Schraube geraten, vielleicht, vielleicht, vielleicht …
Viel wahrscheinlicher war, dass man sie nie finden würde, ja, nicht einmal vermissen, zumindest nicht hier an der Küste, denn ihre Familie lebte weit entfernt im zentralen Hochland von Kenya. Er konnte nicht ahnen, dass es den kleinen Jungen gab, denn sie hatte ihren Sohn vor ihm geheim gehalten, nie über ihn gesprochen, nie von ihm erzählt.
Der Knabe hatte in der kleinen Hütte in Ukunda gewohnt, mit den anderen Kindern gespielt, sie hatte ihn nie mit ins Hotel gebracht. Nur dieses eine Mal war er ihr gefolgt. Heimlich. Geräuschlos wie Chui, der Leopard, auf seinem Beutezug. Wie es ihm die Älteren gezeigt hatten. Am Abend ihres Todes.
Er hatte ihre Spuren im Sand erkannt, war bis zu dem Zaun geschlichen, der das Hotelgelände umgab, und dort, wo er die schwarzweißen Mantelaffen über den Ast eines Flammenbaums aus dem Hotelgarten klettern sah, war er hineingelangt. Den Baum hinauf, auf dem Ast über den Zaun und hinunter ins Gras. Wie die Affen. Wie Chui.
Es hatte lange gedauert, bis er seine Mutter fand. Die Hütte stand neben einem kleinen Haus unter einer Akazie, abseits, von den übrigen Gebäuden der Hotelanlage durch eine hohe Hecke getrennt. Eine Kette versperrte den schmalen Zugang. Zuerst hatte er ihre Stimme erkannt, dann die Stimme des Mannes gehört. Sie hatten in einer Sprache gesprochen, die er nicht verstand. Er war unter der Kette hindurchgekrochen und hatte durch das glaslose Fenster in der Lehmwand gespäht. Eine Pritsche, ein paar Möbel, ein Durcheinander von leeren Kanistern, verbeulten Blechfässern, Holzstangen, Müll.
Er hatte gesehen, wie der Weiße seine Mutter an den Haaren zerrte und zu Boden warf. Hart traf die Faust ihr Gesicht und brach ihr das Nasenbein. Ihr gelbroter Sari war bis zu den Hüften hochgeschoben, blutend und wimmernd lag sie im Dreck, ihre schlanken Finger krallten sich in den klammen Lehmboden der Hütte, doch die kühle Erde vermochte nicht, das Brennen auf ihrer nackten Haut zu kühlen. Die Worte des Weißen klangen hart, aus ihrem Mund kam nur ein leises Wimmern. Er schlug zu, immer wieder, trat sie mit den Füßen wie im Rausch, schlug noch einmal zu, obwohl sich die Frau nicht mehr bewegte. Dann nahm er die Panga von der Wand und spaltete ihr den Schädel. Er hielt erst inne, als er das Geräusch an der Fensteröffnung vernahm.
Der Junge stand wie erstarrt und vermochte nicht, sich zu rühren. Tränen traten aus seinen Augen, sein Magen verkrampfte sich, Übelkeit stieg in ihm auf. Hatte der Mann ihn gesehen? Der Junge duckte sich, rannte zur Hecke und übergab sich.
Der Weiße trat vor die Hütte. Er hatte nicht die Augen, um Spuren zu finden. Der Junge lag, zitternd vor Angst, in seinem Erbrochenen und schloss die Augen. Er hörte, wie sich die Schritte des Weißen näherten. Er stapfte einmal um die Hütte und schien zu fluchen. Dann kam er auf sein Versteck zu. Zielstrebig. Er musste ihn entdecken!
Der krächzende Schrei ließ den Jungen zusammenzucken. Er riss die Augen auf und sah aus seinem Versteck zur Hütte hinüber. Die Mantelaffen jagten mit weiten Sätzen über das riedgedeckte Dach und suchten Schutz im dichten Blätterwald der Akazie. Der Weiße schimpfte jetzt laut und schleuderte den Affen ein paar Schoten hinterher, die verstreut im Gras lagen. Dann kehrte er in die Hütte zurück. Er musste sich beeilen, die Dämmerung hatte eingesetzt.
Als er Minuten später mit der Leiche der Frau, die er in ein Laken geschnürt hatte, aus der Hütte trat, folgte ihm Sam Mushowa.
Hinunter zum Ozean, der das Grab seiner Mutter werden sollte.
TEIL I SEEUFER
1
Zwölf Jahre später, Tsavo-Ost, Kenya
Hatte er einen Mörder beobachtet?
Er sah dieses Bild vor sich, immer und immer wieder. Diesen Mann, der dabei war, einen leblosen Körper auf einen Baum zu hieven. Die schlaffe Hülle, die als Last über der Schulter des schwer Atmenden hing. Das entsetzte Gesicht, als ihn der Überraschte anstarrte. Nur mit Mühe konnte er sich auf die rotsandige Piste konzentrieren, die über das flache Buschland entlang des Athi-River nach Südosten führte. Hier begann früher die für Touristen unzugängliche Region, die fast zwei Drittel des gesamten Tsavo-East umfasste. Doch jetzt wurde auch das ausgedehnte Gebiet entlang des Tiva für den Tourismus erschlossen und die Zeiten, wo er sich hier oben im Norden einsam in die Wildnis zurückziehen und seinen Gedanken nachhängen konnte, waren ein für allemal vorbei.
Die Sonne würde in einer Stunde hinter den Bergen des Yattaplateaus, die sich im Westen gegen den Horizont schoben, untergehen, dann würde die Nacht binnen weniger Minuten alles in Dunkelheit hüllen und den Jägern der Finsternis Tarnung bieten. Er musste versuchen, noch vorher den Parkausgang bei Maneaters Point und somit die Straße nach Voi und Mombasa zu erreichen.
Er hasste den Uhuru-Highway, die lange, monotone A 109, die von Nairobi zur Küste führte, und hatte den Umweg über Kitui gewählt, war in Mutomo abgebogen, um wieder einmal durch den Tsavo zu fahren. Zu lange würde er in den nächsten Wochen darauf verzichten müssen, und er liebte diese rotbraune Erde, in der er schon als Kind seine Fußabdrücke hinterlassen hatte. Tsavo, das war sein Afrika, zumindest ein Teil davon. Das Land der roten Erde. Große Herden von Elefanten, rot gefärbt durch die Staubbäder im trockenen Sand, unermessliche Savannen, endlos bis zum Horizont, Heimat von Büffel, Zebra, Leopard. Unten am Galana der schmale Streifen eines alten Galeriewalds, in dessen Bäumen Gelbschnabeltokos ihre Bruthöhlen und Weißrückengeier ihre Nistplätze hatten. Von den tiefhängenden Ästen stürzten sich die Graufischer auf ihren Jagdzügen ins Wasser und hoch über ihnen hielt der Kampfadler nach Beute Ausschau. Auf den sandigen Uferbänken sonnten sich regungslos die gepanzerten Echsen in trauter Zweisamkeit mit den dickleibigen Flusspferden, die ihre tonnenschweren Leiber an Land gewälzt hatten.
Er würde nach Deutschland fliegen, nachdem er in seiner kleinen Hütte am Diani-Beach noch das Notwendigste eingepackt hatte, und er wusste noch nicht, wie lange er blieb. Zum ersten Mal seit Jahren war er wieder verliebt. So verliebt, dass er sogar mit dem Gedanken spielte, Afrika für immer zu verlassen. Er hatte das Gefühl, dass seine Liebe zu Linda stark genug war, um diesen Verlust zu überwinden. Und vielleicht, so hoffte er im Stillen, wäre sie ja auch eines Tages bereit, ihm nach Afrika zu folgen.
Er hatte die Fahrt noch einmal genossen, die Herden an sich vorüberziehen lassen, Grantgazellen, Wasserböcke, Giraffen, Warzenschweine. Und die roten Elefanten. Jetzt musste er kräftig aufs Gas drücken, der Weg zum Tsavo-Tor war noch weit. Dort würde er als Erstes die Polizei verständigen.
Während der Landcruiser im schwächer werdenden Licht des scheidenden Tages über die Waschbrettpiste holperte, ging ihm diese seltsame Begegnung durch den Kopf. Zwei Männer, der eine tot, der andere, den Toten geschultert, unter den weit ausladenden Ästen der Schirmakazie verharrend, um deren Stamm sich die Wurzeln der Würgefeige wie eine hölzerne Todeskralle geschlungen hatten. Im Schatten der beiden ineinander verwachsenen Bäume hatte er den Mann erkannt. Der hatte gerade versucht, die Last von seiner Schulter auf den untersten, waagerecht verlaufenden Ast zu heben.
Seine scharfen Augen, die es gewohnt waren, im Busch die kleinste Bewegung wahrzunehmen und sogar die Fährte des zierlichen Löffelhundes während der Fahrt neben der Piste zu entdecken, hatten die seltsame Gestalt schon Minuten vorher entdeckt und beobachtet, wie sie ein schweres Bündel aus einem Fahrzeug hievte, schulterte und in Richtung der Würgefeige schritt. Im Fernglas hatte er das Gesicht des Tragenden für Sekunden scharf gestellt. Auf Höhe der beiden Bäume hatte er den Landcruiser ausrollen lassen und sich noch einmal vergewissert, ob ihn der Blick durch das Rohr nicht getäuscht hatte. Nein, er war sich trotz der großen Entfernung sicher gewesen: Den Mann kannte er. Sie hatten sich zwar schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen, doch es gab keinen Zweifel. Und so hatte er aus dem stehenden Fahrzeug heraus den Namen des anderen gerufen. Der war erschrocken herumgefahren, hatte die Last abgeworfen, eine Waffe gezogen und ohne Warnung auf ihn geschossen.
Er, der unbewaffnet war, hatte noch irgendetwas gerufen wie Hey, was soll das, begrüßt man so einen alten Freund, und seinen Namen hinübergebrüllt, doch der andere hatte zwei weitere Schüsse abgegeben, die ebenso wie die ersten fehlgegangen waren. Er hatte sich hinter die Beifahrertür gebückt, den Rover gestartet und versucht, so schnell es ging aus der Schusslinie zu kommen. Wirre Gedanken waren ihm durch den Kopf gegangen. Was hatte all das zu bedeuten? In jenem Moment, als das Bündel am Boden lag, hatte er darin den Körper eines Menschen erkannt und wußte, dass sein Bekannter hier im Tsavo versuchte, eine Leiche zu beseitigen.
Und Alan Scott war sich sicher, in ihm Lucas Wayne erkannt zu haben.
2
Der Befehl war eindeutig: Der Mann, auf den Nickson Kitema neben der Piste wartete, durfte die Straße nach Mombasa nicht erreichen. Weshalb – danach hatte er nicht gefragt. Es ging ihn nichts an, und es interessierte ihn auch nicht. Das Honorar würde stimmen. Im Geist fühlte er schon das Bündel Geldscheine in seiner Brusttasche. Für diese Summe würde er ihn locker umlegen. Es würde ihm nichts ausmachen. Seit er damals, 1997, im Vorfeld der Parlamentswahlen in seinem Land, an den Anschlägen auf Hotels und den Überfällen auf Touristen beteiligt war, machte er diesen Job. Sein Auftrag lautete, ihn unbemerkt verschwinden zu lassen. Dazu würde er ihn zunächst lebendig an einen sicheren Ort an der Küste bringen, eine verlassene Fischerhütte, 30 Kilometer südlich von Mombasa, in der Nähe von Ukunda. Ein gutes Versteck. Und das Meer wartete geduldig auf eine mondlose Nacht.
Er spähte durch das Glas. Sah den Landcruiser in der Ebene. Keine Täuschung. Er hielt den Atem an. Das musste sein Mann sein. Wer sonst sollte um diese Zeit noch durch den Tsavo fahren? Die Touristen hatten sich entweder in ihre Lodges verkrochen und fuhren erst am nächsten Morgen wieder hinaus, oder sie hatten, wie die meisten es taten, den Park noch vor Einbruch der Dunkelheit verlassen, um in ihre Hotels an der Küste zurückzukehren.
Hier, wo Kitema zwischen den hohen Dornbüschen lauerte, musste das Fahrzeug, wenn es dem kürzesten Weg Richtung Voi folgte, ein ausgetrocknetes Bachbett durchqueren. Es war selbst für einen Fourwheeler die einzige Stelle weit und breit, an der die steilen Ufer passierbar waren. Der Landcruiser würde sich langsam schaukelnd den Weg zwischen den mächtigen Steinquadern und den knietiefen Erdlöchern suchen, den selten Wasser führenden Zulauf des Athi überqueren und auf der anderen Uferseite wieder die Böschung erklimmen. Zwei schmale Rillen, hinterlassen von den zahlreichen Fahrzeugen, die an dieser Stelle schon den Bachlauf passiert hatten, wiesen den Weg, und es kostete den Fahrer volle Konzentration, hier nicht auszubrechen oder im weichen Ufersand steckenzubleiben.
Sobald der Landcruiser an dieser Stelle war, würde Kitema schießen. Der Rest wäre dann ein Kinderspiel. Seine Hand strich über den Mündungsfeuerdämpfer. Der leere Tank würde den Fahrer kurz darauf zwingen, anzuhalten und auszusteigen.
Dann würde Kitema zuschlagen.
3
Alan Scott liebte die holprigen Waschbrettpisten, die Gravelroads abseits der üblichen Fahrwege, die selbst einem alten Safariguide höchste Fahrkünste abverlangten. Wenn man sie mit einer stetigen, nicht zu langsamen Geschwindigkeit befuhr, schienen die Räder über die schmalen Querrillen hinwegzugleiten, nur die Schlaglöcher wurden dann eine leicht zu übersehende Gefahr. Rechtzeitig zu reagieren, sie zu umfahren, ohne mit dem Fahrzeug ins Schlingern zu kommen, das war die hohe Kunst der Bushdriver. Diese Straßen waren sein Leben, die Pfade, auf denen er am liebsten durch Afrika fuhr. Weil er wusste, wie er sie zu nehmen hatte, gehörten auch Gäste mit lädierten Bandscheiben und wertvollen Fotoausrüstungen zu seinen zufriedenen Kunden. Nie in seiner langjährigen Karriere als Safarifahrer war er in einem Warzenschweinloch gelandet oder hatte eine Ölwanne geschrottet.
Er schlug genervt mit der flachen Hand auf das Lenkrad, als er den Zeiger der Tankuhr schlagartig in den roten Bereich pendeln sah. Im Schatten einer gewaltigen Schirmakazie, deren überhängende Äste aus der Piste einen turmhohen Tunnel machten, trat er unbeherrscht auf die Bremse und blieb in der dichten Staubwolke, von den Reifen im roten Sand aufgewirbelt, stehen. Lärmend stob ein Schwarm Dreifarbenglanzstare aus dem Akaziendickicht hervor, und eine Horde Paviane floh, aufgeregt kreischend, auf den Baum. Missmutig kroch Alan von seinem klebrigen Sitz, knallte die Fahrertür zu und ging nach hinten, um den Reservekanister in den Tank zu füllen. Das Schweißband seiner Legionärsmütze war nass geschwitzt und er fuhr sich mit dem Handrücken über die glänzende Stirn.
Er schleppte den schweren 20-Liter-Kanister zum Tank, öffnete den Verschluss und schraubte den rüsselförmigen Einfüllstutzen auf das Ventil des Kanisters. Glucksend entleerten sich die ersten Liter in den Tank, während der Kanister, den er gegen den Jeep stemmte, Schluck um Schluck leichter wurde. Alan lauschte dem gleichmäßigen Schmatzen der zähen Flüssigkeit, als ihn plötzlich ein anderes Geräusch ablenkte.
Das laute Rascheln kam aus dem Dickicht hinter seinem Rücken und ließ ihn herumfahren. Fast entglitt ihm bei der raschen Drehung der Kanister. Das Rascheln wiederholte sich, und er suchte mit seinen Augen den Busch ab, ohne den Kanister abzusetzen. Nichts war zu sehen.
Wen er nicht bemerken konnte, war der Mann – Kitema –, der sich dem Rover von der anderen Seite genähert hatte und hinter einem kurzstämmigen Busch kauerte. Zwei Wurzelstücke, die er über den Rover und Alan hinweg in das Dickicht geschleudert hatte, hatten die Geräusche verursacht, die Alan von ihm ablenken sollten, wenn er sein Jagdmesser mit aller Kraft in den rechten Vorderreifen des Rovers stieß. Die Luft entwich zischend, doch das Geräusch verebbte im Glucksen des einlaufenden Benzins.
Alles war ruhig geblieben. Alan schraubte den Tankverschluss zu und bemerkte auf seinem Weg zur Fahrerseite sofort, dass etwas nicht stimmte; der Wagen schien zur einen Seite hin abzusacken. Zunächst dachte er an eine Unebenheit der Piste, eine Mulde, den Eingang zu einem Erdferkelloch, der einen Teil des Reifens verschluckt haben konnte, doch dann sah er die Deformierung des grauen Gummis und trat fluchend gegen den platten Reifen. Das hatte ihm gerade noch gefehlt! Okay, Reifenpannen gehörten dazu, waren Bestandteil jeder Safari. Einen Reifen zu wechseln, war eine Kleinigkeit im Busch. Trotzdem: Wenn es einen Platten gab, war es gewöhnlich im denkbar schlechtesten Augenblick. Auf dem Weg zur Flugpiste, wenn die Zeit wirklich drängte; mitten in der Büffelherde, die gerade dabei war, vielhundertköpfig die Piste zu überqueren; oder kurz vor Einbruch der Dunkelheit, wenn es kaum noch Tageslicht gab und die Batterie der Stirnlampe mal wieder schlappmachte.
Der Reifen war hin, und Alan stapfte ein weiteres Mal zum Heck, um das Reserverad und den Wagenheber zu holen. Mit einer Hand griff er nach einem Stein und setzte ihn als Bremsblock vor das linke Hinterrad. Den schlängelnden Körper, der unter dem Stein davonglitt, bemerkte er nicht. Die Nacht war in greifbare Nähe gerückt, nur ein Fingerbreit hob sich die Sonne noch über die Hügel im Westen. Die plötzliche Stille, die sich immer dann im Buschland breitmachte, wenn der Tag zur Neige ging und sich die friedlichen Sänger, Zupfer und Zirper zur Ruhe begaben, um den leisen und geräuschlosen Räubern der Dunkelheit Platz zu machen, hatte auf einmal etwas Unheimliches, und er vergegenwärtigte sich noch einmal den Augenblick vor wenigen Minuten, als er bei einem Blick in den Rückspiegel geglaubt hatte, eine menschliche Gestalt über die Piste huschen zu sehen, schemenhaft nur, verwackelt durch die holprige Fahrt und undeutlich im Staub, den der Landcruiser hinter sich aufwirbelte. Er hatte es als eine Täuschung abgetan, ein Tier vielleicht, ein großer Pavian. Doch jetzt, nachdem so kurz aufeinander erst der Tank leer und dann der Reifen geplatzt war, hatte er Verdacht geschöpft.
Seine Augen suchten die Umgebung nach verdächtigen Bewegungen ab, doch nicht ein Lufthauch bewegte die dürren Äste der Dornbüsche, kein Vogel kreiste in der Luft und auch die Paviane waren nicht mehr zu hören. Er kam sich vor wie auf einem ausgetrockneten Friedhof. Das Knirschen, als er sich in den Sand kniete, war das einzige Geräusch, und sein lang gezogener Schatten das Einzige, was sich bewegte. Alan suchte nach der Metallnase im Unterboden des Cruisers, um den Wagenheber anzusetzen. Er musste sich auf den Rücken legen und unter den Wagen robben, um sie zu finden. Für einige Sekunden schloss er die Augen, um sie an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann fand er mit der rechten Hand die Stelle und tastete mit der anderen ins Freie nach dem Wagenheber.
– Zsssssst –
Das Zischen unmittelbar neben seinem Ohr durchschnitt die Stille, und Alan hob erschrocken den Kopf. Die Bewegung war so heftig, dass er mit der Stirn gegen den rauen Unterboden stieß. Etwas glitt dicht neben seinem Kopf an seinem Körper entlang. Er hielt den Atem an und spürte, dass sein Herz wie ein Hammer gegen die Rippen schlug.
– Zsssssst –
Das Zischen wiederholte sich, zwar kürzer, aber dafür deutlicher als zuvor. Und irgendwie schien es aggressiver geworden zu sein.
Schon zum zweiten Mal war das Reptil gestört worden. Zuerst hatte der Feind es aus seinem Versteck unter dem Stein vertrieben, dann, als es seinen wechselwarmen geschmeidigen Schuppenkörper im Schatten des Wagens eingerollt hatte, nahm die auberginenfarbene, gespaltene Zunge den bedrohlichen Geruch erneut wahr. Das erste Zischen war als Warnung gedacht. Der Feind hatte sie missachtet. Das zweite Zischen war eine Gnade, die eigentlich keinem Opfer gewährt wurde; nur den mächtigen Feinden, vor denen es unter anderen Umständen die Flucht vorgezogen hätte. Doch dieser Feind war zu nah, eine Flucht nicht mehr möglich. Es blieb nur noch der Ausweg der Verteidigung.
Und während Alan sich seinen schmerzenden Kopf hielt und mit der anderen Hand nach dem Wagenheber tastete, zischte die Puffotter neben seinem Ohr zum dritten Mal.
– Zsssssst –