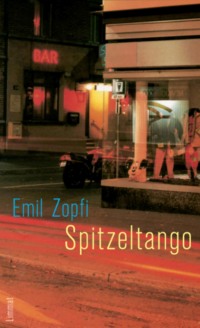Kitabı oku: «Spitzeltango», sayfa 2
Wie lange brauche ich schon, um
anzukommen,
wann bin ich losgegangen,
wie lange schon gehe ich,
seit wann gehe ich.
Er war losgegangen, vor langer Zeit. Irgendwohin, nirgendwohin. Er war amerikanischer Staatsbürger geworden, Professor für Deutsche Sprache und Literatur, eingeheiratet in eine wohlhabende Familie von Republikanern, Baptisten mit Verbindungen. Er war Vater und seit kurzem Grossvater.
«Schön, das Gedicht. Von wem ist es?»
«Ich erinnere mich nicht mehr. Wird mir aber schon wieder einfallen.»
Ariane kettete ihr Fahrrad vom Geländer los, schob es neben sich her, während sie das Limmatquai entlang gegen den See spazierten.

Pippo war im Lehnstuhl eingeschlafen. Es musste schon Tag sein, aus dem Fernseher quakte die Stimme der Wetterfröschin. Er tappte auf die Fernbedienung, bis sie verstummte und ihr verquetschtes Lächeln und das Tiefdruckgebiet aus seinem Gesichtsfeld verschwanden. Dass es regnete, sah er auch am Fenster, über das dicke Tropfen ihre Bahn zogen. Verschwommen nahm er die Autos auf der Schweighofstrasse wahr. Der Name der Strasse durchs Wohnquartier war ein Hohn. Früher hätte man Barrikaden errichtet, den Verkehr zum Schweigen gebracht. Aber nun? Die Jugend prügelte sich mit der Polizei nach Fussballspielen oder wenn es um eine illegale Bar ging, aber ohne politische Vision. Politik machten nur noch die Banker und Bonzen und ihre Handlanger von der Volkspartei, wie sie sich neuerdings nannte. Und unter diesem Namen das Volk verhöhnte und verarschte. Kapitalfaschisten regierten das Land.
Pippo tastete sich durch den Korridor, stolperte über Flaschen. Die Küchentür stand offen, ein Geruch schlug ihm entgegen, als verwese eine Maus unter dem Tisch. Wenn Alice diese Ordnung sehen würde, diesen «Zustand», wie sie sagte. Sie hatte immer peinlich geputzt, gefegt, gesaugt, geflickt, gebügelt. Ein anständiges Leben, er Tramführer bei den Verkehrsbetrieben, sie Krankenschwester im Triemlispital, Mitglied der Evangelischen Partei, Schulpflegerin, einmal kurz als Gemeinderätin nachgerutscht, sorgende Mutter, ein Kind. René war ihr Prinz gewesen.
Einmal hatte er seinen Sohn besucht nach ihrem Tod, in einem der modernen Wohnblocks mit den grossen Fenstern in Neu-Oerlikon. Ein gesichtsloser Bau, alles clean und leer. Die Möbel standen herum wie im Schaufenster, kein Stäubchen auf dem Parkett, keine Fliege, die an den Scheiben surrte. Alle paar Tage kam eine nigerianische Putzfrau, eine Illegale. Renés Freundin war eine magersüchtige Schaufensterpuppe mit einem dieser modischen Namen, Sabrina oder Samantha. Sie hatte ihn so leise dahingehaucht, dass er ihn nicht richtig verstand, und dann gleich wieder auf ihrem Handy herumgetippt. Bald hatte sie sich in Luft aufgelöst.
Hat die was gegen mich?, hatte er gefragt.
Schau dich doch an, hatte René gesagt. Kommst daher wie ein Penner. Wenn Mama dich sehen würde, mein Gott.
Ihr Gott, ja, hatte er ausgerufen. Euer Gott, aber nicht meiner.
Und noch was, Papa, tut mir leid, das zu sagen. Du stinkst. Du riechst nach Alkohol, nach Tabak, nach Pisse.
Und du stinkst nach Geld. Ein arrogantes Arschloch bist du geworden. Wenn Mama dich sehen würde, mein Gott, äffte er René nach, der aufstand, mit dem Kopf gegen die Tür wies.
Draussen hatte er das Schild am Briefkasten gesehen. «dr. rené a. schwyter infcon gmbh». Daneben den Namen der Sabrina oder Samantha von Soundso. Ein Unternehmer, ein Kleingewerbler und Möchtegern-Kapitalist, der nach Rasierwasser duftete, eine Rolex trug und adelige Schaufensterpuppen vögelte. Schon Alice hatte es aufgegeben, seine Beziehungen, wie er das nannte, zu zählen. Ihr Prinz durfte sich alles erlauben. Ihn, Pippo, hätte sie erwürgt, hätte sie von seinen Affären mit Kolleginnen erfahren. Vielleicht hatte sie ja alles gewusst, aber sie hatte geschwiegen, der Kirche und dem Frieden zuliebe.
Pippo angelte mit einem Fuss einen Schemel unter dem Küchentisch hervor, setzte sich, starrte auf die klebrigen Ringe von Flaschen und Gläsern, schob Brotkrümel mit einem Finger zu einem Häufchen.
Dann riss er sich zusammen, stand auf, schaltete die Kaffeemaschine ein. Er musste raus aus diesem Loch. Bald schon würde das Häuschen abgerissen, die Genossenschaft stellte gesichtslose Plattenbauten hin wie die Kapitalisten in Neu-Oerlikon auf dem Areal der einstigen Lokomotivenfabrik und der Waffenschmiede. Er hatte sich gegen den Abriss gewehrt, hatte Unterschriften gesammelt wie einst. Das heisst, er hatte es versucht. An jeder zweiten Tür hatte ihm eine Schwarze oder Braune oder Gelbe einen Spalt geöffnet, hatte ihn angelächelt und den Kopf geschüttelt. Nix verstehn, nix Interesse, nix Krach mit Verwaltung, weisst du. Er war kein Rassist, aber irgendwie war die Welt aus den Fugen. Nur der Schrebergarten war eine kleine Insel geblieben, aber auch dort regierten inzwischen Türken und Albaner. Die meisten waren ja anständige Kerle, arme Teufel, Strandgut der Globalisierung, der Politik des internationalen Kapitals.
Pippo sass auf dem Klo, als das Telefon schrillte. Rasch putzte er sich den Hintern, stolperte durch den Korridor, die Hosen als Fussfesseln auf den Pantoffeln.
«Hallo Pippo, hier Hermi.»
«Hermi?»
«Du erinnerst dich doch.»
Hermanns Stimme war nicht zu verwechseln, er krächzte wie ein erkälteter Rabe. «Was willst du?»
Hermann räusperte sich. «Martin Kunz ist tot.»
«Ich kann Zeitung lesen, Mann.»
«Es war kein Unfall.»
«Na und? Martin war besoffen.»
«Schlägertypen haben ihn verfolgt, heisst es.»
«Heldentod auf dem Velo. Passt doch für einen Grünen.»
«Hast du vergessen, was er für uns getan hat, Pippo?»
«Das war einmal. Ein windiger Opportunist ist er. Kommunist, Sozi, Grüner, was immer angesagt war.»
«Er hat uns verteidigt, damals. Hat sich für uns eingesetzt.»
«Für euch. Robert und dich hat er rausgehauen. Ich war im Knast, als einziger.»
«Er hat getan, was er konnte.»
«Damals vielleicht. Jetzt hockt er in der Baukommission auf seinem Arsch, zockt Sitzungsgeld und rührt keinen Finger gegen den Abriss von günstigen Wohnungen.»
«Er hat doch keinen Stich gegen die Bürgerlichen.»
«Also, warum rufst du an?»
«Heute ist eine Abdankungsfeier.»
«Ohne mich.»
«Du kannst es dir ja überlegen. Volkshaus, Blauer Saal, vierzehn Uhr.»
Pippo legte den Hörer hin, zog die Hosen hoch. Hörte Hermanns Stimme aus dem Hörer krächzen von Skandal, rechten Schlägerbanden, mit der Polizei und den Medien unter einer Decke.
Er packte den Hörer, legte auf. «Fahr zur Hölle!»
Dann ging er zurück zum Klo und spülte.

Hermann sass beim zweiten Frühstück, als es klingelte. Er öffnete die Tür einen Spalt bis zur Kette und hoffte, Carmen stehe im Treppenhaus, mit schwarzen Haaren bis auf die Schultern und dem Lächeln der Mona Lisa. Er löste die Kette, erkannte im trüben Licht Irina, die das Etablissement in den unteren Stockwerken führte. «Ist was?»
«Kann reinkommen? Bist auf?»
Eine Parfümwolke schlug ihm entgegen, Irina hielt ihm die Wange hin. Ihre Kleider rochen nach den Zigarillos, die sie von früh bis spät paffte. Sie war blondiert wie die meisten Damen ihres Salons, nur war sie erheblich fülliger. Es gab bestimmt Kunden, die solches Polster liebten. Sie behauptete zwar, sie organisiere den Laden nur, sie schaffe nicht an. «Manatschement» war ihr Lieblingswort.
«Komm rein. Kaffee?»
Sie setzte sich an den schmalen Tisch in der Küche, schlug die Beine übereinander, klemmte einen Glimmstengel zwischen die glossierten Lippen, wühlte im Täschchen nach dem Feuerzeug.
«Hier nicht rauchen», sagte Hermann. «Carmen hat das nicht gern. Die Decke ist nicht dicht, der Rauch dringt nach oben.»
«Carmen zurück?»
«Ich denke bald. Wir machen doch einen Film.»
Hermann mahlte Kaffee, stopfte den Espressokocher, setzte ihn aufs Gas. «Bringst du die Miete?»
«Später, später … Weisst du, viel Konkurrenz, zu viele Salons in der Stadt. Ich bezahle Mädchen gut, verdiene wenig.»
Sie nestelte in ihrer Handtasche und riss einen Nikotinkaugummi aus der Packung. «Gestern neue Mädchen angekommen. Aus Ungarn. Willst du kennenlernen?»
«Ich steh nicht auf blond, das weisst du doch.»
«Ein Mädchen blond, ein Mädchen schwarz.»
Der Kaffee blubberte im Kocher, Hermann schenkte ein. «Wie siehst du das mit der Miete? Ich bin blank, musst du wissen.»
Sie hielt die Tasse mit zwei Fingern. «Kam Frau vom Amt, macht Stress. Hygiene und so. Du neues Bad und wc einbauen, sonst Bewilligung weg.»
«Schon gut. Ich ruf mal an aufs Amt.»
Irinas Stimme hob sich, ihre Hand mit der Espressotasse zitterte. Kaffee fleckte auf ihre Bluse über dem mächtigen Busen. «Frau sagt, sonst Polizei Salon schliessen.»
Hermann setzte sich, schnitt sich ein Stück Brot ab, strich Butter drauf und Honig. Der Honig stammte von einem Biobauern aus dem Knonauer Amt, einem alten Genossen. Er liess Irina keifen, vernahm mehrmals ihr Lieblingswort: «Manatschment». Sie habe einen Hochschulabschuss in Tourismus gemacht in Minsk, Weissrussland. Tatsächlich war sie so was wie eine Tourismusfachfrau. Ihr Laden förderte Tourismus und Verkehr, die Branche leistete einen soliden Beitrag zu Zürichs Sozialprodukt und Steuersubstrat.
«Also, du telefonieren Amt und sprechen mit Frau dort.»
«Ja, ja, doch, ich kenne die Dame.» Hermann kaute bedächtig sein Honigbrot. «Und du denkst an die Miete, gell.»
Er leckte sich die Schnauzhaare, die ihm über die Mundwinkel hingen. Wenn das Gesundheitsamt neue Sanitäreinrichtungen verlangte, war Schluss mit dem Salon. Eine solche Investition konnte er sich nicht leisten. Die Grundlage seiner Existenz war in Gefahr. Wohnungen konnte er beim Zustand des Hauses höchstens noch an eine vergammelte WG vermieten, aber dann hatte er nur Stress. Der Salon war ein ruhiges Gewerbe. Keine Bank würde ihm die Hypothek aufstocken. Dabei hatte er das Haus von seinem Vater, dem redlichen Schuster Amberg, schuldenfrei geerbt. Mit Hypotheken hatte er seine Versuche als Schriftsteller und Filmemacher und die politische Arbeit finanziert. Doch weder der Kommunismus noch der Kapitalismus noch die Kultur hatten ihm Glück gebracht. Am Ende hatte er nur noch für die Grünen gestimmt, für Martin Kunz, der von schnellen Autos aufs Velo umgestiegen war und bei der Ökopartei Karriere machte. Der arme Martin fiel ihm wieder ein, in der Limmat ersoffen, der alte Genosse.
Irina beugte sich vor, Hermanns Blick fiel auf den Ansatz ihrer schweren Brüste. Sie trug einen dieser modischen kurzen Rüschenröcke mit freizügigem Oberteil.
«Du, ich muss an eine Abdankung. Können wir später weiterreden?»
«Was danken?»
«Trauerfeier. Genosse gestorben.»
«Genosse? Du Kommunist?»
«Es war einmal.»
Irina sah ihn mit glänzenden Augen an. Ihr Rock war über die Orangenhaut ihrer Oberschenkel hochgerutscht. Hermann stand auf, stellte das Geschirr zusammen. Er dachte an Carmen, an ihren schlanken Körper, der sich federleicht drehte, wenn er ihr beim Tango zuschaute. Sie würde im Film die Rolle ihres Lebens tanzen, eine Odyssee aus den Villas Miserias von Buneos Aires in die Schweiz. Der Tango kommt aus den Slums, nicht vom Parkett. Wenn man das nicht mehr sieht oder spürt, dann ist er tot, hatte die legendäre Tanguera Carmen Calderón gesagt. Es würde ein poetischer und politischer Film werden, weitab vom sozialistischen Realismus, den die Partei einst diktiert hatte. Doch seit ein paar Tagen war Carmen verschwunden.
«Ich Genossin, du weisst», liess sich Irina vernehmen. «Kommunistische Partei Belarus.»
«Dann komm doch mit. Ein paar alte Genossen sind bestimmt da. Vielleicht machen wir Revolution.»
Sie seufzte, stand auf, zog den Saum ihres Rocks straff. «Komm vorbei nach Trauerfeier. Neue Mädchen vorstellen.»
«Und die Miete kassieren, gell.»
Hermann trug das Geschirr zum Spültrog, putzte mit dem Lappen den Tisch, fing die Krümel mit der Hand auf wie einst Mutter. Sie hatte im Laden die Kunden bedient, während der Vater in der Werkstatt im Hof die Schuhe von Arbeitern und Einwanderern flickte. Der Schuhmacher hatte sich mit einem Leben ehrlicher Arbeit ein Haus zusammengespart, Nagel für Nagel. Ein geachteter Bürger war er gewesen, Mitglied der Bürgerpartei und Vorstand im Quartierverein. Gut, dass er nicht mehr erlebte, was aus seinem Sohn und Erben geworden war. Ein bankrotter Bordellvermieter und erfolgloser Filmemacher nach einer Karriere als Bummelstudent, Politaktivist, schreibender Arbeiter und unfähiger Sekretär der Kommunistischen Partei. Etwas muss sich ändern, dachte Hermann, und zwar schnell.

Roberts Rücken schmerzte, wenn er sich zu drehen versuchte. Er lag auf einem Sofa mit Lehne, das durchhing. Durch ein Fenster über ihm fiel schwaches Licht in den Raum. Wo war er nur? Er schloss die Augen, dachte angestrengt nach. Nichts. Er war noch nicht richtig wach. Strassenlärm drang herein, im Haus ging eine Klospülung.
Er öffnete die Augen, starrte zur Decke, wo sich Stukkaturen den Wänden entlang zogen, die Rosetten in den Ecken waren braun verfärbt, da und dort ein Stück Gips weggebrochen. Seine Füsse fühlten sich kalt an, die Zehenspitzen schauten unter einer Art Quilt hervor. Er war aus Stoffresten zusammengenäht, wie jene aus den Trödelläden in den Dörfern der Amischen im Süden von Iowa City. Marilyn hatte Berge solcher Quilts erstanden, sie stapelten sich gefaltet und eingemottet in einem Schrank ihres Hauses, gehörten zu all dem Plunder, der sich im Laufe der Jahre angesammelt hatte. Er lag nicht in seinem Bett zu Hause, das war ihm klar, dort roch es nach Zimt und Rosenöl, die Zimmerdecken und Wände waren aus Holz.
Allmählich ordneten sich seine Gedanken. Er war in der Schweiz, in Zürich. Am Vorabend angekommen ohne Koffer. Am Limmatquai hatte er eine junge Frau kennengelernt, sie hatte ihm eine Gelegenheit zum Übernachten angeboten. Zu Fuss hatten sie die Stadt durchquert, durch Strassen und Quartiere, die er nicht kannte. Er hatte den Schirm aufgespannt, sie ihr Velo neben sich her geschoben. Wie Vater und Tochter oder eher noch Grossvater und Enkelin. Bei jungen Frauen konnte er das Alter nur schwer schätzen. Sie hatten Brot und Käse gegessen und Wein getrunken in einer Küche, in der sich Geschirr im Spülstein türmte, hatten bis weit über Mitternacht geredet. Eine unerwartete Nähe und Vertrautheit war entstanden. Vergeblich versuchte er sich zu erinnern, was er von sich erzählt hatte, viel Persönliches wohl.
Ihr Name wollte ihm nicht einfallen. Wie er sich auch anstrengte, es fiel ihm nur immer wieder Lynn ein. So nannte Max Frisch die junge Frau in «Montauk», mit der er als über Sechzigjähriger auf Long Island eine Affäre gehabt hatte. Ein verregnetes melancholisches Wochenende. Roberts Vortrag drehte sich um Montauk und Frisch und sein Bild der usa, aber ohne sein Notebook brachte er den Inhalt nicht zusammen. Er stellte sich Max Frisch vor, den Alten mit der Pfeife zwischen den Zähnen, und neben ihm am Strand die amerikanische Verlagsangestellte. Sie nahm Züge der jungen Marilyn an. Die unbedarfte, offene und naive Amerikanerin. Frisch interessierte sich eigentlich nicht für sie, das Wochenende geriet im Roman zur literarischen Nabelschau. Frisch und die Frauen, Frisch und die Alpen, Frisch und die Schweiz, Frisch und Amerika.
Roberts Rücken schmerzte, er spürte ein Stechen in den Schläfen, vom Wein oder vom Jetlag. Der Quilt roch nach Zigarettenrauch, er selber nach dem Schweiss der Nacht, ungewaschen und unrasiert, wie er war. Er kannte das Leben in Wohngemeinschaften, die Nächte auf Sofas oder Matratzen am Boden. Die Nächte mit Freundinnen oder Zufallsbekannten, die am Morgen schon verschwunden und tags darauf vergessen waren. Vielleicht, so dachte er, habe ich in jener Zeit einer von ihnen ein Kind gemacht, und irgendwo auf der Welt läuft noch ein Sohn oder eine Tochter von mir herum. Aids hatte es noch nicht gegeben, aber schon die Pille. Nahm sie eine Frau nicht, so war sie selber schuld. Von der sogenannten sexuellen Revolution hatten vor allem die Männer profitiert.
Robert stemmte sich hoch, der Quilt rutschte zu Boden. Fischgratparkett, stellte er fest, ausgebleicht und zerkratzt. Er trat ans Fenster, das mit Vorfenstern ausgestattet war und Beschlägen aus Schmiedeisen. Es musste ein herrschaftliches Haus gewesen sein, das inzwischen heruntergekommen war. Gegenüber, in einer Zeile älterer Bauten, stand ein moderner Block mit schreiend roter Fassade und quadratischen Fenstern mit Lamellenstoren, die meisten von ihnen geschlossen. Wollishofen, vermutete er, obwohl er weder den See noch eine Tramlinie sehen konnte. Vielleicht Wiedikon. Eines der alten bürgerlichen Quartiere der Stadt. Den Gehsteig entlang parkten Autos in dichter Reihe. Der Asphalt der Strasse glänzte vor Nässe, es regnete noch immer.
Die Tür zum Raum, in dem er übernachtet hatte, führte in eine Diele. Der Boden knarrte, in einem Zimmer nebenan fehlte die Tür. Matratzen lagen am Boden, darauf türmte sich Bettzeug, ein Pandabär aus Plüsch hockte auf einer Kiste, Bücher stapelten sich auf einem Brettergestell. Auf einer Tischplatte auf Böcken standen ein Flachbildschirm, Laptop und Scanner, auf einem alten Taburett ein Drucker. Mehrere Leute wohnten in dem besetzten Haus, hatte die junge Frau erklärt. Ein Zufall hatte sie zusammengeführt, sein verlorener Koffer und der Tod des Martin Kunz, den sie beide gekannt hatten. Mit dem Velo war er verunglückt – oder in den Tod getrieben worden, wie sie überzeugt war. Sie studiere Politikwissenschaften und helfe bei den Grünen gelegentlich auf dem Sekretariat aus. Kunz, so erinnerte sich Robert, hatte sich gern mit schönen Frauen umgeben. Als Anwalt hatte er gut verdient, schnelle Autos gefahren. Dass er aufs Velo umgestiegen war, hatte sicher politische Gründe.
Hinter einer Tür mit Milchglasfenster bewegte sich eine Gestalt. Eine Frau im kurzen Bademantel trat in die Diele, die nassen Haare hingen ihr auf die Schultern. Um eines ihrer Beine wand sich eine tätowierte Schlange.
«Entschuldigen Sie, ich durfte hier übernachten.» Robert ertappte sich, dass er das Tattoo auf der weissen Haut ihres Oberschenkels anstarrte, der Kopf der Schlange verschwand unter dem Saum.
«Du bist der Typ, den Ariane angeschleppt hat.»
«Ariane, ja, Ariane.» Er erinnerte sich wieder an ihren Namen.
«Sie musste weg. In der Küche liegt ein Zettel. Du kannst dir Kaffee machen, wenn du willst.»
Die Frau, sehr knochig und bleich, liess ihn stehen, trat in ihr Zimmer zurück und warf die Tür zu. Er hörte sie telefonieren, zuerst in sanftem Ton, dann schrie sie in schrillen Satzfetzen und schluchzte.
Wieder überkam Robert das Gefühl, in einer andern Zeit angekommen zu sein. Jahre waren vergangen, er hatte zwei Leben gelebt, und nun? Vielleicht war es ein Angebot des Schicksals: Zwei Leben gehen dem Ende zu. Entscheide dich für eines davon. Oder beginne ein drittes. Wie Max Frisch, der immer wieder neu begonnen hatte, mit neuen Frauen, neuen Wohnungen, und sich doch nie festlegen konnte. Lynn, die in Wirklichkeit Alice Locke-Carey hiess, war nicht seine letzte Beziehung gewesen. Er hatte sich auch nie für ein Leben in seinem Loft in New York oder im Rustico im Onsernonetal entschieden, zwischen Wohnsitzen in Zürich oder Berlin. Ein früher Pendler der Globalisierung eigentlich. In Wunschträumen malte er sich ein amerikanisches Landhaus aus, nahe einem See, mit einer überdachten Veranda, von fünf hölzernen Säulen gestützt, weiss gestrichen. Es glich Roberts Haus in Iowa City.
Er sah sich in einem Spiegel einer vollgehängten Garderobe. Das faltige graue Gesicht, die hohe Stirn mit schütteren, nach hinten gekämmten Haaren, die schmale Oberlippe, die er hasste. Marilyn duldete keinen Schnurrbart. Ich will keinen Türken im Haus, sagte sie. Er griff sich ans Kinn, fühlte die Stoppeln und beschloss, einen Bart wachsen zu lassen. Er musste sich endlich durchsetzen in der bigotten Gesellschaft seiner Familie in jenem andern Leben, das ihm schon so fern erschien wie ein alter Schwarzweissfilm.
In der Küche roch es nach Angebranntem, Essigmücken tanzten über einer Früchteschale mit schrumpligen Äpfeln, Tomaten und schwarzen Bananen. Der Zettel lag daneben, darauf gekritzelt: «Robert! Nicht vergessen! Volkshaus, Blauer Saal, 14 Uhr!»
Er steckte ihn ein. Er musste weg. Fort aus dieser Wohnung, die sein Zeitgefühl durcheinanderbrachte. Er fand seine Jacke, das Futter war noch feucht. Die Holzstufen im Treppenhaus waren ausgetreten, dem Geländer fehlten einige der gedrechselten Stützen. Einen Stock tiefer blieb er stehen. Hatte er etwas vergessen?
Er kam sich nackt vor ohne Mappe oder Reisegepäck. Mit der Hand tastete er nach dem Smartphone, der Brieftasche, den Flugtickets und den Pässen. Alles war da. Auf Grund einer seltsamen Gewohnheit hatte er wie immer, wenn er ins Ausland reiste, beide Pässe eingesteckt, den amerikanischen und das alte rote Büchlein, das ihn als Schweizer Bürger auswies.
Nach einem Vordach führte eine kurze Steintreppe auf einen Kiesweg und durch einen verwilderten Garten und ein verrostetes Tor, das offen stand, auf die Strasse. Er sah zurück. Die Fassade der alten Villa war mit Graffiti besprayt. Ein grüner Drache mit Flügeln spie Feuer, ein Raumschiff auf himmelblauem Grund raste auf einen Regenbogen zu. Ein Transparent auf halber Höhe verkündete: Dieses Haus ist besetzt!
Der Schirm fiel ihm ein. Er stand aufgespannt neben dem Sofa, auf dem er die Nacht verbracht hatte, doch wollte er nicht mehr umkehren. Der Regen hatte nachgelassen. Längst hätte er sich nach seinem Koffer erkundigen müssen. In der Innentasche seiner Jacke fand er das Formular mit der Nummer. Er rief an, man verband ihn weiter. Sein Koffer war noch nicht aufgetaucht.
«Tut uns leid, wir werden der Sache nachgehen. Offenbar ist er in Frankfurt fehlgeleitet worden.» Es war eine andere Stimme als jene der Schwarzen mit den Zöpfchen.
Er schritt die Strasse hinab und weiter durch Quartiere, die er nicht kannte, bis er ein Café fand, in dem er frühstücken konnte.

Pippo drückte sich den Hut mit dem Schlapprand auf den Kopf, stieg in die Stiefel, stapfte ums Gartenhaus und holte aus dem Schuppen eine Schaufel. Er brauchte frische Luft und Bewegung. Handarbeit, Schweiss, Schwielen. Der Regen hatte nachgelassen, vom Zwetschgenbaum tropfte es. Die nassen Zweige, an denen ein paar gelbe Blätter hingen, glänzten silbrig im Licht, das durch tief liegende Wolken drang. Die Stadt lag unter einem Dunstschleier, von den Bürogebäuden in der Binz stieg Dampf auf. Lehmgruben gab es früher da unten, Ziegeleien, Industrien. Zu Zeiten, als man noch arbeitete, Produkte des täglichen Lebens herstellte. Ziegelsteine, aus denen Häuser gebaut wurden. Heute hockten die Angestellten in Krawatte und weissem Hemd vor Bildschirmen und jagten fiktives Kapital und abstrakte Informationen rund um die Welt. Aus der stolzen Klasse der Werktätigen war ein Heer von Entfremdeten geworden. Marx hatte das vorausgesehen, vor über hundert Jahren. Geld war das dem Menschen entfremdete Wesen seiner Arbeit.
Pippo zerrte die Eisenstange, die das Gitter des Kompostsammlers zusammenhielt, am Griff aus dem Boden, bog es auseinander. Der schwarze Plastiksack riss, er schlitzte ihn mit ein paar Schaufelschlägen ganz auf. Das Sammelgut quoll heraus, unten schon schwarz, oben noch voller Speisereste, Laub und Rasenschnitt. Eine Schicht durchsetzt von Kompostwürmern, durch andere frassen sich dicke weisse Maden. Mit der Schaufel stach er zu, wendete die Brocken, zerschlug sie, schichtete sie neben dem Sammler zu einem Haufen. Manchmal zerteilte er einen fetten Regenwurm, beide Enden krümmten sich im Dreck, lebten weiter. Er las Äste, Steine und Knochen heraus, warf sie in einen Kübel. Im Frühling würde der Haufen zu schwarzer Erde verrottet sein. Sauerstoff war wichtig, luftig musste er werden, mit einer Folie abgedeckt, sonst verfaulte der Kompost, verlor seine Kraft. Wie die Gesellschaft, dachte er jedesmal, wenn er am Kompost arbeitete. Umgraben, immer wieder, Luft hinein, das untere nach oben kehren. Die faulen Äpfel und Kürbisschalen von oben kommen zuunterst, Frass für Würmer und Maden. Im Frühling ist alles zu einer gleichförmigen, sozusagen klassenlosen Masse verrottet, was zuvor angefaulte Früchte, Gras, Laub und Speiseabfälle waren. Grundlage für neues Wachstum. Vielleicht musste Karl Marx als Kind im Garten seiner Eltern den Kompost umgraben und entwarf dabei seine Gesellschaftstheorie.
Pippo hielt inne, wischte sich mit dem Handrücken den Schweiss von der Stirn. Er bemerkte, dass er eine Melodie vor sich hingepfiffen hatte, während seine Gedanken ihre Spiralen zogen und seine Schaufel sich fast von selber in den Haufen bohrte. Selbst über den Kompost hatten sie gestritten. Alice verbot ihm, Orangen- und Zitronenschalen in den Sammler zu werfen, sie würden schlecht verrotten und die Erde übersäuern. Er war vom Gegenteil überzeugt. Die Schalen enthielten Abwehrstoffe, sie würden die Komposterde mit wertvollen Mineralien anreichern. Das hatte er gelesen oder gehört. Nur bei Bananenschalen fanden sie einen Kompromiss. Alice schnitt sie in kleine Stücke, so durfte er sie seinem Heiligtum übergeben. Er pfiff weiter, die Internationale. Die Worte wollten ihm nur Italienisch einfallen …
Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavorator …
Die Feste dell’Unità in Prato damals, rote Transparente, Parolen, endlose Reden von Funktionären, Tanz und Wein und Frauen mit schwarzen Locken und sinnlichen Lippen. Die Erinnerungen, die Illusionen und Träume. Pippo stützte sich auf die Schaufel, schloss die Augen, atmete schwer.
Eine Versammlung im Volkshaus kam ihm in den Sinn, um 1970 herum musste es gewesen sein. Die Genossen vom Zentralkomitee der Partei sassen vorn aufgereiht in grauen Konfektionsanzügen mit schief geknoteten roten Krawatten. Der Tisch rot bezogen, Sichel und Hammer und rote Sterne überall. Links von ihm sass Robert neben Sara. Vielleicht war auch Hermann im Publikum. Toni links aussen am Tisch der Funktionäre als Vertreter der revolutionären Studentenschaft war aufgestanden, hatte den Vorschlag gemacht, zum Abschluss des Plenums die Internationale zu singen. Die Genossen vom Zentralkomitee hatten die Köpfe zusammengesteckt, getuschelt, ob das Kampflied noch konform sei mit der aktuellen politischen Linie der sowjetischen Genossen. War das Lied nicht aus der Zweiten Internationale hervorgegangen, aus den Reihen von Revisionisten und Sozialdemokraten?
Während die führenden Genossen noch diskutierten, hatte Toni zu singen begonnen mit seinem falschen Bass, die Faust erhoben. Schliesslich hatten alle mitgesungen oder gesummt oder gepfiffen, ohne Inbrunst, den Text kannte niemand so richtig. Nur die eifrige Sara wusste alle Strophen auswendig.
Es war eine Demonstration gegen die Fossile im Zentralkomitee gewesen, bleiche Mumien mit Sichel und Hammer im Knopfloch wie die Genossen im Kreml. Man hatte Toni nach dieser Rebellion als Vertreter der Studentenschaft aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen. Daraufhin hatten sie eine klandestine Gruppe gebildet, die Revolutionäre Zelle Zürich. Toni, Pippo, Hermann, Robert, Sara und ein paar andere.
Pippo breitete die Folie über den Komposthaufen, beschwerte sie mit Steinen. Er hatte Durst bekommen, und der Regen hatte wieder eingesetzt.

Wie immer, wenn er in die grosse Leere stürzte, setzte sich Hermann an seinen Computer und begann im Internet zu surfen. Er hatte Carmen im Tangoclub gefilmt und einige Clips auf Youtube hochgeladen. War sie auf Kurve, dann waren da noch immer die Videos und füllten das emotionale Vakuum. Das Netz hob alle Zeit und jede Distanz auf, machte die Menschen unsterblich. Auch seine Carmencita.
Eines Tages war sie vor der Tür gestanden mit einer Hängetasche und High Heels. Er hatte gedacht, ah, eine Neue von Irina. Hat sich im Stockwerk geirrt. Stellt sie wieder Frauen aus der Karibik ein?
Irrtum. Carmen sprach leidlich Mundart, sie war eine Sans-Papier, lebte schon seit langem illegal im Land. Was sie in all der Zeit gemacht hatte, blieb rätselhaft, so wie ihre Vergangenheit und ihr Alter. Sie erzählte mal dies, mal das, sah manchmal wie achtzehn aus und manchmal wie achtunddreissig. Ursprünglich stammte sie aus Buenos Aires und konnte tanzen. Ein ausserordentliches Talent, sagten sie im Club Argentino.
Doch nun war sie weg. Nicht das erste Mal, aber bei jedem ihrer Ausflüge packte ihn die Angst, sie sei in eine Kontrolle geraten und ausgeschafft worden. Heirate mich doch, hatte er ihr einmal vorgeschlagen, dann hast du kein Problem mehr.
Ich bin schon verheiratet. Sie hielt ihm einen Ring unter die Nase, das wars dann gewesen. Kein Wort, wer ihr Ehemann war, wenn es überhaupt einen gab, ob sie Kinder hatte, wer ihre Eltern waren. Nur tanzen, tanzen. Sie hatte ihn in den Club mitgeschleppt, hatte ihm die Grundschritte beigebracht, hatte ihn mit Tänzerinnen verkuppelt, die keine Partner hatten. So war die Idee zum Film entstanden. Die Geschichte eines Strassenkindes aus den Villas Miserias, das zur Tangokönigin der Stadt avanciert, mit Carmen in der Hauptrolle. Dokumentarisch, aber auch eine Art Musical. Viel Tanz, viel Lichteffekte, viel Musik. Milonga, Tango, Vals, Piazzolla, die ganze Palette. Und Tango Canción, Lieder von Carlos Gardel natürlich. Hermanns künstlerisches Vorbild war Fernando Solanas, sein Film «Tangos – El Exilio de Gardel». Das Exil der Tangokünstler zur Zeit der argentinischen Militärdiktatur, als Gardels Songs verboten waren, der Tango geächtet.
Hermann schaltete die Videosequenz auf, die ihm am besten gefiel. Carmen dreht sich in einer Serie von Boleos in den Armen von Roberto, dem Tanzlehrermacho. Er setzt seine spitzen Schuhe präzis, millimetergenau neben ihre High Heels, sie schmiegt sich mit leicht vorgeneigtem Oberkörper an seine Brust und dreht sich leicht wie eine Schneeflocke im Wirbelsturm. Zurück und vor, zurück und vor, ihre Schenkel schnellen hoch, ihre Schuhspitzen tippen aufs Parkett. In Buenos Aires gab es wohl keinen Schnee, doch Hermann fand keinen besseren Vergleich für ihre Leichtigkeit. Vielleicht war sie jetzt in ihrer Heimatstadt, ausgeschafft oder zurückgekehrt, verzehrt von Sehnsucht nach ihrer Welt, ihrer Familie, von der sie nie etwas erzählte. Wahrscheinlich hatte sie gar keine, war ein Strassenkind ohne Eltern, herumgeschubst und missbraucht von düsteren Machos und Mafiosi. Den Menschenhändlern entronnen, und er war ihr Retter. Ihre Vergangenheit war Hermann egal, er betete sie an, er dachte an sie, wenn er im Bett lag und mit der Hand über die Falten seines alten Bauches fuhr.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.