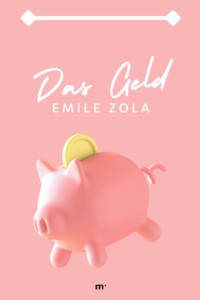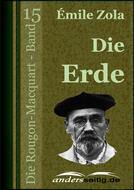Kitabı oku: «Das Geld», sayfa 4
»Die Börse?« fragte Saccard. »Ja, natürlich sehe ich sie!«
»Nun gut! Es wäre dumm, sie in die Luft zu sprengen, weil man sie woanders wieder aufbauen würde ... Allein ich sage Ihnen voraus, daß sie von selber in die Luft fliegen wird, wenn der Staat sie enteignet hat, wenn sie logischerweise die einzige, universale Bank der Nation geworden ist, und dann dient sie vielleicht – wer kann es wissen? – als öffentlicher Speicher für unsere zu großen Reichtümer, als eine jener Kornkammern, in denen unsere Enkel die üppige Fülle für ihre Festtage finden werden!«
Mit einer weit ausholenden Gebärde erschloß Sigismond diese Zukunft eines allgemeinen Glücks für alle. Und er hatte sich derart in Begeisterung geredet, daß ihn ein neuerlicher Hustenanfall schüttelte. Er war an seinen Tisch zurückgekehrt, stemmte die Ellbogen zwischen seine Papiere und stützte den Kopf in die Hände, um das peinigende Röcheln aus seiner Brust zu ersticken. Aber diesmal gelang es ihm nicht. Plötzlich öffnete sich die Tür, und Busch, der die Méchain verabschiedet hatte, eilte mit bestürzter Miene herbei, als litte er selbst an diesem abscheulichen Husten. Sogleich beugte er sich über seinen Bruder, nahm ihn in seine großen Arme wie ein Kind, dessen Schmerz man einlullt.
»Aber, aber, mein Kleiner, was hast du bloß, daß du bald erstickst? Du weißt, ich will, daß du einen Arzt kommen läßt. Das ist doch unvernünftig ... Du hast bestimmt zuviel geschwatzt.«
Und er warf einen schiefen Blick auf Saccard, der mitten im Zimmer stehengeblieben war, sichtlich aufgewühlt von dem, was er soeben aus dem Munde dieses leidenschaftlichen, kranken großen Teufels vernommen hatte, welcher hier oben von seinem Fenster aus mit seinem Gerede, alles hinwegzufegen, um alles wieder aufzubauen, einen Zauberspruch über die Börse murmelte.
»Danke, ich lasse Sie nun allein«, sagte der Besucher und hatte es eilig, nach draußen zu kommen. »Schicken Sie mir meinen Brief mit den zehn Zeilen der Übersetzung ... Ich erwarte noch mehr, wir regeln dann das Ganze zusammen.«
Aber da der Anfall vorüber war, hielt ihn Busch noch einen Augenblick zurück.
»Ach ja, was ich noch sagen wollte, die Dame, die eben hier war, kennt Sie von früher. Oh, es ist schon lange her.«
»Ach! Woher denn?«
»Rue de la Harpe, 1852.«
Sosehr Saccard auch Herr seiner selbst war, er wurde doch blaß. Ein nervöses Zucken verzog ihm den Mund. Zwar erinnerte er sich in dieser Minute keineswegs an das junge Ding, das er auf der Treppe umgelegt hatte. Er wußte nicht einmal, daß sie schwanger geworden war, und er wußte auch nichts von der Existenz des Kindes. Aber die Erinnerung an die elenden Jahre seines Anfangs war ihm immer noch sehr unangenehm.
»Rue de la Harpe. Oh, dort habe ich nach meiner Ankunft in Paris bloß acht Tage gewohnt, gerade die Zeit, um eine Wohnung zu suchen ... Auf Wiedersehen!«
»Auf Wiedersehen!« sagte Busch mit Nachdruck; er sah in dieser Verwirrung irrtümlicherweise ein Geständnis und grübelte schon, wie er das Abenteuer am besten ausschlachten könnte.
Wieder auf der Straße, kehrte Saccard mechanisch auf den Platz vor der Börse zurück. Er zitterte noch am ganzen Leib, und er schaute nicht einmal auf die kleine Frau Conin, deren hübscher Blondkopf lächelnd in der Tür der Papierwarenhandlung zu sehen war. Auf dem Platz hatte die Unruhe zugenommen, der Aufruhr des Börsenspiels tobte mit der entfesselten Gewalt einer Sturmflut gegen die Bürgersteige, die von Leuten wimmelten. Das war das Gebrüll von Viertel vor drei, die Schlacht der letzten Kurse, das rasende Verlangen, zu erfahren, wer mit vollen Händen nach Hause gehen würde. Als er gegenüber der Vorhalle an der Ecke der Rue de la Bourse stand, glaubte er in dem wirren Gedränge unter den Säulen den Baissier38 Moser und den Haussier Pillerault zu erkennen, die sich beide in den Haaren lagen. Und er vermeinte auch, aus dem Hintergrund des großen Saales die helle Stimme des Wechselmaklers Mazaud zu vernehmen, die für Augenblicke die gellenden Rufe Nathansohns übertönte, der unter der Uhr bei der Kulisse saß. Aber ein Wagen, der scharf am Rinnstein entlangfuhr, hätte ihn beinahe bespritzt. Massias sprang heraus, noch ehe der Kutscher angehalten hatte, war mit einem Satz die Stufen hinauf und brachte atemlos die letzte Order eines Kunden.
Saccard stand immer noch reglos, die Augen auf das Durcheinander da oben geheftet, und käute sein Leben wieder; die Erinnerung an seinen Anfang, die Buschs Frage wieder wachgerufen hatte, peinigte ihn. Er entsann sich der Rue de la Harpe, dann der Rue Saint-Jacques, durch die er auf seinen Eroberungszügen eines Glücksritters seine schiefgelaufenen Stiefel geschleift hatte, er erinnerte sich des Tages, da er in Paris gelandet war, um es sich zu unterwerfen, und von neuem packte ihn die Wut bei dem Gedanken, daß er es sich immer noch nicht unterworfen hatte, daß er erneut auf der Straße lag, unbefriedigt dem Glück auflauerte; ein solcher Hunger nach Genuß quälte ihn, und noch nie hatte er so darunter gelitten. Dieser Narr von Sigismond sagte ganz richtig: Von der Arbeit kann man nicht leben, allein die Elenden und die Dummköpfe arbeiten, um die anderen zu mästen. Es gab nur das Börsenspiel, das Spiel, durch das man auf einen Schlag von heute auf morgen zu Wohlstand, zu Luxus, zum großen Leben, zum Leben überhaupt kommt. Wenn diese alte Gesellschaft eines Tages aus den Fugen ging, sollte ein Mann wie er nicht noch die Zeit und den Platz finden, seine Begierden vor dem Zusammenbruch zu befriedigen?
Aber da stieß ihn ein Fußgänger an, der sich nicht einmal umdrehte, um sich zu entschuldigen. Er erkannte Gundermann, der seinen kleinen Gesundheitsspaziergang machte; Saccard sah ihn bei einem Konditor eintreten, von dem dieser König des Goldes seinen Enkelinnen manchmal eine Schachtel Bonbons für einen Franc mitbrachte. Und in dieser Minute, bei dem Fieber, das in ihm brannte, seitdem er so die Börse umkreiste, wirkte dieser Stoß mit dem Ellbogen wie ein Peitschenhieb, war er der letzte Anstoß, der seinen Entschluß festigte. Er hatte den Platz eingekreist, nun würde er zum Sturmangriff übergehen. Das war der Schwur eines gnadenlosen Kampfes: er würde Frankreich nicht verlassen, er würde seinem Bruder die Stirn bieten und das Spiel mit dem höchsten Einsatz, eine Schlacht von schrecklicher Kühnheit wagen, bei der er Paris die Fersen auf den Nacken setzen würde oder mit gebrochenem Hals in der Gosse liegen bliebe.
Bis Börsenschluß blieb Saccard hartnäckig auf seinem Droh- und Beobachtungsposten stehen. Er sah zu, wie sich die Vorhalle leerte, wie sich die Stufen mit all diesen langsam davongehenden, erhitzten und müden Leuten bedeckten. Um ihn herum dauerte das Verkehrschaos auf dem Pflaster und den Bürgersteigen an, riß der Strom der Leute nicht ab, der ewigen Menge, die es auszubeuten galt, der Aktionäre von morgen, die an dieser großen Lotterie der Spekulation nicht vorbeigehen konnten, ohne den Kopf zu wenden aus Furcht vor dem, was hier geschah, und zugleich in dem Verlangen, in das Geheimnis dieser Finanzoperationen einzudringen, das um so verlockender für die französischen Geister war, als nur sehr wenige von ihnen es zu ergründen vermochten.
Zweites Kapitel
Als Saccard nach seinem letzten, unseligen Grundstücksgeschäft sein Palais am Parc Monceau aufgeben und seinen Gläubigem überlassen mußte, um eine größere Katastrophe abzuwenden, hatte er zunächst den Gedanken, sich zu seinem Sohn Maxime zu flüchten. Dieser bewohnte seit dem Tode seiner Frau, die auf einem kleinen Friedhof in der Lombardei ruhte, ganz allein ein Haus in der Avenue de lʼImpératrice, wo er sich sein Leben mit einem klugen und unbändigen Egoismus eingerichtet hatte; als ein Bursche von schwächlicher Gesundheit, durch das Laster frühzeitig gereift, verzehrte er dort in untadeliger Haltung das Vermögen der Toten. Er schlug es seinem Vater rundweg ab, ihn bei sich aufzunehmen, damit alle beide weiter in gutem Einvernehmen leben könnten, wie er mit verschmitzter Miene lächelnd erklärte.
Seitdem dachte Saccard an eine andere Zuflucht. Er wollte schon ein kleines Haus in Passy mieten, das bürgerliche Heim eines Händlers, der sich zurückgezogen hatte, da fiel ihm ein, daß das Erdgeschoß und das erste Stockwerk des Palais dʼOrviedo in der Rue Saint-Lazare noch immer nicht vermietet waren, denn Türen und Fenster waren verschlossen. Die Fürstin dʼOrviedo bewohnte seit dem Tode ihres Mannes drei Zimmer im zweiten Stock und hatte nicht einmal an der grasüberwucherten Toreinfahrt ein Schild anbringen lassen. Am anderen Ende der Vorderfront führte eine niedrige Tür über einen Dienstbotenaufgang in das zweite Stockwerk. Und oft hatte er sich bei den geschäftlichen Besuchen, die er der Fürstin abstattete, über die Nachlässigkeit gewundert, die sie an den Tag legte, wenn es darum ging, einen angemessenen Nutzen aus ihrem Grundstück zu ziehen. Aber sie schüttelte den Kopf, sie hatte in Geldfragen ihre eigenen Vorstellungen. Dennoch willigte sie sofort ein, als er bei ihr vorsprach, um auf seinen Namen zu mieten, und überließ ihm für eine lächerliche Miete von zehntausend Francs die fürstlich eingerichteten prachtvollen Räume im Erdgeschoß und ersten Stockwerk, die sicherlich das Doppelte wert waren.
Alle Welt sprach noch von dem Prunk, den der Fürst dʼOrviedo zur Schau gestellt hatte. Als er aus Spanien gekommen und in Paris inmitten eines Millionenregens gelandet war, hatte er in der fiebrigen Hast seines ungeheuren finanziellen Glücks zunächst einmal dieses Palais gekauft und restaurieren lassen, bis er nach seiner Erwartung die Welt mit einem Palast aus Gold und Marmor in Erstaunen setzen könnte. Das Bauwerk stammte aus dem vorigen Jahrhundert, eines jener Lusthäuser, wie sie galante Herren inmitten weitläufiger Gärten errichten ließen; aber es war teilweise abgerissen und in strengeren Proportionen wiederaufgebaut worden und hatte so von seinem einstigen Park nur einen breiten Hof bewahrt, den Ställe und Remisen säumten und der durch die geplante Rue du Cardinal-Fesch bestimmt bald ganz verschwinden würde. Der Fürst hatte dieses Haus aus der Erbschaft eines Fräulein Saint-Germain erworben, deren Grundbesitz sich einst bis zur Rue des Trois- Frères erstreckte, der früheren Verlängerung der Rue Taitbout. Übrigens hatte das Palais seinen Eingang in der Rue Saint-Lazare behalten, neben einem großen Gebäude aus der gleichen Zeit, der einstigen Folie- Beauvilliers, das die Beauvilliers infolge eines langsamen Ruins noch bewohnten; und diesen gehörte ein Rest des herrlichen Gartens mit prächtigen Bäumen, die bei der nahe bevorstehenden baulichen Veränderung des Viertels ebenfalls zum Verschwinden verurteilt waren.
Trotz eines völligen Bankrotts schleppte Saccard einen Troß von Dienstboten hinter sich her, die Trümmer seines allzu zahlreichen Personals, einen Kammerdiener, einen Küchenchef und dessen Frau, die für die Wäsche zu sorgen hatte, eine weitere Frau, die Gott weiß warum geblieben war, einen Kutscher und zwei Stallburschen; er belegte die Pferdeställe und Remisen mit Beschlag, brachte dort zwei Pferde und drei Wagen unter und richtete im Erdgeschoß einen Speiseraum für seine Leute ein. Er war der Mann, der, obwohl er keine fünfhundert Francs bares Geld in seiner Kasse hatte, auf großem Fuße lebte, als hätte er zwei- oder dreihunderttausend Francs im Jahr. So nahm es nicht wunder, daß er mit seiner Person die weitläufigen Zimmerfluchten im ersten Stockwerk ausfüllte, die drei Salons, die fünf Schlafzimmer, ganz zu schweigen von dem riesigen Speisesaal, wo man eine Tafel für fünfzig Gedecke aufstellen konnte. Dort öffnete sich früher eine Tür auf eine Innentreppe, die in das zweite Stockwerk führte, in einen anderen, kleineren Speisesaal; als die Fürstin vor kurzem diesen Teil des zweiten Stocks an einen Ingenieur, Herrn Hamelin, vermietete, einen Junggesellen, der mit seiner Schwester zusammen wohnte, hatte sie die Tür einfach durch zwei starke Schrauben verschließen lassen. Sie teilte sich so mit diesem Mieter in den ehemaligen Dienstbotenaufgang, während Saccard allein die große Freitreppe benutzte. Er möblierte einige Zimmer teilweise mit den Resten seiner Einrichtung vom Parc Monceau, ließ die anderen leer, und trotzdem gelang es ihm, diesen Zimmerfluchten mit ihrem traurigen, kahlen Mauerwerk, von dem eine eigensinnige Hand nach dem Tode des Fürsten sogar die letzten Tapetenfetzen abgerissen zu haben schien, Leben zurückzugeben. Und er konnte von neuem seinen Traum von einem großen Vermögen beginnen.
Die Fürstin dʼOrviedo war damals eine der seltsamsten Erscheinungen von Paris. Vor fünfzehn Jahren hatte sie sich darein geschickt, den Fürsten, den sie überhaupt nicht liebte, zu heiraten, um einem ausdrücklichen Befehl ihrer Mutter, der Herzogin de Combeville, zu gehorchen. Zu jener Zeit stand dieses junge Mädchen von zwanzig Jahren im Rufe großer Schönheit und Klugheit, sie war sehr fromm und ein wenig zu ernst, obwohl sie die Gesellschaft leidenschaftlich liebte. Sie wußte nichts von den sonderbaren Geschichten, die über den Fürsten im Umlauf waren, von den Ursprüngen seines königlichen Vermögens, das auf dreihundert Millionen geschätzt wurde, von einem ganzen Leben fürchterlicher Räubereien, die er nicht mehr im Dunkel des Waldes ausgeführt hatte, mit bewaffneter Hand wie die adligen Abenteurer von einst, sondern als untadeliger moderner Bandit im hellen Sonnenlicht der Börse, in den Taschen der leichtgläubigen armen Leute, inmitten von Zusammenbruch und Tod. In Spanien und hier in Frankreich hatte sich der Fürst zwanzig Jahre lang seinen Löwenanteil an allen großen Schurkereien geholt, die zur Legende geworden sind. Obwohl die Fürstin nichts von dem Schmutz und dem Blut ahnte, aus dem er so viele Millionen zusammengerafft, hatte sie bei ihrer ersten Begegnung einen Widerwillen empfunden, den nicht einmal ihre Frömmigkeit überwinden konnte; und bald gesellte sich zu dieser Abneigung ein dumpfer, wachsender Groll, kein Kind aus dieser Ehe zu haben, die sie aus Gehorsam auf sich genommen hatte. Die Mutterschaft hätte ihr genügt, sie liebte Kinder über alles, und es kam so weit, daß sie diesen Mann haßte, weil er nicht einmal die Mutter in ihr befriedigen konnte, nachdem er die Liebende zur Verzweiflung gebracht hatte. Zu diesem Zeitpunkt stürzte sich die Fürstin in einen unerhörten Luxus, sie blendete Paris mit dem Glanz ihrer Feste und führte ein verschwenderisches großes Haus, das die Tuilerien39, wie es hieß, mit Eifersucht erfüllte. Dann plötzlich, am Tag nach dem Tode des Fürsten, den ein Schlaganfall niedergestreckt hatte, versank das Palais in der Rue Saint-Lazare in vollkommene Stille und völlige Finsternis. Kein Licht mehr, kein Lärm mehr, die Türen und die Fenster blieben geschlossen; es verbreitete sich das Gerücht, die Fürstin habe das Erdgeschoß und das erste Stockwerk kurzerhand ausgeräumt und sich wie eine Einsiedlerin in drei kleine Zimmer des zweiten Stockes zurückgezogen, mit einem ehemaligen Stubenmädchen ihrer Mutter, der alten Sophie, die sie aufgezogen hatte. Als sie wieder auftauchte, trug sie ein einfaches schwarzes Wollkleid; das Haar unter einem Spitzentuch verborgen, war sie noch genauso klein und rundlich mit ihrer schmalen Stirn, ihrem hübschen runden Gesicht und den Perlenzähnen zwischen den zusammengepreßten Lippen; aber sie hatte schon den gelben Teint, das stumme, einem einzigen Willen ergebene Gesicht einer seit langem im Kloster eingesperrten Nonne. Sie war erst dreißig Jahre alt und lebte seitdem nur noch für die großen Werke der Barmherzigkeit.
In Paris war die Überraschung groß, und es gingen allerlei merkwürdige Geschichten um. Die Fürstin hatte das gesamte Vermögen geerbt, die berühmten dreihundert Millionen, mit denen sich sogar der Lokalteil der Zeitungen befaßte. Und es bildete sich schließlich eine romantische Legende heraus. Ein Mann, ein schwarz gekleideter Unbekannter, so hieß es, war eines Abends, als die Fürstin zu Bett gehen wollte, plötzlich in ihrem Zimmer erschienen, ohne daß sie je erfuhr, durch welche Geheimtür er hatte eintreten können. Was dieser Mann ihr gesagt hat, weiß niemand auf der Welt, aber er muß ihr wohl den abscheulichen Ursprung der dreihundert Millionen enthüllt und ihr vielleicht den Schwur abverlangt haben, so viele Ungerechtigkeiten wiedergutzumachen, wenn sie schreckliche Katastrophen vermeiden wolle. Dann war der Mann verschwunden. Seit fünf Jahren war sie nun Witwe, aber gehorchte sie tatsächlich einem Befehl aus dem Jenseits, oder hatte sich einfach ihr Anstandsgefühl empört, als sie die Akte ihres Vermögens in die Hand bekam? Die Wahrheit war, daß sie nur noch in einem brennenden Fieber des Verzichts und der Wiedergutmachung lebte. Bei dieser Frau, die keine Liebende gewesen war und die nicht hatte Mutter sein können, entfalteten sich alle verdrängten Zärtlichkeiten, vor allem die verkümmerte Liebe zum Kind, zu einer echten Leidenschaft für die Armen, Schwachen, Enterbten, Leidenden, für all jene, deren gestohlene Millionen sie zu besitzen glaubte und denen sie in einem Almosenregen alles königlich zurückerstatten wollte. Seitdem bemächtigte sich ihrer eine fixe Idee, der Nagel der Besessenheit drang ihr in den Schädel: sie betrachtete sich nur noch als einen Bankier, bei dem die Armen dreihundert Millionen hinterlegt hatten, damit sie zu ihrem Besten verwendet würden; sie war nur noch ein Buchhalter, ein Geschäftsführer, der in Zahlen lebte inmitten eines Völkchens von Notaren, Arbeitern und Architekten. Außerhalb hatte sie ein richtiges großes Büro mit etwa zwanzig Angestellten eingerichtet. Zu Hause, in ihren drei engen Zimmern, empfing sie nur vier oder fünf Vermittler, ihre Leutnants; hier verbrachte sie die Tage an einem Schreibtisch wie der Direktor eines Großunternehmens, in klösterlicher Abgeschiedenheit, fern von aufdringlichen Besuchern, in einem Wust von Papieren, der sie überschwemmte. Ihr Traum war, alle Nöte zu erleichtern, die des Kindes, welches leidet, weil es geboren wurde, wie auch die des Greises, der nicht sterben kann, ohne zu leiden. Während dieser fünf Jahre, da sie das Gold mit vollen Händen hinauswarf, hatte sie in La Villette die Kinderkrippe Sainte-Marie gegründet, ein großes, helles Gebäude mit weißen Wiegen für die ganz Kleinen und blauen Betten für die Größeren, in dem schon dreihundert Kinder untergebracht waren; das Waisenhaus Saint-Joseph in Saint-Mandé, wo hundert Knaben und hundert Mädchen so erzogen und ausgebildet wurden wie in den bürgerlichen Familien; schließlich für fünfzig Männer und fünfzig Frauen ein Altersheim in Châtillon und in einem Vorort das Krankenhaus Saint-Marceau mit zweihundert Betten, dessen Säle gerade erst eingeweiht worden waren. Aber ihr Lieblingswerk, das in diesem Augenblick ihr ganzes Herz in Anspruch nahm, war das »Werk der Arbeit«, ihre ureigenste Schöpfung, ein Haus, das die Erziehungsanstalt ersetzen sollte: dreihundert Kinder, hundertfünfzig Mädchen und hundertfünfzig Knaben, die auf dem Pariser Pflaster in der Ausschweifung und im Verbrechen gelebt hatten, wurden hier durch gute Behandlung und die Erlernung eines Berufes auf den rechten Weg gebracht. Diese verschiedenen Gründungen, beträchtliche Schenkungen und eine verrückte Verschwendungssucht der Barmherzigkeit hatten in fünf Jahren nahezu hundert Millionen verschlungen. Noch ein paar Jahre so weiter, und die Fürstin war ruiniert, ohne sich selbst die kleine Rente für Brot und Milch, ihre tägliche Nahrung, gesichert zu haben. Wenn ihre alte Amme Sophie einmal ihr ständiges Schweigen unterbrach, sie mit harten Worten schalt und ihr voraussagte, sie würde noch einmal am Bettelstab enden, hatte sie dafür nur ein schwaches Lächeln, das einzige, das hinfort auf ihren farblosen Lippen erschien, ein göttliches Lächeln der Hoffnung.
Durch ebenjenes »Werk der Arbeit« machte Saccard die Bekanntschaft der Fürstin dʼOrviedo. Er war einer der Eigentümer des Geländes, das sie dafür aufkaufte, eines alten, mit schönen Bäumen bestandenen Gartens, der an den Park von Neuilly angrenzte und sich längs des Boulevard Bineau hinzog. Er hatte sie durch die lebhafte Art, mit der er bei den Geschäften verhandelte, für sich eingenommen, und sie wollte ihn wegen einiger Schwierigkeiten mit den Bauunternehmern wiedersehen. Er selbst hatte sich für die Arbeiten interessiert, seine Phantasie war gefesselt und bezaubert von dem großartigen Plan, den sie dem Architekten aufzwang: zwei monumentale Flügel – der eine für die Knaben, der andere für die Mädchen –, die untereinander durch ein Hauptgebäude verbunden waren, das die Kapelle, die Gemeinschaftsräume, die Verwaltung und alle Diensträume enthielt; jeder Flügel hatte seinen riesigen Hof, seine Werkstätten, seine Nebengebäude aller Art. Doch bei seiner eigenen Vorliebe für das Große und Pomphafte begeisterte ihn vor allem der Luxus, der hier entfaltet wurde: die Größe des Bauwerks, aus einem Material errichtet, das die Jahrhunderte überdauern würde; der verschwendete Marmor, die mit Fayencefliesen ausgekleidete Küche, in der man einen Ochsen hätte braten können, die riesigen, mit Eichenholz getäfelten Speisesäle, die lichtüberfluteten, hell gestrichenen Schlafräume, die Wäscherei, der Baderaum, die mit allen nur erdenklichen Raffinements ausgestattete Krankenstation; und überall breite Nebenausgänge, Treppen, Flure, die im Sommer belüftet und im Winter beheizt wurden; das ganze Haus war in Sonnenschein getaucht und kündete von jugendlicher Fröhlichkeit und dem Wohlbehagen eines großen Vermögens. Als der Architekt, der diese ganze Herrlichkeit unnütz fand, unruhig wurde und von den Ausgaben sprach, schnitt ihm die Fürstin das Wort ab: sie habe den Luxus gehabt und wolle ihn nun den Armen geben, damit sie, die den Luxus der Reichen schaffen, ihn ihrerseits genießen sollten. Ihre fixe Idee bestand in dem Traum, die Elenden mit Wohltaten zu überhäufen, sie in die Betten der Glücklichen dieser Welt zu legen, sie an ihre Tafel zu setzen; nicht mehr das Almosen einer Brotkruste, eines elenden Nachtlagers sollte es sein, sondern das großzügige Leben in Palästen, in denen sie sich zu Hause fühlen, in denen sie sich rächen und die Genüsse von Siegern auskosten konnten. Nur wurde sie bei dieser Verschwendung und den extrem hohen Kostenanschlägen abscheulich bestohlen. Ein Schwarm von Unternehmern lebte von ihr, ganz zu schweigen von den Verlusten, die durch mangelhafte Aufsicht verursacht wurden. Man vergeudete das Gut der Armen. Und Saccard öffnete ihr die Augen, als er sie bat, ihn die Abrechnungen überprüfen zu lassen, was er übrigens völlig uneigennützig tat, einzig um des Vergnügens willen, diesen tollen Tanz der Millionen zu regeln, der ihn begeisterte. Nie hatte er sich so peinlich korrekt gezeigt. Er war in diesem komplizierten Riesengeschäft der wendigste und rechtschaffenste Mitarbeiter, der seine Zeit und sogar sein Geld hingab und einfach nur durch die Freude belohnt wurde, daß diese beträchtlichen Summen durch seine Finger gingen. Im »Werk der Arbeit« kannte man fast nur ihn; die Fürstin ließ sich dort nie sehen, wie sie auch ihre anderen Gründungen nicht besuchte; gleich der unsichtbaren guten Fee blieb sie in der Tiefe ihrer drei kleinen Zimmer verborgen. Er aber, der Angebetete, wurde dort gesegnet und mit der ganzen Dankbarkeit überhäuft, die sie abzulehnen schien.
Zweifellos trug sich Saccard seit jener Zeit mit einem vagen Plan, der jetzt, da er als Mieter im Palais dʼOrviedo wohnte, eine klare und deutliche Wunschvorstellung geworden war. Warum sollte er sich nicht ganz der Verwaltung der guten Werke der Fürstin widmen? In der Stunde des Zweifels, die er durchlebte, als er von der Spekulation besiegt war und nicht wußte, wie er wieder reich werden könnte, erschien ihm das als eine neue Inkarnation, als ein plötzlicher Aufstieg zur Gottheit: der Verteiler dieser königlichen Barmherzigkeit werden, diesen Goldstrom lenken, der sich über Paris ergoß. Die Fürstin hatte noch zweihundert Millionen – wieviel Werke konnte man da noch schaffen, was für eine Stadt des Wunders aus dem Boden stampfen! Ganz davon zu schweigen, daß er diese Millionen Früchte tragen lassen, sie verdoppeln, verdreifachen würde, sie so gut zu verwenden wüßte, daß er eine Welt daraus gewinnen konnte. In seiner leidenschaftlichen Vorstellung wurde alles noch größer, er lebte nur noch in dem berauschenden Gedanken, die Millionen als Almosen ohne Ende auszuteilen, das glückliche Frankreich mit ihnen zu überschwemmen, und er wurde gerührt bei dem Gedanken an seine vollkommene Rechtschaffenheit, denn nicht ein Sou sollte in seinen Fingern bleiben. Und dieser Gedanke wuchs sich in seinem Kopf zur Vision von einem riesigen Idyll aus, dem Idyll eines Mannes, den kein schlechtes Gewissen drückte, nicht der leiseste Wunsch, sich von seinen alten Geldräubereien loszukaufen. Um so mehr, als am Ende der Traum seines ganzen Lebens winkte, die Eroberung von Paris. Der König der Barmherzigkeit, der von der Menge der Armen angebetete Gott sein, einzigartig und volkstümlich werden, daß sich die Welt mit ihm beschäftigte – das überstieg noch seinen Ehrgeiz. Was für Wunder würde er vollbringen, wenn er seine Fähigkeiten als Geschäftsmann, seine Hinterlist, seinen Eigensinn, seinen völligen Mangel an Vorurteilen darauf verwandte, gut zu sein! Und er besäße die unwiderstehliche Kraft, die die Schlachten gewinnt, das Geld, Truhen voll Geld – Geld, das oft soviel Böses schafft und das soviel Gutes schaffen könnte an dem Tage, da man seinen Stolz und sein Vergnügen dafür einsetzte!
Dann erweiterte Saccard seinen Plan noch und fragte sich schließlich, warum er die Fürstin dʼOrviedo nicht heiraten sollte. Das würde die Verhältnisse klären und die bösen Auslegungen verhindern. Einen Monat lang ging er geschickt und listig zu Werke, legte prächtige Pläne dar, glaubte sich unentbehrlich zu machen; und eines Tages brachte er mit ruhiger, unbefangener Stimme seinen Vorschlag vor und entwickelte sein großes Vorhaben. Er bot eine richtige Partnerschaft an, er würde den Liquidator der vom Fürsten gestohlenen Summen abgeben und sich verpflichten, sie verzehnfacht den Armen zurückzuerstatten. Die Fürstin, in ihrem ewigen schwarzen Kleid, ihr Spitzentuch auf dem Kopf, hörte ihm aufmerksam zu, ohne daß auch nur eine Gemütsregung ihr gelbes Gesicht belebte. Sie war sehr betroffen von den Vorteilen, die eine solche Partnerschaft haben könnte, im übrigen aber waren ihr die anderen Erwägungen gleichgültig. Nachdem sie ihre Antwort auf den nächsten Tag verschoben hatte, lehnte sie schließlich ab. Zweifellos hatte sie bedacht, daß sie dann nicht mehr allein Herrin über ihre Almosen wäre, und sie legte Wert darauf, als unumschränkte Herrscherin darüber zu verfügen, selbst auf verrückte Weise. Aber sie erklärte, sie würde sich glücklich schätzen, ihn als Ratgeber zu behalten, und gab zu erkennen, für wie wertvoll sie seine Mitarbeit erachtete, indem sie ihn bat, sich weiterhin mit dem »Werk der Arbeit« zu beschäftigen, dessen eigentlicher Direktor er war.
Eine ganze Woche lang empfand Saccard heftigen Kummer, wie beim Verlust eines liebgewordenen Gedankens. Nicht, daß er sich in den Schlund der Räubereien zurückfallen sah; aber so, wie eine gefühlvolle Romanze den verworfensten Trunkenbolden Tränen in die Augen treibt, hatte dieses riesige Idyll von den Millionen, die soviel Gutes schufen, seine alte Freibeuterseele weich gestimmt. Er stürzte wieder einmal, und aus sehr großer Höhe: es schien ihm, als wäre er entthront worden. Mit Hilfe des Geldes hatte er neben der Befriedigung seiner Begierden immer zugleich die Herrlichkeit eines fürstlichen Lebens angestrebt, das er nie in dem gewünschten Maße hatte führen können. Seine Raserei nahm mit jedem Sturz, der wieder eine Hoffnung zunichte machte, zu. Daher wurde er in eine wütende Kampflust zurückgeworfen, als sein Vorhaben angesichts der ruhigen und deutlichen Weigerung der Fürstin zusammenbrach. Sich schlagen, in dem harten Krieg der Spekulation der Stärkste sein, die anderen fressen, um nicht selbst gefressen zu werden, das war neben seiner Gier nach Glanz und Genuß die wesentliche, die einzige Ursache seiner Leidenschaft für die Geschäfte. Wenn er auch keine Schätze anhäufte, so hatte er doch die andere Freude: den Kampf der hohen Zahlen, die Vermögen, die wie Armeekorps in die Schlacht geführt wurden, den Zusammenprall der streitenden Millionen mit den Niederlagen und mit den Siegen, die ihn berauschten. Und sogleich kam wieder der Haß auf Gundermann, sein zügelloses Bedürfnis nach Revanche zum Vorschein: Gundermann zu Boden werfen, dieses wahnwitzige Begehren quälte ihn, sooft er besiegt am Boden lag. Wenn er auch spürte, wie kindisch ein solcher Versuch war – konnte er Gundermann nicht wenigstens anschlagen, sich einen Platz neben ihm erobern, ihn zur Teilung zwingen, wie es die einander ebenbürtigen Monarchen aus benachbarten Ländern tun, die sich mit »Vetter« anreden? Damals zog ihn erneut die Börse an, und er hatte den Kopf voller Geschäfte, die er starten wollte; er wurde von den widersprüchlichsten Plänen hin und her gerissen mit einer solchen fiebrigen Hast, daß er sich einfach nicht entscheiden konnte bis zu dem Tage, da sich eine alle Maße übersteigende, ungewöhnliche Idee aus allen anderen herauslöste und sich seiner nach und nach ganz bemächtigte.
Seitdem Saccard im Palais dʼOrviedo wohnte, sah er bisweilen die Schwester des Ingenieurs Hamelin, der die kleine Wohnung im zweiten Stock innehatte, eine Frau von bewundernswertem Wuchs, Frau Caroline, wie man sie vertraulich nannte. Was ihn bei der ersten Begegnung vor allem betroffen gemacht hatte, war das prachtvolle weiße Haar, eine Königskrone aus weißen Haaren, die über der Stirn dieser noch jungen, kaum sechsunddreißigjährigen Frau so eigentümlich wirkten. Schon mit fünfundzwanzig Jahren war sie ganz weiß geworden. Die schwarz gebliebenen, sehr dichten Brauen bewahrten dem hermelinumrahmten Gesicht einen seltsamen Reiz von lebhafter Jugendlichkeit. Mit ihrem zu starken Kinn, der etwas zu großen Nase und dem breiten Mund, dessen volle Lippen sehr viel Güte verrieten, war sie nie eigentlich hübsch gewesen. Wohl aber milderte dieses weiße Vlies, dieser wehende Schnee aus feinen, seidigen Haaren ihren ein wenig harten Gesichtsausdruck und verlieh ihr den lächelnden Zauber einer Großmutter in der Frische und der Kraft einer schönen Geliebten. Sie war groß und kräftig und hatte einen freimütigen, sehr edlen Gang.