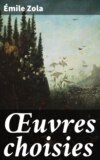Kitabı oku: «Der Bauch von Paris: mehrbuch-Weltliteratur», sayfa 4
Kapitel II
Florent hatte gerade mit dem Jurastudium in Paris begonnen, als seine Mutter starb. Sie wohnte in Le Vigan im Departement12 Gard. In zweiter Ehe hatte sie einen Mann aus der Normandie, einen gewissen Quenu aus Yvetot, geheiratet, den ein Unterpräfekt13 mitgebracht und in Südfrankreich vergessen hatte. Er hatte seine Anstellung bei der Unterpräfektur behalten, fand das Land reizend, den Wein gut und die Frauen liebenswert. Drei Jahre nach seiner Heirat raffte ihn ein Magenleiden dahin. Als einzige Erbschaft hinterließ er seiner Frau einen kräftigen Jungen, der ihm ähnelte. Der Mutter fiel es schon sehr schwer, das Schulgeld für ihren Ältesten, für Florent, das Kind aus erster Ehe, aufzubringen. Er bereitete ihr große Freude: er war sehr sanft, arbeitete eifrig und bekam die besten Zensuren. All ihre Liebe, all ihre Hoffnungen setzte sie auf ihn. Vielleicht gab sie in diesem blassen und schmächtigen Jungen ihrem ersten Mann den Vorzug, einem jener Provenzalen von weichem, liebkosendem Wesen, der sie sterblich geliebt hatte. Vielleicht hatte sich Quenu, dessen Gutmütigkeit es ihr anfänglich angetan hatte, als zu träge, zu zufrieden herausgestellt, als zu überzeugt, seine besten Freuden aus sich selber zu holen. Es blieb für sie ausgemacht, daß aus ihrem letzten Sohn, dem jüngsten, den die Familien im Süden oft noch zum Priester bestimmen, niemals etwas Rechtes werden würde; sie begnügte sich damit, ihn zu einer alten Jungfer, ihrer Nachbarin, in die Schule zu schicken, wo der Kleine kaum etwas anderes lernte als sich herumzutreiben. Die beiden Brüder wuchsen also fern voneinander auf wie Fremde.
Als Florent in Le Vigan ankam, war seine Mutter bereits beerdigt. Sie hatte verlangt, daß man ihm ihre Krankheit bis zum letzten Augenblick verheimlichte, um ihn in seinem Studium nicht zu stören. Er fand den kleinen zwölf Jahre alten Quenu ganz allein mitten in der Küche vor, wo er auf einem Tisch saß und schluchzte. Ein Möbelhändler, ein Nachbar, berichtete ihm vom Todeskampf seiner unglücklichen Mutter. Sie hatte ihr Letztes hingegeben und sich totgearbeitet, damit ihr Sohn Jura studieren konnte. Zu dem kleinen Handel mit Bändern, der wenig einbrachte, hatte sie noch andere Arbeiten übernehmen müssen, die sie bis spät in die Nacht festhielten. Die fixe Idee, ihren Sohn als gutgestellten Advokaten in der Stadt zu sehen, machte sie schließlich hart und geizig und unerbittlich gegen sich selbst und andere. Der kleine Quenu lief in zerrissenen Hosen und Kitteln mit ausgefransten Ärmeln herum; niemals nahm er sich selber etwas vom Tisch, sondern wartete, bis ihm die Mutter sein Stück Brot abschnitt. Sie schnitt sich selber ganz genauso dünne Scheiben zu. Dieser Lebensweise war sie erlegen in der ungeheuren Verzweiflung, ihre Aufgabe nicht erfüllt zu haben.
Diese Erzählung machte auf Florents zartes Gemüt einen schrecklichen Eindruck. Tränen erstickten ihn. Er schloß den Bruder in seine Arme, preßte ihn an sich, küßte ihn, um ihm die Liebe wiederzugeben, die er ihm geraubt hatte. Und er betrachtete die armen geplatzten Schuhe, die durchgescheuerten Ellbogen, die schmutzigen Hände, dieses ganze Elend eines ausgesetzten Kindes. Er sagte ihm immer wieder, daß er ihn mitnehmen würde, daß er es gut bei ihm haben solle. Als er am nächsten Tag die Lage überprüfte, bekam er Angst, nicht einmal die zur Rückreise nach Paris erforderliche Summe zu behalten. Um keinen Preis wollte er in Le Vigan bleiben. Er wurde den kleinen Bänderladen glücklich los. Und das ermöglichte ihm, die Schulden zu bezahlen, die zu machen seine in Geldfragen so genaue Mutter sich nach und nach hatte hinreißen lassen. Und da ihm nichts blieb, bot ihm der Möbelhändler, der Nachbar, fünfhundert Francs für den Hausrat und die Wäsche der Verstorbenen. Er machte ein gutes Geschäft. Der junge Mann dankte ihm mit Tränen in den Augen. Dann kleidete er seinen kleinen Bruder neu ein und nahm ihn am gleichen Abend mit.
In Paris konnte von einer Fortsetzung des Jurastudiums keine Rede mehr sein. Allen Ehrgeiz verschob Florent auf später. Er fand Gelegenheit, ein paar Stunden zu geben, und richtete sich mit Quenu in der Rue RoyerCollard an der Ecke der Rue SaintJacques in einer großen Stube ein, die er mit zwei eisernen Betten, einem Schrank, einem Tisch und vier Stühlen möblierte. Von nun an hatte er ein Kind. Seine Vaterschaft entzückte ihn. In der ersten Zeit versuchte er, am Abend, wenn er nach Hause kam, dem Kleinen Unterricht zu geben, aber der hörte kaum zu. Er hatte einen harten Schädel, weigerte sich zu lernen und sehnte sich schluchzend nach der Zeit zurück, da ihn seine Mutter auf den Straßen herumlaufen ließ. Verzweifelt brach Florent den Unterricht ab, tröstete ihn und versprach ihm immerwährende Ferien. Und um seine Schwäche vor sich selber zu entschuldigen, sagte er sich, daß er das liebe Kind nicht zu sich genommen habe, um es zu ärgern. Es wurde zur Richtschnur seines Verhaltens, zuzusehen, wie er in Freude aufwuchs. Er betete ihn an, war von seinem Lachen entzückt und genoß die unendliche Süßigkeit, ihn gesund und völlig sorglos um sich zu haben. Florent blieb in seiner abgetragenen schwarzen Kleidung hager und schmächtig, und bei den Verdrießlichkeiten des Stundengebens begann sein Gesicht gelb zu werden. Quenu wurde ein kleiner kugelrunder gutmütiger Kerl, der ein bißchen beschränkt war und kaum lesen und schreiben konnte, aber über eine unverwüstliche gute Laune verfügte und mit seinem Frohsinn die große dunkle Stube in der Rue RoyerCollard erfüllte.
Indessen vergingen die Jahre. Florent, der die Aufopferungsfähigkeit der Mutter geerbt hatte, behielt Quenu wie eine große erwachsene arbeitsscheue Tochter bei sich. Er ließ ihn nicht einmal die kleinsten Haushaltsbesorgungen verrichten; er war derjenige, der einkaufen ging, den Haushalt und die Küche besorgte. Das lenke ihn von seinen griesgrämigen Gedanken ab, sagte er. Gewöhnlich war er finster und hielt sich für schlecht. Wenn er am Abend schmutzbespritzt und vom Widerwillen der fremden Kinder gedemütigt nach Hause kam, war er ganz gerührt über die Umarmung des großen dicken Jungen, den er auf dem Fliesenfußboden der Stube Kreisel spielend antraf. Quenu lachte über die Ungeschicklichkeit seines Bruders beim Eierkuchenbacken oder über den Ernst, mit dem er die Gemüsesuppe zubereitete. Wenn dann die Lampe ausgelöscht war, wurde Florent manchmal traurig in seinem Bett. Er dachte daran, sein Jurastudium wiederaufzunehmen, und zerbrach sich den Kopf, seine Zeit so einzuteilen, daß er den Vorlesungen an der Universität folgen könnte. Es gelang ihm, und er war vollkommen glücklich. Aber ein leichtes Fieber, das ihn acht Tage zu Hause festhielt, riß ein solches Loch in ihren Geldbeutel und beunruhigte ihn so sehr, daß er nunmehr jeden Gedanken, sein Studium zu beenden, aufgab. Sein Kind wuchs heran. Er wurde Lehrer in einem Pensionat in der Rue de l'Estrapade mit einem Gehalt von achtzehnhundert Francs. Das war ein Vermögen. Wenn er sparsam war, konnte er Geld beiseite legen, um Quenu zu versorgen. Mit achtzehn Jahren behandelte er ihn immer noch wie eine Tochter, die eine Aussteuer erhalten muß.
Während der kurzen Krankheit seines Bruders hatte auch Quenu Betrachtungen angestellt. Eines Morgens erklärte er, er wolle arbeiten, er sei groß genug, sein Brot zu verdienen. Florent war tief gerührt. Ihnen gegenüber hatte auf der anderen Seite der Straße ein Uhrmacher seine Werkstatt, den Quenu während des ganzen Tages in der grellen Helligkeit des Fensters sah, wie er, über seinen kleinen Tisch gebeugt, mit ganz kleinen Gegenständen hantierte und sie geduldig mit der Lupe betrachtete. Das lockte ihn und er behauptete, Lust zum Uhrmacherhandwerk zu haben. Aber nach vierzehn Tagen war es mit seiner Ausdauer zu Ende. Er weinte wie ein Kind von zehn Jahren, weil er das zu kompliziert fand und er sich niemals in »all den dämlichen kleinen Dingen, die in eine Uhr hineingehören«, auskennen würde. Er wollte jetzt lieber Schlosser werden. Aber die Schlosserarbeit strengte ihn zu sehr an. Im Laufe von zwei Jahren versuchte er sich in mehr als zehn Berufen. Florent fand, er habe recht, man solle keinen Beruf ergreifen, der einem zuwider ist. Nur kam die schöne Aufopferungsfreudigkeit Quenus, der sein Brot selber verdienen wollte, dem Haushalt der beiden jungen Männer teuer zu stehen. Seitdem er von einer Werkstatt zur anderen lief, gab es unaufhörlich neue Ausgaben: Geld für Kleidung, für außer Hause eingenommene Mahlzeiten, für den Einstand bei den Kollegen. Florents achtzehnhundert Francs reichten nicht mehr. Er hatte noch zwei Unterrichtsstunden hinzunehmen müssen, die er am Abend gab. Acht Jahre lang trug er denselben Überzieher.
Die beiden Brüder hatten einen Freund gefunden. Eine Front des Hauses ging zur Rue SaintJacques, und dort lag eine große Bratküche, die einem würdigen Mann namens Gavard gehörte, dessen Frau inmitten des fetten Geflügelduftes an Schwindsucht dahinsiechte. Wenn Florent zu spät nach Hause kam, um noch ein Stück Fleisch kochen zu können, kaufte er unten ein Stück Pute oder Gans für zwölf Sous. Das waren dann Festtagsschmausereien. Gavard nahm schließlich Anteil an diesem hageren Burschen; er erfuhr seine Geschichte und zog den Kleinen zu sich heran. Und bald verließ Quenu die Bratküche überhaupt nicht mehr. Sobald sein Bruder fortging, kam er herunter und machte es sich hinten im Laden vor den hohen hellen Flammen bequem, entzückt von den vier riesigen Bratspießen, die sich mit lieblichem Geräusch drehten.
Die großen Kupfergeschirre am Kamin glänzten. Das Geflügel dampfte. Das Fett sang in der flachen Pfanne unter den Bratspießen, die schließlich miteinander zu plaudern und freundliche Worte an Quenu zu richten begannen, der einen langen Löffel in der Hand hielt und hingegeben die goldigen Bäuche der rundlichen Gänse und der großen Puten begoß. Stundenlang blieb er dort, ganz rot von den tanzenden Lichtern des lodernden Feuers, ein wenig benommen, unbestimmt den großen Tieren, die da brieten, zulächelnd, und er erwachte erst, wenn der Braten vom Spieß genommen wurde. Das Geflügel fiel in die Schüsseln. Die Spieße wurden aus den über und über dampfenden Bäuchen gezogen; die Bäuche entleerten sich, ließen aus den Löchern am Steiß und aus der Gurgel den Saft herauslaufen und erfüllten den Laden mit kräftigem Bratenduft. Der Junge stand dabei, verfolgte mit den Augen diesen Vorgang, klatschte in die Hände, sprach zu dem Geflügel und sagte ihm, daß es gut sei, daß es aufgegessen werde und daß die Katzen nur die Knochen bekämen. Und er fuhr zusammen, wenn ihm Gavard eine Scheibe Brot gab, die er eine halbe Stunde lang in der flachen Pfanne unter dem Bratspieß schmoren ließ.
Zweifellos überkam Quenu hier die Liebe zur Küche. Später, als er alle anderen Berufe versucht hatte, kehrte er schicksalhaft zu den Tieren, die vom Bratspieß genommen werden, zurück, zu den Bratensäften, die einen zwingen, sich die Finger zu lecken. Er befürchtete zuerst, damit seinen Bruder zu ärgern, der wenig aß und von guten Dingen mit der Geringschätzung des Unwissenden sprach. Als er dann sah, wie ihm Florent zuhörte, wenn er ihm irgendein sehr kompliziertes Gericht erklärte, gestand er ihm seine Neigung und begann in einem großen Restaurant zu arbeiten. Von nun an war das Leben der beiden Brüder geregelt. Sie wohnten weiterhin in der großen Stube in der Rue RoyerCollard, wo sie sich an jedem Abend zusammenfanden, der eine mit von seinen Bratöfen erquicktem Gesicht, der andere mit dem vom Elend des schmutzbespritzten Lehrers geprägten Antlitz. Florent behielt seinen schwarzen Überrock an und vertiefte sich in die Hausaufgaben seiner Schüler, während Quenu, um es sich bequem zu machen, seine Schürze, seine weiße Jacke und seine weiße Küchenjungenmütze wieder vornahm, um den Ofen herumstrich und zu seinem Vergnügen irgendeinen Leckerbissen briet. Und manchmal lächelten sie, wenn sie sich so sahen, der eine ganz in Weiß, der andere ganz in Schwarz. Der große Raum schien zur Hälfte verdrießlich und zur Hälfte vergnügt über diese Betrübnis und diese Heiterkeit. Niemals hat sich ein ungleiches Paar besser verstanden. Der ältere mochte ruhig abmagern, verbrannt von den Begierden seines Vaters, der jüngere mochte als würdiger Sohn des Mannes aus der Normandie ruhig Fett ansetzen, sie liebten einander in ihrer gemeinsamen Mutter, in jener Frau, die nichts als zärtliche Liebe gewesen war.
Sie hatten in Paris einen Verwandten, einen Bruder ihrer Mutter, einen gewissen Gradelle, der sich in der Gegend der Markthallen in der Rue Pirouette als Fleischer niedergelassen hatte. Er war ein grober Geizkragen, ein roher Kerl, der sie wie Hungerleider behandelte, als sie ihn zum ersten Mal aufsuchten. Sie kamen selten zu ihm. Zum Namenstag des guten Mannes brachte ihm Quenu einen Blumenstrauß und erhielt dafür ein Zehnsousstück. Florent fühlte sich in seinem krankhaften Stolz verletzt, wenn Gradelle mit dem unruhigen und argwöhnischen Blick eines Geizhalses, der eine Bitte um ein Mittagessen oder um hundert Sous wittert, seinen Überzieher musterte. Aber eines Tages hatte Florent, ohne sich etwas dabei zu denken, einen Hundertfrancsschein bei ihm gewechselt. Der Onkel bekam nun weniger Angst, wenn er die Kleinen, wie er sie nannte, kommen sah. Aber weiter ging die Freundschaft auch nicht.
Diese Jahre waren für Florent ein langer süßer und trauriger Traum. Er kostete alle bitteren Freuden des Aufopferns aus. Zu Hause war nichts als zärtliche Liebe. Draußen, in den Demütigungen durch seine Schüler, in den Anrempeleien auf den Bürgersteigen, spürte er, wie er böse wurde. Sein getöteter Ehrgeiz verbitterte ihn. Langer Monate bedurfte es, bis er sich duckte und die Leiden eines häßlichen, mittelmäßigen und armseligen Menschen hinnahm. Um den Versuchungen, bösartig zu werden, zu entgehen, warf er sich auf ideale Güte; er schuf sich eine Zuflucht von unbedingter Gerechtigkeit und Wahrheit. Deshalb wurde er damals Republikaner; er fand zur Republik, wie verzweifelte Mädchen ins Kloster finden. Und da er keine Republik entdeckte, die lässig und still genug war, sein Leid einzuschläfern, schuf er sich eine. Die Bücher mißfielen ihm; all das geschwärzte Papier, in dem er lebte, erinnerte ihn an seine stinkende Klasse, an die Papierkugeln der Lausejungen, an die Marter der langen fruchtlosen Stunden. Außerdem erzählten ihm die Bücher nur von Auflehnung und trieben ihn zum Hochmut, während er das gebieterische Verlangen nach Vergessen und Frieden in sich spürte. Sich einwiegen, sich einlullen, träumen, daß er vollkommen glücklich sei, daß die Welt es bald werde, und das republikanische Gemeinwesen schaffen, in dem er hätte leben wollen – dies war seine Erholung, das Werk, das er ewig in seinen freien Stunden wiederaufnahm. Er las nichts mehr außer dem, was er für den Unterricht benötigte. Er ging die Rue SaintJacques bis zu den äußeren Boulevards hinauf, machte mitunter einen weiten Weg und kam über die Barrière d'Italie zurück; und während des ganzen Spaziergangs ruhten seine Augen auf dem Quartier Mouffetard, das sich zu seinen Füßen ausbreitete, und erwog er moralische Maßnahmen, humanitäre Gesetzesentwürfe, die diese Stadt des Leidens in eine Stadt der Glückseligkeit verwandelt hätten. Als die Februartage14 Paris mit Blut besudelten, zerriß es ihm das Herz. Er lief in die Clubs und verlangte, man solle dieses Blutvergießen wiedergutmachen durch den »Bruderkuß der Republikaner der ganzen Welt«. Er wurde einer jener erleuchteten Redner, die die Revolution wie eine neue Religion der Milde und Erlösung predigten. Es bedurfte der Dezembertage, um ihn aus seiner weltumspannenden Liebe zu reißen. Er war entwaffnet. Er ließ sich fangen wie ein Schaf und wurde behandelt wie ein Wolf. Als er aus seinem Gerede von Brüderlichkeit erwachte, verreckte er fast vor Hunger auf den kalten Fliesen einer Kasematte von Bicêtre.
Quenu, der damals zweiundzwanzig Jahre alt war, überfiel Todesangst, als er seinen Bruder nicht mehr nach Hause kommen sah. Am darauffolgenden Tage ging er ihn auf dem MontmartreFriedhof unter den Toten vom Boulevard suchen, die man auf Stroh nebeneinandergelegt hatte. Grauenhafte Köpfe zogen vorüber. Das Herz stand ihm still, vor Tränen konnte er nichts sehen, und zweimal mußte er die Reihe entlanggehen. Schließlich erfuhr er nach acht langen Tagen auf der Polizeipräfektur, daß sein Bruder gefangen sei. Er durfte ihn nicht sehen. Als er nicht abließ, drohte man ihm, ihn selber zu verhaften. Da lief er zu Onkel Gradelle, der für ihn eine Persönlichkeit war, und hoffte, ihn zu veranlassen, Florent zu retten. Aber Onkel Gradelle brauste auf und behauptete, ihm sei ganz recht geschehen, dieser große Dummkopf habe sich nicht mit diesem Lumpenpack von Republikanern einzulassen brauchen; er fügte sogar hinzu, Florent müsse ein schlimmes Ende nehmen, das sei ihm im Gesicht geschrieben. Quenu weinte sich alle Tränen aus dem Leib. Halb erstickt blieb er da. Der Onkel, der sich ein wenig schämte und fühlte, daß er für den armen Jungen etwas tun müsse, bot ihm an, ihn zu sich zu nehmen. Er wußte, daß Quenu ein guter Koch war, und er brauchte einen Gehilfen. Quenu hatte eine solche Angst, allein in die große Stube in der Rue RoyerCollard zurückzukehren, daß er annahm. Er schlief noch am selben Abend bei seinem Onkel, ganz oben, hinten in einem schwarzen Loch, in dem er sich kaum ausstrecken konnte. Dort weinte er weniger, als er beim Anblick des leeren Bettes seines Bruders geweint hätte.
Endlich gelang es ihm, Florent zu sehen. Als er aber von Bicêtre zurückkam, mußte er sich hinlegen; ein Fieber hielt ihn wochenlang in stumpfer Schlaftrunkenheit. Es war seine erste und seine einzige Krankheit. Gradelle wünschte seinen republikanischen Neffen zu allen Teufeln. Als er eines Morgens von seinem Abtransport nach Cayenne erfuhr, gab er Quenu einen Klaps auf die Hände, weckte ihn, verkündete ihm brutal diese Neuigkeit und rief dadurch bei dem jungen Mann einen solchen Schock hervor, daß er am nächsten Tag wieder auf den Beinen war. Sein Schmerz zerschmolz, sein weiches Fleisch schien die letzten Tränen getrunken zu haben. Als er einen Monat später das erste Mal wieder lachte, zürnte er sich und war ganz traurig, gelacht zu haben; dann riß ihn sein Frohsinn fort, und er lachte, ohne es zu wissen. Er erlernte das Fleischerhandwerk, an dem er noch mehr Gefallen fand als an der Kochkunst. Aber Onkel Gradelle ermahnte ihn, seine Kasserollen nicht zu sehr zu vernachlässigen, denn ein Fleischer, der gut kochen könne, sei selten, und es sei ein Glück, daß er in einem Restaurant tätig gewesen sei, bevor er bei ihm zu arbeiten begann. Übrigens machte sich der Onkel Quenus Begabungen zunutze: er ließ ihn Diners für die Stadt zubereiten und übertrug ihm besonders Rostbraten und Schweinekoteletts mit Pfeffergurken. Da ihm der junge Mann wirkliche Dienste leistete, liebte er ihn auf seine Weise, kniff ihn auch in die Arme, wenn er guter Laune war. Das armselige Mobiliar aus der Rue RoyerCollard hatte er verkauft und den Erlös, einige vierzig Francs, an sich genommen, damit dieser Hanswurst Quenu, wie er sich ausdrückte, das Geld nicht zum Fenster hinauswerfe. Aber schließlich bewilligte er ihm doch jeden Monat sechs Francs für kleine Vergnügungen.
Quenu, der mit Geld knapp gehalten und manchmal grob behandelt wurde, fühlte sich vollkommen glücklich. Es war ihm lieb, daß man ihm im Leben alles vorkaute. Florent hatte ihn zu sehr wie ein arbeitsscheues Mädchen erzogen. Außerdem hatte er bei Onkel Gradelle eine Freundin gefunden. Als dieser seine Frau verlor, mußte er sich für den Laden ein Mädchen nehmen. Er suchte sich ein gesundes appetitliches Ding aus, weil er wußte, daß so etwas die Kundschaft aufmuntert und das gebratene Fleisch munden läßt. Er kannte in der Rue Cuvier am Jardin des Plantes15 eine Witwe, deren Mann Postvorsteher in Plassans, dem Sitz einer Unterpräfektur in Südfrankreich, gewesen war. Diese Dame, die sehr bescheiden von ihrer kleinen Pension lebte, hatte aus jener Stadt ein kräftiges und schönes Kind mitgebracht, das sie wie ihre eigene Tochter hielt. Lisa umsorgte sie sanft mit ihrem stets gleichmäßigen, ein wenig ernsten Wesen und war vollendet schön, wenn sie lächelte. Ihre große Anmut lag in der erlesenen Art, mit der sie ihr seltenes Lächeln anbrachte. Dann war ihr Blick eine Liebkosung, und der Ernst, der sie sonst umgab, verlieh diesem plötzlichen Wissen um ihren Zauber einen unschätzbaren Wert. Die alte Dame sagte oft, ein Lächeln Lisas würde sie zur Hölle geleiten. Als ihr Asthma sie dahinraffte, hinterließ sie ihrer Adoptivtochter alle ihre Ersparnisse, etwa zehntausend Francs. Acht Tage blieb Lisa allein in der Wohnung in der Rue Cuvier; und von dort hatte Gradelle sie geholt. Er kannte sie, weil er sie häufig mit ihrer Herrin gesehen hatte, wenn diese ihn in der Rue Pirouette besuchte. Bei der Bestattung jedoch erschien sie ihm so schön geworden und so stattlich, daß er bis zum Kirchhof mitging. Während der Sarg hinuntergelassen wurde, überlegte er, daß sie sich prächtig in seinem Fleischerladen ausnehmen würde. Er ging mit sich zu Rate und sagte sich, daß er ihr neben Unterkunft und Verpflegung gut dreißig Francs monatlich bieten könne. Als er ihr seine Vorschläge unterbreitete, bat sie sich vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit aus. Dann traf sie eines Morgens mit ihrem kleinen Bündel und ihren zehntausend Francs im Mieder bei ihm ein. Einen Monat später gehörte ihr das ganze Haus samt Gradelle und Quenu bis zum letzten Küchenjungen. Besonders Quenu würde sich für sie die Finger abgehackt haben. Wenn sie zu lächeln begann, blieb er stehen und lachte selber vor Entzücken, sie anzuschauen. Lisa, die älteste Tochter der Macquards aus Plassans, hatte noch ihren Vater. Sie sagte, er sei im Ausland, und schrieb niemals an ihn. Manchmal ließ sie sich die Bemerkung entschlüpfen, daß ihre Mutter zu ihren Lebzeiten schwer geschuftet habe und daß sie nach ihr geraten sei. Sie zeigte sich in der Tat außerordentlich geduldig bei der Arbeit. Aber sie fügte auch hinzu, daß die brave Frau eine wunderbare Beharrlichkeit an den Tag gelegt habe, sich umzubringen, damit der Haushalt lief. Sie sprach dann sehr verständig und in einer ehrbaren Art, die Quenu entzückte, über die Pflichten der Frau und des Ehemannes. Er versicherte ihr, daß er durchaus die gleichen Ansichten habe. Lisas Ansicht war, daß ein jeder Mensch für sein Essen arbeiten müsse, daß ein jeder selber seines Glückes Schmied sei, daß man schlecht handle, wenn man die Faulheit unterstütze, und daß das schließlich um so schlimmer für diese Nichtstuer sei, wenn es Unglückliche gebe. Das war nun rundweg eine Verdammung der Trunksucht und des allbekannten Bummellebens des alten Macquart. Und ohne daß sie es wußte, sprach Macquart ganz laut aus ihr; sie war lediglich eine waschechte, verständige, logisch denkende Macquart mit ihrem Verlangen nach Wohlleben, nachdem sie begriffen hatte, daß das beste Mittel, in glücklicher Wärme einzuschlafen, immer noch das ist, sich selber ein Bett von Glückseligkeit zu bereiten. Auf ein solches weiches Lager verwandte sie ihre Zeit und all ihre Gedanken. Schon mit sechs Jahren war sie bereit, den ganzen Tag artig auf ihrem Stühlchen zu sitzen, vorausgesetzt, daß man sie dafür am Abend mit einem Stück Kuchen belohnte.
Bei dem Fleischer Gradelle führte Lisa ihr ruhiges, gleichmäßiges, von ihrem bezaubernden Lächeln erhelltes Leben weiter. Sie hatte das Anerbieten des guten Mannes nicht auf gut Glück angenommen; sie verstand, in ihm einen Tugendwächter zu finden. Sie ahnte vielleicht mit dem Spürsinn glücklich veranlagter Menschen in diesem dunklen Laden in der Rue Pirouette die gesicherte Zukunft, von der sie träumte, ein Leben gesunden Genießens, eine nicht zu anstrengende Arbeit, für die jede Stunde den Lohn brachte. Sie betreute ihren Ladentisch mit der gleichen ruhigen Sorgfalt, die sie der Postvorsteherswitwe hatte angedeihen lassen. Die Sauberkeit von Lisas Schürzen wurde bald im ganzen Viertel sprichwörtlich. Onkel Gradelle war mit diesem schönen Mädchen so zufrieden, daß er manchmal beim Zubinden der Würste zu Quenu meinte: »Wenn ich nicht schon über sechzig wäre, mein Ehrenwort, ich würde die Dummheit begehen und sie heiraten ... Eine Frau wie die im Geschäft, das ist Stangengold, mein Junge.«
Quenu überbot ihn. Dennoch lachte er einem Nachbarn, der ihn eines Tages bezichtigte, in Lisa verliebt zu sein, ins Gesicht. Das scherte ihn nicht. Sie waren einfach gute Freunde. Abends gingen sie zusammen hinauf schlafen. Lisa hatte neben dem schwarzen Loch, in dem sich der junge Mann ausstreckte, eine kleine Kammer, die sie hübsch freundlich gemacht hatte, indem sie sie überall mit Musselinvorhängen ausschmückte. Einen Augenblick verweilten sie auf dem Flur, den Leuchter in der Hand, und plauderten, während sie den Schlüssel ins Schloß steckten. Dann machten sie ihre Türen wieder zu und sagten freundschaftlich:
»Gute Nacht, Mademoiselle Lisa!«
»Gute Nacht, Monsieur Quenu!«
Quenu legte sich ins Bett und lauschte, wie Lisa ihren kleinen Kram erledigte. Die Wand war so dünn, daß er jede ihrer Bewegungen verfolgen konnte. Er dachte: Sieh mal an, sie zieht die Fenstervorhänge zu. Was mag sie wohl vor ihrer Kommode tun? Jetzt setzt sie sich und zieht ihre Schuhe aus. Wahrhaftig, gute Nacht, sie hat die Kerze ausgeblasen. Also schlafen wir. – Und wenn er das Bett krachen hörte, murmelte er lachend: »Donnerwetter! Leicht ist sie nicht, die Mademoiselle Lisa.« Diese Vorstellung machte ihm Spaß, und schließlich schlief er ein und dachte dabei an die Schinken und an die Streifen frisch gesalzenen Schweinefleischs, das am Morgen fertigzumachen war.
Das ging so ein Jahr, ohne daß Lisa auch nur einmal errötete oder Quenu in Verwirrung geriet. Morgens, wenn mitten in der Hauptarbeit das Mädchen in die Küche kam, begegneten sich ihre Hände in dem Gehackten. Sie half ihm manchmal, hielt mit ihren molligen Fingern die Därme, während er sie mit Fleisch und Speckstücken vollstopfte. Oder sie kosteten zusammen das rohe Fleisch der Würstchen mit der Zungenspitze, um festzustellen, ob es richtig gewürzt sei. Sie konnte gute Ratschläge erteilen, denn sie kannte sich aus mit den in Südfrankreich üblichen Zubereitungsweisen, die er mit Erfolg ausprobierte. Oft spürte er, wie sie ihm über die Schulter tief in die Fleischtöpfe sah und ihm dabei so nahe kam, daß ihr starker Busen seinen Rücken berührte. Sie reichte ihm einen Löffel oder eine Schüssel zu. Das heftige Feuer trieb ihnen das Blut unter die Haut. Um nichts in der Welt hätte er aufgehört, den Fettbrei zu rühren, der auf dem Herd immer dicker wurde, während sie ganz ernsthaft erörterte, wie gar er schon sei. Am Nachmittag, wenn sich der Laden leerte, plauderten sie stundenlang ruhig miteinander. Sie blieb, ein wenig zurückgelehnt, hinter ihrem Ladentisch und strickte sanft und regelmäßig. Er setzte sich auf einen Hauklotz, baumelte mit den Beinen und klopfte mit den Absätzen gegen das Eichenholz. Und sie verstanden sich wunderbar; sie sprachen über alles, am meisten über Kochkunst, dann über Onkel Gradelle und dann noch über die Leute ihres Viertels. Sie erzählte ihm Geschichten wie einem Kinde. Sie wußte sehr hübsche Wunderlegenden voller Lämmer und Englein, die sie mit ihrer Flötenstimme und ganz ernstem Gesicht vortrug. Wenn eine Kundin eintrat, bat sie, um sich nicht stören zu lassen, den jungen Mann um den Topf mit Schweineschmalz oder die Büchse mit Weinbergschnecken. Um elf Uhr gingen sie wie am Abend vorher langsam hinauf schlafen. Wenn sie dann ihre Türen zumachten, sagten sie mit ihrer ruhigen Stimme:
»Gute Nacht, Mademoiselle Lisa.«
»Gute Nacht, Monsieur Quenu.«
Eines Morgens wurde Onkel Gradelle, als er gerade ein Sülzgericht zubereitete, vom Schlag getroffen. Er stürzte mit der Nase auf den Hacktisch. Lisa verlor nicht ihre Geistesgegenwart. Sie meinte, der Tote dürfe nicht mitten in der Rüche liegenbleiben, und ließ ihn nach hinten in ein kleines Stübchen bringen, in dem der Onkel sonst schlief. Dann legte sie sich mit dem Gesellen eine Geschichte zurecht; der Onkel müsse in seinem Bett gestorben sein, wenn man nicht das ganze Viertel verekeln und die Kundschaft verlieren wolle. Stumpfsinnig half Quenu die Leiche tragen, ganz verwundert, keine Tränen zu finden. Später weinte er mit Lisa gemeinsam. Zusammen mit seinem Bruder Florent war er Alleinerbe. Die Klatschbasen in den Nachbarstraßen schrieben dem alten Gradelle ein beträchtliches Vermögen zu. In Wahrheit war nicht ein einziger klingender Silbertaler zu entdecken. Lisa gab sich damit nicht beruhigt. Quenu sah, wie sie überlegte, vom Morgen bis zum Abend um sich blickte, als habe sie etwas verloren. Schließlich beschloß sie ein großes Reinemachen und gab vor, es werde geklatscht, die Geschichte vom Tode des Alten spreche sich herum und man müsse eine große Sauberkeit an den Tag legen. Als sie an einem Nachmittag seit zwei Stunden im Keller war, wo sie selber die Pökelfässer auswusch, kam sie, irgend etwas in ihrer Schürze haltend, wieder zum Vorschein. Quenu hackte gerade Schweineleber. Sie wartete, bis er fertig war, und plauderte mit ihm in gleichgültigem Ton. Aber ihre Augen hatten einen eigentümlichen Glanz. Sie lächelte ihr schönes Lächeln und sagte, sie wolle mit ihm sprechen. Sie stieg mühsam die Treppe hinauf, die Schenkel behindert durch das, was sie trug und ihre Schürze zum Zerreißen spannte. Im dritten Stock keuchte sie und mußte sich einen Augenblick auf das Geländer stützen. Verwundert folgte ihr Quenu, ohne ein Wort zu sagen, bis in ihre Kammer. Es war das erste Mal, daß sie ihn aufforderte, hereinzukommen. Sie schloß die Tür, und, die Schürzenzipfel loslassend, die ihre steif gewordenen Finger nicht mehr halten konnten, ließ sie einen Regen von Gold und Silberstücken sacht auf ihr Bett rollen. Sie hatte auf dem Boden eines Pökelfasses Onkel Gradelles Schatz gefunden. Der Haufen machte eine tiefe Kuhle in dieses zarte und weiche Jungmädchenbett.