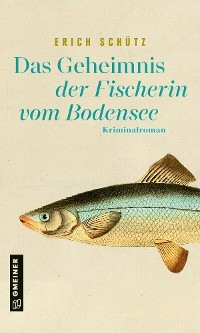Kitabı oku: «Das Geheimnis der Fischerin vom Bodensee», sayfa 2
»Und die Insassen in dem Wagen, der Ihnen gestern folgte, als Sie aus dem Wald herausfuhren, wer waren die? Ihre Pilzberater?«
»Weiß ich nicht.« Angriff ist die beste Verteidigung denkt sich Max und legt nach: »Ihre Kollegen haben den Wagen durchgewunken, mich haben sie angehalten, da müssen Sie die fragen.«
Schnell wird Max klar, die Polizei hat nichts in der Hand, das Frage-und-Antwort-Spiel bewegt sich belanglos an der Oberfläche, deshalb will er jetzt wissen: »Gehen Sie von Brandstiftung aus, oder warum sind Sie hier?«
»Wir ermitteln«, antwortet einer der Polizisten.
»Bei mir?«
»Auch bei Ihnen.«
»Lächerlich, ich kenn den Mann kaum, warum sollte ich? Was sollte ich für ein Motiv haben?«, winkt Max ab. Dabei denkt er an die drei Gestalten in dem Wagen, der ihm in das Heck fuhr. Lässig greift er in seine Tasche und spürt den weißen Zettel. KN–AK 475, erinnert er sich, der Wagen müsste sich doch finden lassen.
»Und wo sind Ihre Morcheln?«, unterbricht einer der Polizisten seine Überlegungen.
»Felchenfilets mit Morcheln wären eine feine Sache«, antwortet Max, »aber leider gibt es zurzeit beides nicht.« Freundlich lächelt er den Polizisten ins Gesicht und weiß auch schon, wie er an die Adresse zu der Autonummer kommt.
3.
Auf der Edelstahlfläche der Seziertischplatte liegt ein totes Felchen. Der Körper ist aufgeschnitten, die Innereien davor sind fein säuberlich drapiert. Deutlich zu erkennen sind die Leber, die Nieren und das Herz. Mit einem Handgriff zieht Doktor Simon die Rundleuchte an der Decke über das Zentrum des toten Fischs auf das Wundfeld. Der fokussierbare Lichtstrahl ermöglicht ein punktuelles Ausleuchten der Leber. »Sehen Sie hier, die Leber wie auch die Nieren sind angegriffen, die inneren Organe zeigen Zeichen einer Septikämie wie Petechien, das heißt breiige Nieren und Milzschwellung.«
»Kein Mensch will die Nieren oder gar die Milz der Felchen essen«, herrscht Martin Ellegast den Tierarzt an. Er selbst hat ihn von der Universität Hohenheim abgeworben. Er benötigt einen Sachverständigen, der seinen Testlauf der Felchengehegezucht begleitet, dokumentiert und schließlich wissenschaftlich die Unbedenklichkeit der Fischzucht im Bodensee belegt. Doktor Franz-Josef Simon gilt in der Fachwelt als unbestechlich.
Fischgehegezucht ist nichts Neues, Aquakultur klingt moderner. Die Anfänge der Kescherhaltung geht auf Fischer zurück, die schon immer im Bodensee Netze oder Kescher nutzten, um Fische, die sie unter der Woche gefangen hatten, am Wochenende frisch auf dem Markt anzubieten.
Positiv für Ellegast ist die Tatsache, dass bei den Gehegen im See die Fütterung, Kontrolle und Ernte leicht zu bewerkstelligen sind und gleichzeitig ein stetiger Austausch mit dem Umgebungswasser stattfindet. »Eine kostenlose Frischwasserzufuhr«, lacht Ellegast.
Seine Gegner dagegen bemängeln den ungehinderten Stoffwechselaustausch, Futterreste und eventuell verabreichte Medikamente, die direkt in den See geleitet werden. Dabei kommt es ihrer Meinung nach zur Störung des Ökosystems. »Und das im Trinkwasser!«, monieren nicht nur ausgewiesene Umwelt- oder Tierschützer.
Die von Ellegast neu installierten Netzgehege bestehen aus einem schwimmfähigen Trägersystem und einem Netz, das die Tiere einschließt. Die einzelnen Anlagen kann er leicht in der Größe variieren. Es sind kreisförmige Plastikkonstruktionen mit Netztiefen von 10 bis 40 Metern und einem Volumen von 3.000 bis 30.000 Kubikmetern.
Ellegast hatte die Ministerien in Stuttgart überzeugt, dass die Felchengehege die Wirtschaft und den Tourismus im Ländle stärken. Selbst kritische Politiker der Grünen Partei hatte er eingefangen. Einige von ihnen hatte er kurzerhand in seinem Privatflugzeug von Friedrichshafen nach Finnland geflogen. Dort betreibt Ellegast große Fischzuchtanlagen. Vor Ort konnten die Damen und Herren auch verschiedene Felchengehege inspizieren.
Ellegast lacht noch heute: »Ich weiß nicht genau, was sie gesehen haben, aber ich weiß, dass der Fraktionsvorsitzende am nächsten Morgen einen dicken Kopf hatte.« Geschickt hatte er die Kurzvisite geplant und die kleine Gruppe der Politiker sowie eine junge Journalistin des Lokalblattes nach der Landung in Finnland direkt auf sein Gelände gelotst und dort keine Minute aus den Augen gelassen.
Wie es sich in Finnland gehört, hat Ellegast neben dem Gästehaus auf seiner Fischfarm eine finnische Rauchsauna aufgestellt. Hier servierte er gleich nach der Ankunft am frühen Abend in dem rußigen Holzhaus persönlich das erste Bier und Wodka. Danach bewies er der kleinen Abordnung mit einem Sprung in einen seiner Teiche, wie sauber das Wasser ist.
Die Krönung hatte er sich für den späteren Abend aufgehoben. Gemeinsam ging er mit den Politikern und der Journalistin an einen großen See auf seinem Gelände. Der Redakteurin hatte er zuvor eine Nikon D7500 in die Hände gedrückt: »Damit Sie scharfe Bilder machen können«, hatte er zu dem jungen Mädchen gesagt und ihr etwas zu lange die Unterarme getätschelt.
Dann mussten sie alle in ein Boot steigen, in dem mehrere Kescher mit Teleskopstielen lagen. Ellegast steuerte das Boot auf den See. Hier sahen die Gäste große runde Netzbassins schwimmen. Drei Stück hatten einen Durchmesser von mindestens 50 Metern, die Tiefe gab er ihnen mit 30 Metern an. Er selbst steuerte das Boot an den Rand eines der runden Gehege und forderte die Gäste auf, sich jeweils mit ihren Keschern einen Fisch aus dem Wasser zu holen: »Ihr Abendessen!«, lachte er. »Ihre ersten Felchen aus einem Gehege!« Er warf eine Handvoll Fischfutter in das Netzgehege, und schon wimmelte die Wasseroberfläche von tummelnden Felchen. Jeder der Gäste hatte so schnell seinen Fisch im Kescher.
Gleich danach servierte die Küche den frischen Fang. Es gab Felchen mit Pfifferlingsoße und Fischrogen, Felchen mit Wildkräutern gefüllt und Felchenfilet mit Krebsen. »So gut wie an iserem See, oder?«, fragte Ellegast und schaute in die zufriedenen Gesichter seiner kleinen Ausflugsgruppe.
Auf dem Rückflug legte er den Reisenden noch eine kleine Ökobilanz vor. »Von Helsinki bis an den Bodensee sind es über 3.500 Kilometer, eine Tonne CO2-Emission kommt so für jeden größeren Transport der Felchen schnell zusammen. Klimafreundlich ist das nicht«, diktierte er der jungen Journalistin in ihren Block, die sich nochmals für die neue Kamera bedankte, während der Grüne Politiker nachdenklich nickte und zustimmte: »Wir sollten alles unternehmen, um den klimaschädlichen Lebensmitteltourismus zu beenden«, ließ der grüne Abgeordnete sich in der Bodenseezeitung zitieren.
»Leider sieht man einigen Felchen ihre äußerlichen Verletzungen an«, reißt Doktor Simon Ellegast aus seinen Erinnerungen. »schon bei Jungfischen zeigen sich dunkle Hautflecken und Rötungen bei den Flossenansätzen.«
»So lange es keine signifikanten Häufungen sind, sollten wir die Sachlage erst einmal unter uns hier klären«, versucht Ellegast zu beschwichtigen, »wir stehen am Anfang unseres Testlaufs, das bekommen wir alles schnell in den Griff. Für die Tiere ist das auch alles neu, das heißt viel Stress für sie, und zu allem hin ist es Sommer, wir haben gerade hohe Wassertemperaturen, das spielt uns nicht in die Karten.«
»Ja,« stimmt ihm Doktor Simon zu, nervös streift er eine graue Locke von seiner Goldrandbrille, sein Gesicht ist blass, seine hellblauen Augen flackern unruhig, »wir sind eben nicht in Finnland, der Bodensee wird jährlich wärmer, es weiß kein Mensch, wie die Felchen auch in freier Wildbahn darauf in Zukunft reagieren.«
»Wir müssen die Gehege einfach tiefer fahren, jeder Meter tiefer bringt uns kältere Wassertemperaturen«, winkt Ellegast ab, »das ist der Vorteil unserer Anlage, wir können den Felchenschwarm dorthin im See steuern, wo er sich am wohlsten fühlt.«
Im Gegensatz zu Doktor Simon sprüht Ellegast vor Zuversicht. Wobei gerade im Sommer, bei erhöhten Wassertemperaturen und Sauerstoffmangel, auch die Forellenzüchter im Schwarzwald das Problem der Furunkulose kennen. Die Veränderungen auf der Fischhaut werden dem erhöhten Stress der Tiere in zu warnem Wasser zugeschrieben. Letztendlich ist es eine bakterielle Infektionskrankheit, die sich im Fischschwarm bei enger Haltung durch Kot und Urin infizierter Fische verbreitet.
»Stellen Sie sich nicht so an, Herr Doktor«, schmunzelt Martin Ellegast, »noch nie ein Furunkel am Arsch gehabt?« Er nimmt den toten Fisch und seine Innereien und wirft alles zusammen in einen Plastikeimer neben dem Seziertisch. »Wir werden uns die Mühe machen müssen und jedes Fischchen liebevoll mit einer kleinen Spritze stärken.«
»Ich werde eine bakteriologische Diagnose erstellen, nach der wir ein wirksames Antibiotikum zusammenbauen«, gibt sich Doktor Simon geschlagen und spritzt mit einem Wasserschlauch das Blut des toten Felchen von der Tischwanne. Über ein leichtes Gefälle verschwinden die letzten Spuren der verletzten Innereien im Abfluss.
Martin Ellegast hatte schon in seinem Betriebswirtschaftsstudium erkannt, dass günstige Angebote immer der Erfolg rationeller Produktion sind. Auto, Fernsehen oder Handy eroberten nur als Massenprodukt den Markt. Dies gilt für ihn auch für Lebensmittel. Fleisch und Fisch liebten die Menschen schon immer, aber nicht immer konnten sie sich die Edelprodukte leisten. Natürlich erkannte auch er die Werbewirksamkeit der Auszeichnung »Wildfisch geangelt«. Doch Insider können darüber nur lachen. Was müsste ein Fisch kosten, wenn ein Angler früh am Morgen auf dem See seine Rute auswirft und am Mittag mit nur einem oder auch zwei Felchen nach Hause kommt. Der Schlüssel zum Erfolg heißt Arbeitsteilung und in seiner Branche Massenaufzucht und Fließbandschlachtung. In seinem Gehege zählt nicht der einzelne Fisch, sondern die Tonnen an Felchen, die er täglich am Fließband zerlegt, filetiert und als Convenience an seine Großkunden liefern will.
»Wir müssen unseren Berufsstand schützen!«, ruft Gerdi Ellegast in den Saal des Nebenzimmers im Gasthaus »Grüner Baum« in Moos. »Wir Berufsfischer sterben aus!« Tatsächlich werden es jedes Jahr weniger, mit den jährlich sinkenden Fangquoten sinkt auch die Zahl der Berufsfischer. Jedes Jahr melden sie neue Minusrekorde. Immer mehr Stichlinge und Quagga-Muscheln finden sich in dem ständig wärmer werdenden Seewasser und immer weniger Felchen. Da hängt so mancher Berufsfischer genervt seine Netze an den Nagel.
Deshalb hat der Wirt Hubert Neidhart zusammen mit Gerdi Ellegast alle noch registrierten Berufsbodenseefischer eingeladen. »Es geht um unseren Beruf, unsere Zukunft und auch um iseren See!«, appelliert Gerdi. Fast alle Berufsfischer, auch aus Bayern, Vorarlberg und der Schweiz, sind gekommen. Sie wollen von den Höri-Bauern lernen, wie man ein Lebensmittel mit einem amtlichen Patent schützen kann, wie dies die Höri-Bauern mit ihrer Bülle geschafft haben.
Die Höri-Bülle ist eigentlich nur eine kleine Speisezwiebel, die seit der Urbanisierung durch die Reichenauer Mönche auf der Bodenseehalbinsel Höri angebaut wird. Auf der Reichenau selbst hatten die Mönche keinen Platz für Zwiebeln, da pflanzten sie lieber ihre Reben für Wein.
Heute wäre die alte Zwiebelsorte längst vom Markt verschwunden, hätten nicht ein paar Hörianer sich für die besondere, kleine rote Zwiebel eingesetzt. Dank einigen Gärtnern und Wirten wie Hubert Neidhart heißt die Zwiebel jetzt Höri-Bülle und ist mit ihrer geografischen Herkunftsbezeichnung und -angabe bei der EU registriert und dadurch amtlich geschützt.
»Genauso müssen wir es auch mit unserem Felchen machen«, fordert Gerdi Ellegast, »ein Bodenseefelchen ist ein Blaufelchen, das kreuz und quer, wild und grenzenlos durch den Bodensee schwimmt!«
Hubert Neidhart erklärt, wie man aus dem Bodenseefelchen eine Marke als Wildfisch macht. »Wir müssen schneller als der Ellegast sein«, sagt er, »wenn er die Marke Bodenseefelchen anmeldet, kommen wir mit dem Wildfelchen zu spät.« Dann lacht er und schaut süffisant zu Gerdi: »Du weißt ja, wie schnell der ist, wie schnell hatte er dich an seiner Angel gehabt.«
»So leicht hab’ ich es ihm auch nicht gemacht«, schmunzelt sie. Sein Werben war tatsächlich lange Zeit ein Thema am See. Die Bodenseehymne der »Fischerin vom Bodensee« erinnert noch heute an Ellegasts Bemühungen, die hübsche Gasselerin zu erobern. Ein Liedtexter hatte ihn gar mit einem Hecht verglichen, der gerne von der Maid gefangen genommen worden wäre, bis aber umgekehrt er sie in seinem Netz gefangen hatte.
»Aber nichts ist von Dauer,« zwinkert Gerdi keck Hubert zu, während sie unterm Tisch einen Tritt von einer blonden jungen Frau bekommt, die aussieht, wie aus ihrem Gesicht geschnitten. »Mama«, zischt diese streng, »bitte!«
»Ja, du hast ja recht, das gehört nicht hierher, aber dass jetzt der Streit durch unsere eigene Familie geht«, schaut Gerdi Ellegast bekümmert zu ihrer Tochter Lena, »und dass dein Papa es so weit kommen ließ, das trifft mich eben besonders.«
»Wir schauen jetzt, dass wir einfach möglichst schnell für das Bodensee-Wildfelchen einen Markenschutz bekommen, dann sehen wir weiter«, antwortet Lena trocken und schaut dabei ihrer Mutter prüfend in die Augen. Die beiden können ihr inniges Mutter-Tochter-Verhältnis nicht verbergen.
Lena könnte heute als die Fischerin vom Bodensee in dem damals über ihre Mutter gedrehten Fernsehfilm als Double ihre Rolle übernehmen, niemand würde einen Unterschied sehen. Sicherlich müsste sie über ihren kurzen, schelmischen Haarschnitt eine Perücke mit Zöpfen ziehen. Die blonden Haare und dunklen Augenbrauen hat sie ohne Zweifel von ihrer Mutter geerbt, die sportliche Figur vielleicht von ihrem Papa. Die weichen Züge und freundlichen Augen aber waren nun einmal typisch Mama.
»Meinst du, dann ist der Brand vergessen?«, flüstert diese ihrer Tochter leise ins Ohr.
»Was meinst du?«, stellt die sich unwissend.
»Danke, dass du dichtgehalten hast!«, lächelt Gerdi wissend. »Seit deiner Grundschulzeit verschnörkelst du das große D wie sonst niemand.«
»Ich verstehe nicht.«
»Max kennt dich nicht, und du ihn auch nicht. Aber woher wusstest du, dass er neben Opas Haus wohnt?«, insistiert sie weiter. »Ich kenne deine Schrift, also: Woher wusstest du, wo du sein Auto findest, an dem du deinen Zettel hinterlassen hast?«
»Ich habe ihn aus deinem Küchenfenster gesehen, als ich dich das letzte Mal besucht habe, und ein Freund kennt ihn von seinen Auftritten als Musiker.« Ohne Luft zu holen, fügt sie schnell hinzu. »Aber wir waren es nicht!«
»Wer ist wir, und was habt ihr dort gesucht, und wer ist dein Freund?«
Lena kann vor ihrer Mutter sowieso kein Geheimnis lange für sich behalten, also packt sie aus: »Wir wollten ein Graffiti auf die Hauswand sprühen, in diesem Moment sehe ich, wie ein kleines Feuer in einer der Fritteusen in der Küche brennt. So sagt es auch die Feuerwehr, es war keine Brandstiftung! Das Öl soll sich an einer nicht ausgeschalteten Heizung entzündet haben, und du weißt, wie groß Papas Fritteusen sind. In der Zeitung stand etwas von über 600 Litern.«
»Ich hoffe, du hast damit wirklich nichts zu tun«, atmet Gerdi Ellegast erleichtert aus, »aber was, bitte, sollte das für ein Graffiti sein, und wer ist verdammt nochmal wir?«
»Njoschi ist ein Künstler, er hätte uns ein Felchen hinter Gitterstäben auf die Hauswand am Eingang gesprüht. Aber als ich das Feuer sah, war mir sofort klar, dass wir verschwinden mussten, dabei kam uns dieser Max in die Quere. Was wollte denn der Sekel da?«
»Morcheln pflücken«, lacht Gerdi Ellegast und schiebt dann ernsthaft nach, »er wollte wohl in den Müllcontainern die Absenderadressen der Felchenlieferanten finden.«
»Uns kam er in die Quere, beinahe hätte uns die Polizei erwischt, das hätte Papa nicht lustig gefunden.«
»Du solltest solche Aktionen sowieso unterlassen, Lena«, warnt die Mutter, »kümmere dich um dein Studium. Du kannst uns mehr helfen, wenn du deinen Professor dazu bringst, öffentlich seine Befürchtungen zu wiederholen, dass die Krankheiten der Felchen aus dem Gehege sich auch auf die Wildfische im See übertragen können.«
Lenas Professor Dierke, er leitet die biologische Fakultät der Uni Konstanz, wo Lena im sechsten Semester studiert, hatte in einem kleineren Kreis der Bodenseefischer seine Befürchtung geäußert, dass Zuchtfische aus dem Gehege ihre Krankheiten an die Wildfische übertragen könnten.
»Mama!«, wird Lena etwas lauter, »der Dierke lässt sich gar nichts sagen. Da müssen wir schon selbst aktiv werden, das sagen auch Tante Hanni und Tante Nanni.«
»Oh nein«, stöhnt Gerdi und verdreht die Augen, »was haben die beiden Schreckschrauben mit unseren Felchen zu schaffen, ich denke die sind Vegetarier?«
»Eben«, schmunzelt Lena, »die sind gegen das Gehege von Papa, aber eben auch gegen deine Netze. Weißt du nicht, die beiden leiten die Regionalgruppe ›Peta‹ am See«, klärt Lena ihre Mutter auf.
»Die beiden leiten gar nichts, die beiden leiden eher an Unterbeschäftigung«, antwortet Gerdi, die von den Zwillingsschwestern und ihrem Treiben meist genervt ist.
Als sie Martin geheiratet hat, traten Hanni und Nanni lautstark und schnatternd in ihr Leben und haben sich seither, in ihren Augen, zu meckernden alten Jungfern entwickelt. »Von Beruf Erbin! Ich kann einfach mit Menschen nichts anfangen, die nicht fähig sind, ihr eigenes Geld zu verdienen, aber meinen, überall wichtig zu sein und ihren Senf beisteuern zu müssen.«
»Warte ab«, antwortet Lena kämpferisch, »die werden uns vielleicht noch nützlich sein im Kampf gegen Papas Pläne.«
4.
Herrschaftlich steht das Schlösschen des ehemaligen Bankiers Aggermann am Bodenseeufer bei Fußach. Es hat den Charme der verblassten noblen Adelszeit. Die Biberschwanzziegel auf dem Dach und den Türmchen sind vermoost, der Putz verwittert, Efeu rankt sich bis in die obersten Stockwerke.
Am alten hölzernen Steg schaukelt ein Riva-Motorboot im Rhythmus der Wellen des Sees. Die Chromteile und der Lack des polierten Mahagoniholzes funkeln in der Morgensonne, als wäre der betagte Oldtimer erst gestern neu aus der edlen Manufaktur Cantiere San Marco geliefert worden.
Ein Hahn begrüßt lauthals krähend den sonnigen Morgen, und schon kommen mehrere Hühner über den einstigen Zierrasen des Schlösschens gelaufen und scharren in dem verbliebenen Grün.
Wo der alte Bankier Aggermann noch seine Rosen gezüchtet hatte, haben seine Zwillingstöchter, Hanni und Nanni, Vogelvolieren und einen Hühnerstall mit Fenster, inklusive Seeblick für die Hühner, vor der historischen Fassade errichtet.
In der Garage, wo früher der alte Rolls Royce des Bankdirektors stand, stehen heute zwei alte Lamas. Im angebauten Chauffeurhaus dreht sich Andrei auf seiner schmalen Pritsche noch einmal um seine eigene Achse. Er ist jeden Morgen der Erste, der auf dem herrschaftlichen Anwesen den Tag begrüßt. Die gurgelnden Geräusche der Lamas rufen ihn zur Fütterung der Tiere. Dann spitzen sie die Ohren und lassen ihre Schwänze baumeln, und Andrei weiß, dass es ihnen gut geht. An Tagen wie heute lässt er sie aus ihrem Stall und legt ihnen Gräser und Heu vor die Nasen. Sie haben, wie auch er, in dem Anwesen der Aggermann-Töchter Asyl gefunden.
Von Hanni und Nanni ist um diese Zeit noch längst nichts zu sehen. Sie schlafen jeden Morgen lange. Für Andrei sind sie die Engel des Schlosses. Vor drei Jahren zog er an einem verschneiten Dezembertag mit einem kleinen Zirkus durch Fußach. Die Kasse war leer, sie brauchten Futter für ihre Tiere. Andrei kam mit seinen zwei betagten Lamas bei dem herrschaftlichen Haus vorbei. Zuerst ging er einfach weiter, doch dann traute er sich doch: Beherzt zog er an der alten Klingel vor dem großen eisernen Schlosstor, sagte sein Sprüchlein auf, und zu seiner Überraschung luden die beiden Frauen ihn mitsamt seinen beiden Lamas in den Schlosshof ein. Seither ist er hier, sie haben ihn als Tierpfleger engagiert. Auch für die beiden Lamas war Platz, als der Zirkus mit den anderen Tieren weiterzog.
Unter Tierfreunden gelten die Zwillingstöchter als die doppelte Brigitte Bardot vom Bodensee. Sie hatten sich schon als Backfische geschworen, dass nie ein Mann zwischen ihnen stehen solle, so sind sie ungeküsste Jungfrauen geblieben, mit einem großen Herz für Tiere.
Den Ziergarten ihres Papas verwandelten sie nach seinem Tod zu einem Tiergarten. Da kam ihnen Andrei gerade recht, denn Tiere zu halten, macht viel Arbeit. Und wie auf einem Gnadenhof wurden es immer mehr herrenlose Hunde und Katzen, gealterte Pferde, Hühner, Schafe und jetzt auch eben auch noch die beiden Lamas.
Andrei ist den beiden Schlossbesitzerinnen ewig dankbar. Er hatte, als verschriener Zigeuner, in Rumänien keine schöne Jugend, seine einzigen Freunde waren schon immer die Tiere. So kam er zu dem kleinen Zoo, der seit Jahren mehr recht als schlecht durch Kleinstädte tingelte. Andrei hatte einen Trick gefunden, wie er die Lamas zum Spucken brachte. Ihre Treffsicherheit war die Attraktion, und zusätzliches Geld bekam er, wenn er Kinder an Nachmittagen die Lamas führen ließ. Doch ein schönes Leben war es in dem alten Zirkuswagen nicht. Das Chauffeurhaus bietet ihm zum ersten Mal in seinem Leben ein gemauertes und sicheres Zuhause.
Nach der Fütterung der Lamas bringt er den Hühnern ihre Körner, stellt dem Wachhund Oskar neues Wasser hin und lässt die beiden Schafe, Lina und Lisa, aus dem Stall, dann muss er noch die beiden betagten Pferde auf die Koppel führen, bevor er sich selbst einen Kaffee aufstellt.
Ganz geheuer sind Andrei die beiden Hausbesitzerinnen nicht. Er kann sie kaum auseinanderhalten, so ähnlich sehen sie sich, und zu allem hin tragen sie täglich die fast immer gleich aussehenden weiten Röcke, Blusen und wallenden Gewänder. Ihre schneeweißen Haare tragen sie meist offen oder lose zu einem wilden Zopf gebunden. Was ihm gefällt, ist, dass die beiden rauchen wie ein Schlot wie er auch.
Was er aber gar nicht versteht, ist, dass sie kein Fleisch essen, keine Wurst oder Käse und nicht einmal die Eier der Hühner. »Hühner sind nicht da, um jeden Tag Eier zu legen«, sagen sie, »das macht ihnen Stress.« Und dann reden sie noch wirre Dinge wie: »Eierklau« und: »Wir stehlen den Hennen ihre Jungen, bevor diese überhaupt geboren wurden.«
Trotzdem, wenn Andrei sich unbeobachtet weiß, nimmt er gerne eines der frisch gelegten Eier und schlürft es noch warm aus der Schale. Das hat schon seine Oma so gemacht, und so erinnert ihn der Geschmack an seine Kindheit. Ebenso heimlich isst er natürlich nach wie vor seine scharfe Lammsalami, Mititei, die gegrillten Hackfleischröllchen vom Lamm, oder Pastramă, geräuchertes Rindfleisch in Paprikamantel. Wann immer er in der Stadt ist, um Einkäufe zu erledigen. kehrt er in einem türkischen Imbiss ein und stopft sich mit Döner und Schafskäse voll.
Wenn Nanni und Hanni Besuch haben, spielt er oft den Kellner. Dann serviert er, was die beiden Frauen zubereitet haben, Hummus und Falafel. Anfangs hat ihn gewundert, dass keiner der Gäste nach anderen Speisen verlangte. »Wir sind Veganer«, wurde er aufgeklärt, »wir lehnen die Ausbeutung der Tiere ab!« Und dann diskutierten sie über ein Fischgefängnis im Bodensee, das gesprengt gehört.
Die Fische sollen sich frei in dem großen See bewegen dürfen und nicht als Zuchthausfische eingesperrt sein. Das leuchtet auch Andrei, dem Freund eines scharfen Fischrogensalates mit Pflaumenschnaps, ein. Im Gefängnis saß er selbst einmal, es war die schlimmste Zeit in seinem Leben. Seine beiden Lamas durften jeden Tag spazieren gehen, das sollte auch allen Fischen möglich sein. »Este clar«, stimmte er der Versammlung zu und genoss es, von den auffallend vielen jungen und schönen Frauen wie ihresgleichen behandelt zu werden.
Peter Ochsner verkauft an schönen Tagen schnell 100 Felchen. Das Felchen ist der Brotfisch am See, und seit die Fischer über den geringen Fang klagen, nimmt die Nachfrage der Gäste dummerweise proportional zu. Martin Ellegast hatte ihm heute Morgen die erste Lieferung seiner Bodenseefelchen aus dem Testgehege geliefert. Der Preis liegt ein Drittel unter dem der Wildfelchen. Da überlegt ein Mann wie Ochsner nicht lange und nimmt, was er bekommt. Doch jetzt schaut er sich die erste Lieferung genauer an und sieht dabei weniger glücklich aus.
Von den 100 Felchen wurden 80 filetiert geliefert. Von ihnen sieht Ochsner nur die weißen Filets, schön sauber zerlegt und geputzt. Doch 20 der Felchen hat er ganz bestellt, sie liegen am Stück, ausgenommen, aber mit Kopf, Schwanz, Haut und Flossen vor dem Großgastronomen auf dem Tisch, doch sie gefallen ihm gar nicht. Bei einigen zeigen sich auf der Hautoberfläche bei genauem Hinsehen kleine Knötchen oder Beulen, vor allem an den Flossen. Ochsner dreht eines der verletzten Felchen um und sieht ein aufgebrochenes, blutunterlaufenes Geschwür. »Was soll der Dreck«, brüllt Ochsner, »die haben die Beulenkrankheit!« Wutentbrannt rennt er zum Telefon.
»Ein Drittel billiger! Das wolltest du doch«, kontert Martin Ellegast gelassen, »und die Filets sind astrein. Was willst du überhaupt mit ganzen Felchen? Die will doch kein Gast mehr, da müssten sie die Gräten selbst freipulen.«
»Du musst mir nicht sagen, was unsere Gäste wollen, schon mal was von Felchen Müllerin Art gehört?«
»Mensch, Peter, bleib auf dem Teppich«, beschwichtigt Ellegast, »und freue dich über die Lieferung der 80 Filets von echten Bodenseefelchen, wer kann dir das sonst bieten? Und dann noch zu dem Preis.«
»Die 20 mit Beulenpest bezahle ich dir nicht, die kann ich doch grad in den Cutter schmeißen.«
»Red’ keinen Nonsens, die filetiertest du, wie wir auch die anderen filetiert haben, und dann verkaufst du sie als Filet.«
»Soll ich die dem Wirtschaftskontrolldienst geben, was die dazu sagen?«, droht Ochsner. »Glaubst du nicht, dass die Beulenpest auch die inneren Organe beschädigt?«
»Was weißt du von Beulenkrankheiten bei Fischen, auch die Wildfische haben immer wieder kleine Verletzungen. Die Felchen leben im Schwarm, da ist nicht jeder immer des anderen Freund«, wird Ellegast ungehalten. Doch mit ruhigerer Stimme appelliert er: »Sprich bitte nicht mehr von Beulenpest, das ist ein großer Unsinn. Ja, es mag ein paar verletzte Felchen im Gehege geben, aber erstens werden wir das Problem lösen, und zweitens, glaub mir, ein paar Pusteln habe alle Fische hin und wieder.«
Max hat seinen Chef in der Küche schreien gehört, seither steht er am Pass und lauscht gespannt. Er wartet, bis Ochsner sich beruhigt hat und die Küche verlässt, erst jetzt traut er sich aus der Deckung und will die Tiere selbst in Augenschein nehmen. Gerdi hatte schon immer vor den engen Gehegen gewarnt.
20 Kilo Felchen auf einen Kubikmeter sei kein Problem, behauptet Ellegast. Doch wenn die einzelnen Felchen der 20-Kilo-Menge beginnen, größer zu werden, ändert sich das Verhältnis. Das ist für den versierten Fischhändler keine Neuigkeit, doch er muss das Ergebnis jetzt verkaufen. Tatsächlich haben einige der Felchen kleine Beulen und Verletzungen, er hat selbst gesehen, wie bei einem Felchen mitten auf der Stirn aus der Beule etwas Eiter austrat.
»Was macht der Chef nur für ein Theater«, sagt trotzdem einer der Köche im renommierten Seerestaurant ungerührt, »wenn ich das Felchen brate, sieht die kleine Verletzung niemand mehr.« Dann lacht er und schiebt belustigt nach: »Und wer isst schon den Kopf?«
Alois verzieht angewidert das Gesicht. »Willst du etwa solche Felchen essen?«
Der Koch lacht noch breiter: »Deshalb putzen wir zuvor, was wir kochen, damit du es schön drapiert servieren kannst. – Wichtig ist nur, dass es schmeckt!«
Jetzt heißt es für Max, schnell zu handeln. Er will unbedingt so ein Zuchtfelchen, das Ellegast am Morgen frisch in das Seerestaurant geliefert hatte, untersuchen lassen. Was heißt das: Beulenkrankheit?, will er wissen. Hat Ochsner in seinem Ärger nur so dahergeredet, oder gibt es diese Krankheit tatsächlich, und wenn ja, was heißt das dann? Er muss dringend Gerdi solch ein Felchen bringen, die muss es sich ansehen. Aber er hat gerade erst mit seinem Dienst begonnen, der Mittagsservice steht bevor, er kann jetzt unmöglich weg, und wer weiß, ob die 20 Felchen nach seinem Dienst nicht schon verarbeitet sind?
Max ruft seinen Kumpel Hanspeter an, er zählt zu den anonymen Millionären der Stadt und hat meist Zeit. Er hat nicht nur ein Häuschen geerbt, sondern auch noch einen großen Garten dazu mit Seeblick. »Panoramablick!«, grinst Karpfen, mit seinen fleischigen Lippen, wenn er Max über sein Erbe reden hört, und pocht dann darauf, dass er sein Geld als anständiger Freiberufler verdient. Er gibt vor, Immobilienmakler zu sein, doch makeln heißt in seinem Fall, einfach mit einem Anruf einen Hausbesitzer mit einem Kapitalbesitzer zusammenzuführen. Das schafft der Kerl meist leicht nebenbei. Er ist der Spross einer alteingesessenen Überlinger Familie. Mit der Hälfte der Menschen in dem Städtchen sind sie verwandt oder verschwägert. Hanspeter kennt Hinz und Kunz und jeder kennt ihn, und selbst seinen Übernamen »Karpfen«. Jede Oma, die ihre Immobilie verkaufen will, ruft Karpfen mit seinen großen vertrauenserweckenden Glupschaugen an, und er sucht in seiner langen Liste der Möchtegern-Geldanleger einen passenden Käufer – und schon hat er seine Provision in der Tasche.
»Lieber Hanspeter«, bittet Max ihn am Telefon, »kannst du mich sofort im Seerestaurant besuchen, bring einen leeren Posaunenkoffer mit und setz dich an den Tisch am Ausgang zur Küche. Du darfst bestellen, was du willst, musst nichts bezahlen, danach bringst du den Posaunenkoffer zu Gerdi.«
»Was soll das, bin ich dein persönlicher Paketausfahrer?«
»Ja, du wirst Gerdi ein kleines Geschenk bringen, über das sie sich sicherlich freuen wird«, kurz nachgedacht fügt er hinzu, »oder auch nicht.«
»Was soll das heißen?«, will Hanspeter wissen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.