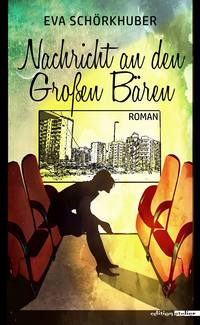Kitabı oku: «Nachricht an den Großen Bären»

Eva Schörkhuber
Nachricht an den Großen Bären
Roman

Du wirst dich jetzt auf meine Stimme konzentrieren. Meine Stimme wird dir dabei helfen, weiter zu kommen. Sie wird dich auf eine Reise schicken. Sie wird dir zeigen, wie deine Welt in ein paar Jahren aussehen wird. Du wirst sehen, wie du dich dann verhalten wirst. Ich zähle jetzt von eins bis zehn. Wenn ich bei zehn angelangt bin, wirst du dich auf den Weg gemacht haben, um die Welt zu verändern. Ich sage: eins. Du konzentrierst dich ausschließlich auf meine Stimme und beginnst langsam, dich zu entspannen. Zwei. Deine Hände und deine Finger werden wärmer und schwerer. Drei. Die Wärme dehnt sich aus von deinen Händen über deine Arme, deine Schultern und deinen Nacken. Vier. Deine Füße und deine Beine werden schwerer. Fünf. Die Wärme dehnt sich in deinem ganzen Körper aus. Bei sechs möchte ich, dass du tiefer gehst. Ich sage nun: sechs. Dein ganzer warmer Körper beginnt zu sinken. Sieben. Du gehst tiefer und tiefer und tiefer. Acht. Mit jedem Atemzug gehst du tiefer. Neun. Du schwebst. Bei zehn wirst du in einem Zug sitzen, der gerade abfährt. Ich sage: zehn.

Inhalt
Nachricht an den Großen Bären
KAPITEL I
ZÄHNEKNIRSCHEN
KAPITEL II.
HABE ICH IHRE LETZTE FRAGE NUN BEANTWORTET?
KAPITEL III.
ECHOLOT
KAPITEL IV.
ROT IST EINE STUMME FARBE
KAPITEL V.
HIMMELSBESEN
KAPITEL VI.
DIE DICHTE DER ANGST
KAPITEL VII.
Nachricht an den Großen Bären
I
Nun, da ich mich auf den Weg gemacht habe, wird das alles hier ein Ende finden. Welches Ende, das wird sich zeigen, doch so weitergehen wie bisher wird es nicht. Bestimmt nicht. Unter den Rädern ächzen die Schienen. In meinem Kopf, auf meinen Armen und Beinen liegt die Schwere der vergangenen Monate. Bald schon werden wir Fahrt aufgenommen haben. Wir werden durch die Landschaft gleiten, kein Ächzen mehr, keine Schwere mehr. Nur der Leichtsinn des Unterwegs, des Unterwegs-Seins wird uns etwas benommen sein lassen. Ich trage nur wenig bei mir. Die weiche, schwarze Reisetasche auf der Gepäckablage über mir. Der graue Staubmantel, in dem meine Reisedokumente stecken, an dem Haken neben mir. Die Papiere habe ich gut verstaut. Ich habe sie zusammengerollt und während des Abreisegetümmels zwischen zwei der gepolsterten Sitze gesteckt. Wenn sie mich kontrollieren, werden sie nichts bei mir finden. Ich gehe davon aus, dass ich kontrolliert werde. Obwohl ich eine gänzlich unauffällige Person bin. Nahezu. Denn da gibt es diesen kleinen Leberfleck schräg über meinem rechten Mundwinkel. An ihm bleiben die Blicke der Menschen hängen, die sich fragen, ob er echt ist oder aufgemalt. Dieser kleine schwarze Punkt stiehlt meinem Gesicht etwas von seiner reinen Belanglosigkeit. Manche Frauen, mit denen ich auch körperlich verkehrt habe, wollten mir weismachen, dass ich schön sei. Manche Männer, mit denen ich nicht auf diese Weise verkehrt habe, auch. Ich bin überzeugt davon, dass sie sich getäuscht haben, dass sie sich haben täuschen lassen von der nahezu vollendeten Belanglosigkeit meines Gesichts. Meine Eltern haben immer behauptet, ich sähe meiner Großtante Paula ähnlich. Ich kenne sie aber nur von Bildern, von alten Schwarz-Weiß-Fotografien, auf denen sie jung ist und sehr bieder wirkt. Sie trägt das Haar streng zusammengebunden und lächelt gekünstelt. »Für den Fotografen« werden sie ihr damals gesagt haben, um ihr dieses schmale Lächeln zu entlocken. Ihr Gesicht ist platt und nichtssagend. Aber auch sie hat diesen Leberfleck über dem rechten Mundwinkel. Sie ist die Schwester meines Großvaters väterlicherseits, und sie lebt, soweit ich weiß, mit ihrem Mann in der kleinen Stadt, die auch an der Bahnstrecke liegt. Gesehen habe ich sie nie. Gehört von ihr habe ich so gut wie nichts. Ein alter, schäbiger Mantel des Schweigens liegt über dieser Familiengeschichte, und ich habe es aufgegeben, nachzufragen. Mein Vater weiß nichts oder will nichts wissen, und mein Großvater hat sich zeit seines Lebens geweigert, über seine Schwester zu sprechen.
Der Schnellzug kriecht aus der Stadt, langsam wie eine Schnecke, die sich ihres alten, brüchigen Hauses entledigt, um ein neues zu suchen. Die Ränder der Stadt liegen in Trümmern. In den Vororten türmen sich auf den Straßen die Reste der Barrikaden, Sandsäcke, Holzpaletten. Möbelstücke liegen zerstreut, zerrissen und zerstückelt herum. Dass es so weit gekommen ist, überrascht mich auch heute noch. »Wehret den Anfängen« ist vor ein paar Jahren auf Transparenten gestanden, und ich habe gelacht über diesen historischen Kurzschluss, über diese so geschichtsbeflissen übertriebene Hysterie. Nun ja. Zwei Jahre später schon ist die Wahl annulliert worden. Alle darauffolgenden Wahlgänge sind wieder angefochten und aus immer fadenscheinigeren Gründen für ungültig erklärt worden. Ich kann sie nicht mehr alle aufzählen, die Vorwände, mit denen ein immer befangeneres Höchstgericht die Wahlergebnisse für null und nichtig befunden hat. Einmal sind es die Briefwahlen gewesen, einmal das Wahlalter, ein anderes Mal wiederum die angeblich getürkten Wahllisten und so weiter und sofort. Schließlich ist die Wahlbeteiligung auf unter zehn Prozent gesunken. Das hat das Höchstgericht zum Anlass genommen, keinen weiteren Wahltermin mehr festzulegen.
Ah, wir erreichen die Stadtgrenze. Die Vorstadtruinen weichen den sanften, bewaldeten Hügeln. Ein erstes Aufatmen. Wir gewinnen an Fahrt. Ich hoffe, dass ich dieses Abteil ganz für mich behalten kann, dass kein Mensch neben mir oder gar mir gegenüber Platz nehmen wird. Diese Bahnabteile sind mir normalerweise zu eng. Oder zu intim, wie Claire vielleicht sagen würde. Aber nur hier sind die Polstersitze eng genug, um zwischen ihnen die Papierrollen zu verstecken. Und das ist schließlich meine Aufgabe. Ich strecke die Beine aus. Ich streife die Schuhe ab und lege die Füße auf den Sitz gegenüber. Nein, Entspannung verspüre ich noch keine. Eher eine tickende Unruhe, als hätte ich nur noch wenig Zeit, meine Gedanken zu ordnen und mir über die letzten Monate klar zu werden. Dabei weiß ich doch, dass diese Fahrt lange dauern wird, vielleicht sogar sehr lange, denn bis ich über die Grenze … Aber daran denke ich jetzt nicht. Ich sollte lieber versuchen …
Aber nein, nicht doch: »Danke, nein, ich möchte keinen Tee«. Wie sie mich ansieht, diese Person, die ihren Service-Wagen durch die schmalen Gänge schiebt. Als stünde in meinem Gesicht etwas geschrieben, das sie zu entziffern versucht. Vielleicht ahnt sie – doch nein, Ahnung hat sie keine, und wissen kann sie schon gar nichts. Ich muss ruhig bleiben, den Umständen entsprechend gelassen. Es wird der Leberfleck über meinem Mundwinkel gewesen sein, der ihren Blick angezogen hat. Auch sie wird sich gefragt haben, ob er echt ist oder nicht. Ich darf die Nerven nicht verlieren. Nicht jetzt. Ich habe so lange schon durchgehalten, ich werde nicht jetzt, auf den letzten Kilometern dieses Weges versagen. Claire hat mir ihren Talisman überlassen, »für diese Reise«, hat sie gesagt und »bis zu unserem Wiedersehen«. Da habe ich geweint. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich wieder geweint. Ich habe gespürt, wie sich die Tränen ihren Weg aus den Augenwinkeln über meine Wangen und Nasenflügel bis zu den Lippen bahnen, langsam wie der erste Tautropfen, der über die rauen Eisblumen perlt. Von den Lippen hat Claire meine Tränen weggeküsst. Dann ist sie gegangen. In meinen Händen halte ich die kleine Feder. An ihren Enden ist sie schon etwas ausgefranst. Die schmale Außenfahne der Feder ist hellbraun, die breite Innenfahne weiß. »Eine Schwungfeder«, hat mir Claire erklärt, als ich ihren Talisman zum ersten Mal gesehen habe. »Sie bilden die Tragflächen der Flügel, schau so«, und dann ist sie mit ausgebreiteten Armen durch das Zimmer gesegelt. Ja, gesegelt ist sie, und ich habe später mit der Schwungfeder ihren Bauch berührt. Sie hat die immer bei sich getragen, diese Feder, zwischen den Seiten ihres Notizbuches verborgen. Ich trage die Feder nun in meiner Brusttasche. Wie ein vor mein Herz gespanntes Segel. Claire wollte nicht mitkommen. Sie wollte in der Stadt bleiben und kämpfen. »Du erledigst deine Sachen und ich die meinen, so einfach ist das.« So einfach ist das aber nicht gewesen, als ich verstanden habe, dass ihre Entscheidung gefallen ist, dass ich sie nicht mehr überreden kann. Ich habe ihr eine Szene gemacht, eine Szene, die ich heute bereue. Ich habe sogar versucht, ihr Angst zu machen. Ich habe ihr gesagt, dass immer weniger Leute bereit wären, im Stadtzentrum zu bleiben und zu kämpfen. Dass sich die meisten entweder zurückziehen würden in die ländlichen Gebiete oder sich der Meute anschließen. »Alleine, mutterseelenalleine wirst du dann dastehen in dieser Stadt, und sie werden herfallen über dich, sie werden dich fangen und zwingen, zu ihnen zu gehen, ihnen anzugehören, sie werden …« Claire hat ein Glas genommen und es gegen die Wand geschmettert. Dabei hat sie gelacht und gerufen: »Startschuss! Der Startschuss ist gefallen!« Und ich habe meinen ganzen Zorn einpacken können und laut auflachen müssen. »Ach du …« Ach Claire, du fehlst mir, ich habe Angst, Angst um dich, Angst um mich. Ich weiß dich in dieser Stadt, in der es – oh, wenn ich doch nur sagen könnte – nicht mit rechten Dingen zugeht, es geht mit allzu rechten Dingen zu, in dieser Stadt, und ich weiß nicht …
»Verzeihen Sie, hier ist doch noch frei, nicht?«
Wo kommt die denn her? Seit der Abfahrt hat es noch keinen Aufenthalt gegeben. Die Bahnhöfe in den Vororten werden nicht mehr angefahren. Die meisten Menschen, die dort gelebt haben, sind weggezogen. Sie sind ausgewandert, haben sich der Meute angeschlossen oder sind ins Stadtzentrum gegangen, um zu kämpfen. Diese Person hier muss durch den ganzen Zug gewandert sein, auf der Suche nach – oh nein, nicht auf der Suche nach mir! Ich muss mir wirklich Ruhe bewahren und einen klaren Kopf.
»Ja, Sie sehen doch, ich bin allein im Abteil.«
Sie zieht ihren Koffer herein. Uralt ist der, zerbeult und zerschlissen. Er sieht aus, als wäre er in aller Eile unter dem Bett hervorgezogen und mit allem Möglichen vollgestopft worden. Ein hastiger Aufbruch, ein Aufbruch Hals über Kopf. Irgendwie sieht sie dieser Service-Person ähnlich, die mir vorhin einen Tee verkaufen wollte. Nur dass sie statt der Uniform, die an Krankenhäuser oder Altenpflegeheime erinnert, einen karierten Mantel trägt und hautfarbene Strümpfe. Sie lässt sich auf den Sitz schräg gegenüber fallen und gürtet den Mantel auf. Ihre Bluse ist blütenweiß, der Rock graugrün. Dieses Gesicht, sie hat eines dieser alterslosen Gesichter, in denen weder Freude noch Leid ihre Spuren hinterlassen haben. Es ist glatt und freundlich. Ein Schwesterngesicht. Ja, sie hat ein Krankenschwesterngesicht.
»Verzeihen Sie, wissen Sie vielleicht, wann wir in L. sein werden?«
»Um 15.36 Uhr«, antworte ich kühl und kann nicht umhin, die Kette zu bemerken, die sich, ein schmales V, eng um ihren Hals legt. Feingliedrig ist sie, diese Kette, und an ihrem Ende, das in dem hohen Ausschnitt mündet, vermute ich ein kleines goldenes Kreuz. Etwas zerstreut wirkt diese Schwester. Ihre Hände wandern unruhig auf dem rauen Rockstoff auf und ab, als wollten sie ihn glattstreichen. Es ist mir immer schon schwergefallen, ein Gespräch anzuknüpfen. Tatsächlich interessiere ich mich kaum für die Menschen, denen ich zufällig begegne. Ich beobachte sie, mache mir aus ihren Gesten, aus ihren Bewegungen einen Reim und belasse es dabei. Die Geschichten, die sie von sich erzählen, sind meistens noch banaler, noch langweiliger als jene, die ich mir über sie zusammenreime. Wahrscheinlich ist diese Mitreisende gar keine Krankenschwester. Sie lebt ein todlangweiliges Altjungfernleben als Lehrerin. In der Stadt ist sie gewesen, um sich in einer der großen Bibliotheken noch, wie sie es bestimmt nennt, aktuelle Literatur zu besorgen für ihre Provinzschule. Die Ereignisse haben sie überrascht. Natürlich hat sie mitbekommen, wie es um das Land steht. Dass die Regierung dem Druck der Meute nicht standgehalten hat, dass sie sich abgesetzt hat, bevor sie noch hat abgesetzt werden können. Dass die neue Regierung die Stadt ihrem Schicksal überlässt. Sie wird aber auch gehört haben, dass es in der Stadt noch Infrastruktur gibt, dass manche inneren Stadtteile noch völlig intakt sind. »So schlimm kann es doch nicht sein«, wird sie sich gedacht und die Reise aus der Provinzstadt in die Hauptstadt unternommen haben. Ja, und dann wird sie bemerkt haben, dass es doch schon so schlimm ist. Dass sie jeden Tag mit Kontrollen und Überfällen der Meute zu rechnen hat, auch in den angeblich noch sicheren Stadtteilen. Dass sie den Straßenkämpfen selbst auf ihren Wegen in die Prunkbibliothek nicht mehr so einfach ausweichen kann. Dass es an manchen Tagen für einige Stunden kein Wasser gibt, da die Meute versucht, das trockenzulegen, was von der Stadt noch übrig geblieben ist. Sie wird das bemerkt und schließlich Hals über Kopf das billige Hotelzimmer, das sie sich geleistet hat für ihren Aufenthalt, verlassen haben. So oder so ähnlich wird das gewesen sein. Ich frage mich, wie viel die Menschen in der Provinz überhaupt davon mitbekommen, was sich in der Stadt abspielt. Ich weiß, dass es in manchen kleineren Städten, dass es sogar in manchen Dörfern zu Aufständen gekommen ist, als sich der hagere Wicht mit dem wässrigen Blick selbst zum Kanzler ernannt hat. Um Wahlen oder vergleichbare Kindereien ist es da natürlich nicht gegangen. Gewählt worden ist schon lange nicht mehr, und an die Macht des demos, des Volkes, an die glaubt heute nur noch die Meute, die sich ihr Volk zurechtlügt, zurechtbiegt, zurechtzüchtigt. Die Aufständischen in der Provinz haben vielmehr die letzte Konsequenz aus diesem Regierungswechsel gezogen, sie haben sich noch einmal gegen die Meute aufgelehnt, um vielleicht noch ein paar andere davon zu überzeugen, sich nicht der Meute anzuschließen, dem Angstmoloch zu widerstehen. Ich erinnere mich an den Bildzyklus, den Zora schon vor Jahren begonnen hat. Sie ist damals aus der Provinz in die Stadt gekommen, um sich, wie sie mir an diesem Abend, an dem ich sie bei Claire kennengelernt habe, erzählt hat, ein Bild von den kommenden, den ihrer Meinung nach damals schon kurz bevorstehenden Ereignissen zu machen. Nun, sie hat sich viele Bilder gemacht von der Angst, die sukzessive zu regieren begonnen hat. Zuerst sind ihre Bilder sehr subtil gewesen, üppige Stadtlandschaften, in denen kleine Risse zu sehen gewesen sind, Kakteen, die wie Mauerblümchen aus den Fassaden wachsen, Menschen mit durchsichtigen Kosmonautenhelmen, die sie wie umgestülpte Goldfischgläser über ihren Köpfen tragen, Straßenränder, die an manchen Stellen ausfransen wie alte Teppiche. Mit der Zeit sind Zoras Bilder kräftiger geworden, monströser. Zeitungsschlagzeilen, die sich wie eiserne Girlanden um die Köpfe und Körper der Menschen legen, Stacheldrähte, die vor den Fenstern, den Türen der Häuser wachsen, Armeen aus Thujenhecken, die stramm habt acht stehen vor ihren Obersten, den Hausherren und -herrinnen mit den vor Angst zerbeulten Gesichtern, Menschen in zerschlissener Kleidung, die auf offener Straße liegen und verbluten, ausgesaugt und ausgelaugt, mit den typischen Bisswunden an den Hälsen. Es sind immer die gleichen Stadtlandschaften gewesen, die sie gemalt hat. Doch diese Stadtlandschaften sind immer mehr vereinnahmt worden von den Auswüchsen der Angst, die sich in ihnen breitmacht. Die Stadt ist zu einem Angstmoloch geworden, in Zoras Bildern ebenso wie in einer Realität, die mir bis heute unwirklich, ja schleierhaft erscheint. Vielleicht ist das alles nur ein böser Traum, aus dem es ein Erwachen gibt, sobald der Schleier gelüftet, sobald die Leinwand zerrissen wird. Wir werden sehen … Auf dem letzten Bild des Zyklus’, das ich bei Zora wenige Tage vor meiner Abreise gesehen habe, ist die Stadt beinahe nicht mehr wiederzuerkennen. Die Stadtruinen sind überzogen mit pechschwarzem Tran, der aus den Fensterlöchern rinnt. Die Fenster sind Augen, die Augen wässrige Sümpfe, in denen die blaugrauen Adern wie Schlingpflanzen wuchern. Der Augentran liegt auf dem zerbröckelten Bauwerk, auf den Menschen, die gebückt, gedrungen zwischen den Ruinen umherschleichen. Augensplitter liegen auf dem aufgerissenen Asphalt. Die Stadt wirkt wie ein schwarzer, tausendäugiger Dschungel, aus dem es kein Entkommen, kein Entrinnen gibt. Als ich dieses Bild gesehen habe, haben meine Augen zu schmerzen begonnen. Die dicken, blaugrauen Adern in den Fensteraugen, die verkrüppelten Äste der Schlingpflanzen in den Augensümpfen haben mir auch körperlich zu schaffen gemacht. In dem Moment, als ich meine Augen schließen, vor Zoras letztem Bild verschließen wollte, ist eine Ratte durch das Atelier gehuscht. Zora hat gelacht und gemeint, ja ja, diese Ratte wohne hier, aber auch sie habe Angst vor ihren Bildern.
»Haben Sie keine Angst?«
Ich fahre hoch. Habe ich richtig gehört? Hat meine Mitreisende, diese Lehrerinnenschwester, tatsächlich das Wort an mich gerichtet? Hat sie mir diese Frage gestellt? Ich blicke sie an. Sie sieht mich an. Ihr Gesicht ist glatt und freundlich, ihr Blick unverbindlich. Kann sie Gedanken lesen, will sie wissen, ob ich Angst habe vor Ratten oder vor Zoras Bildern?
»Wovor sollte ich Angst haben?« Meine Stimme ist belegt, sie klingt rostig. Sie sieht mich ruhig an. Nur um ihre Mundwinkel spielt ein leises, leicht spöttisches Lächeln, so scheint es mir, aber vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht sind meine Nerven doch …
»Na ja, in Zeiten wie diesen in Europa unterwegs zu sein. Und, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Sie sind doch auch eine zierliche, eine etwas fragile Person.«
Ich bin verblüfft. Zum einen wegen ihrer Stimme, die viel tiefer ist, als ich es erwartet hätte. Zum anderen wegen ihrer Bemerkung. Sie ist allein von der Provinz in die Stadt gereist mit ihren Provinzlehrerinnenerfahrungen und fragt mich, ob ich Angst habe? Mich, die die letzten Jahre in der Stadt verbracht, mich, die sich entschlossen hat, diese Reise anzutreten, um die Dokumente zu übergeben?
Ich schüttle unwillig den Kopf und sage: »Nein, ich habe keine Angst. Angst ist doch das größte Problem hier.«
»Ja, da haben Sie recht, wir müssen immer schön schauen, dass es nur nichts zum Zähneklappern gibt. Das ist ungesund.« Ihre Stimme ist jetzt die einer besorgten Pflegerin. Mit ihren Sätzen scheint sie meinen Kopf tätscheln, über meine Wange streichen zu wollen. Sie kann sich diese Worte, diesen fadenscheinigen Trost sparen. Ich setze an, um ihr zu sagen, dass ich nicht empfänglich sei für radebrechende Ratschläge und dass sie mich nicht weiter mit übergriffigen Fragen behelligen soll. Ich setze aber wieder ab, als ich bemerke, dass sie sich von mir ab- und dem Fenster zugewandt hat. Ihr Blick streunt ins Leere und scheint sich irgendwo weit hinter dem Horizont zu verlieren. Ich behalte sie im Auge. Die so plötzlich aufgetauchte Frage, das seltsame, kurze Gespräch – vielleicht muss ich die Geschichte, die ich mir von ihr gemacht habe, noch einmal revidieren, vielleicht ist sie interessanter, als ich mir gedacht, als ich sie mir ausgedacht habe. Sie spielt zerstreut mit ihrer Halskette. Der Daumen und der Zeigefinger der rechten Hand gleiten das feingliedrige, schmale V an ihrem Hals auf und ab, auf und ab. Aus dem engen Ausschnitt ihrer blütenweißen Bluse rutscht die Kette mit dem Anhänger. Nein, es ist kein goldenes Kreuz, wie ich vermutet habe. Ein glattes, grellweißes kleines Rechteck baumelt vor den Knöpfen der Bluse, von der es sich kaum abhebt. Was ist das? Ein glattpolierter Quarzstein? Elfenbein? Ich fasse mir ein Herz: »Sie haben einen sehr schönen und ausgesprochen ungewöhnlichen Anhänger …«
Sie sieht mich an. Sie lächelt und zeigt dabei ihre Zähne. Ihre Zähne sind blendend weiß und ebenmäßig. Ich überlege, wie sich eine Lehrerin oder eine Krankenschwester derart schöne Zähne leisten kann. Die Karies unserer Zeit hat den meisten Menschen zugesetzt. Die Fäulnis hat ihre Herzen und ihre Körper befallen. Bis auf die wenigen, die es sich gut gerichtet, die sich gut eingerichtet haben in diesen morschen Verhältnissen, verdienen alle im Schnitt um ein Drittel weniger als noch vor wenigen Jahren. Die Arbeitszeit hat sich verlängert. Schrittweise. Zuerst die damals noch so genannte Flexibilisierung. Dann die Zehnstundentage mit der Begründung, in der Wirtschaftskrise müssten alle etwas mehr anpacken. Dann der Zwölfstundentag. Ohne Begründung. Die Kürzungen der Sozialleistungen. Ein Arztbesuch pro Monat, chronisch Kranke müssen Kredite auf ihren Lohn aufnehmen. Die Reichen sind nicht besteuert worden. Sie haben geschröpft und abgeschöpft, während viele arbeitende Menschen die Schuld bei den Ausländern, bei den Ausländerinnen gesucht haben. Die nähmen ihnen die Arbeit weg. Die bräuchten so viele Extrazuwendungen, dass für sie, die Einheimischen, nichts mehr bliebe. Der Graben zwischen den Armen und den Reichen ist immer größer geworden, während sich eine Mehrheit auf einen Kampf der Kulturen eingeschworen hat. Die Meute, die sich damals gebildet hat, hat diesen Kampf vorangetrieben. Meldungen zum bevorstehenden Untergang des Abendlandes. Vorträge über die sogenannte Überfremdung. Schlagzeilen, in denen Andersgläubige und Anderssprachige pauschal verdächtigt und verurteilt werden. Aufenthaltsverbote in Freibädern und Parks. Brennende Unterkünfte. Die Einweisung in die Lagerzonen. Immer mehr Menschen haben sich mit diesen Methoden einverstanden erklärt. Immer mehr haben mitgemacht. Sie haben an den Fingernägeln gekaut aus Angst, aus Hunger, in ihren Mäulern sind die Zähne verfault, doch anstatt sich gegen diejenigen zu erheben, die sie ausbeuten, die sie schröpfen, haben sie sich gegen die noch Schwächeren gewandt. Und die damalige Regierung, die hat zugesehen, die hat die Hände in den Schoß gelegt und nichts gemacht. Vielleicht hat sie Däumchen gedreht oder sich gar die Hände gerieben, wer weiß das schon. Auf jeden Fall hat sie … oh nein, dieser Anhänger, dieser glatte und grellweiße Anhänger ist ein Zahn! Jetzt erkenne ich es. Um den Hals meiner Mitreisenden baumelt ein Zahn! Sie nimmt den Anhänger zwischen Daumen und Zeigefinger und hält ihn mir entgegen. Sie lacht. Ihre Zähne blenden mich.
»Jetzt werden wir gleich in L. sein«, sagt sie und erhebt sich. Sie streicht den Rock glatt und schließt den Gürtel des Mantels. Sie nimmt den Griff des alten, zerbeulten Koffers und hievt ihn aus dem Abteil. Sehr schwer muss er sein, dieser Koffer. Ich sehe, wie sie ihn durch den Gang hin zum Ausstieg zerrt. Was hat sie in diesem Koffer? Warum hängt ein Zahn um ihren Hals? Ist in dem Koffer vielleicht ein totes Tier? Oder ein toter Mensch? Hat sie aus dieser Tier-, aus dieser Menschenleiche einen Zahn herausgebrochen? Ich fahre mit der Hand über mein Gesicht. Ein kalter Schweißfilm liegt auf meiner Stirn, auf meinen Schläfen. Ruhig muss ich bleiben. Ich darf nicht in Panik geraten. Ich darf keine Angst haben. Ich atme ein, ich atme aus. Es ist nur eine verrückte Frau, die mit zu viel Gepäck in die Stadt gefahren ist. Der Zahn ist nichts anderes als ein eigenwilliges Schmuckstück. Echt oder unecht, was geht mich das an. Meine Hände krampfen sich um die Armlehnen. Mein Atem will sich nicht beruhigen. Einatmen, ausatmen. Einatmen. Es ist nichts passiert. Ausatmen. Es ist eine seltsame Reisebekanntschaft, mehr nicht. Sie wird gleich aussteigen. Ich werde sie nie mehr wiedersehen. Ich greife mir an die Brust, ich spüre die Feder, Claires Talisman. Ich nehme die Feder in die Hand. Meine Hände zittern. Ich muss doch, ich muss doch wissen, was diese Person macht. Vielleicht ist sie eine Spionin, vielleicht sind sie mir schon auf den Fersen. Ich werde das Spiel umdrehen. Ich werde diese Frau verfolgen. Ich werde aus dem Zug steigen und sie beobachten. Ich werde sehen, wohin sie geht, ich werde feststellen, zu welchem Zweck und mit welchem Auftrag sie dorthin geht. Dann werde ich wissen, ob sie mich verfolgt hat, ob sie geschickt worden ist, um mich auszukundschaften. Ich erhebe mich. Nehme die Reisetasche von der Gepäckablage und schlüpfe in den Staubmantel. Was mache ich mit den Papieren? Vor den Abteilfenstern gehen Menschen vorbei Richtung Ausstieg. Ich muss schnell und sehr vorsichtig sein. Ich lasse mich noch einmal auf den Polstersitz fallen. Die Reisetasche stelle ich auf den Sitz neben mir. Ich beuge mich mit meinem ganzen Körper hinüber zu meiner Tasche und ziehe schnell die Papierrollen zwischen den Polstern hervor. Ich stecke sie in die Tasche. Die Räder ächzen, die Bremsen quietschen. Der Zug hält.

Du wirst nun das Album Perpetuum Mobile von den Einstürzenden Neubauten abspielen. Du kannst dafür einen Plattenspieler, einen CD-Player oder dein Mobiltelefon benutzen. Du wirst die erste Nummer hören und zwischen den Zeitpunkten 2:22 und 2:41 innehalten. Du konzentrierst dich auf diese Textzeilen. Du hörst sie drei Mal. Beim dritten Mal wirst du sie schon mitsprechen können. Sage jetzt:
Das Biest ist zwar noch nicht richtig wach,
aber auch noch lange nicht hinüber,
grad erst hat es sich hin und her gewälzt
und im Schlaf mit den Zähnen geknirscht.
Diese Textzeilen werden dir dabei helfen, dich auf die nächste Geschichte zu konzentrieren. Sie wird dich in jenen schattenhaften Bereich bringen, der zwischen deinen Träumen und deinen Erinnerungen liegt. Ich zähle jetzt bis zehn. Wenn ich bei zehn angelangt bin, wirst du dich in dem Aufenthaltsraum einer Seniorenresidenz befinden. Ich sage eins, und du steigst aus dem Zug. Zwei. Du atmest tief ein. Du spürst, wie durch deinen ganzen Körper frische, klare Kleinstadtluft zieht. Drei. Du atmest aus. Die Luft strömt aus deinen Armen und deinen Beinen. Vier. Deine Arme und deine Beine werden leicht. Fünf. Dein ganzer Körper wird federleicht. Sechs. Du schwebst. Sieben. Du schwebst über den Köpfen der Menschen, die sich vom Bahnhof weg in die kleine Stadt begeben. Bei acht möchte ich, dass du die Frau mit dem schweren Koffer siehst. Ich sage nun: acht. Du fliegst über der Frau und folgst ihr zu einem Gebäude, das nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt liegt. Neun. Du lässt die Frau im Gebäude verschwinden und blickst durch eines der großen Fenster. Bei zehn wirst du ein geräumiges Zimmer sehen, mit Tapeten und Ölbildern an den Wänden. An einem der altmodisch weiß-gold-verschnörkelten Tische werden vier Damen sitzen. Sie trinken Tee und unterhalten sich. Ich sage: zehn.