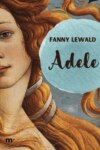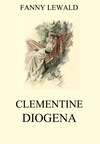Kitabı oku: «Jenny», sayfa 18
Ich fühle keinen Stolz, antwortete Jenny, nur das Bedürfniß nach seiner Liebe, die mein höchster Stolz gewesen ist. Nur seine Achtung will ich mir erhalten. Er soll nicht wie einer Unwürdigen meiner gedenken, er soll mir glauben, daß ich ihn allein geliebt habe, das ist Alles, was ich noch verlange.
Nein, sagte der Vater, wenn Reinhard nur das leiseste Verlangen nach einer Erklärung ausspräche, würde ich jedem Deiner Wünsche in dieser Rücksicht meine Billigung geben. Vor einem Manne aber, der seiner Braut die unwürdigste Wortbrüchigkeit zutraut, und weder an ihre Liebe, noch an ihre Schwüre glaubt, vor dem soll meine Tochter sich mit keiner Bitte um Vertrauen erniedrigen. Mit Reinhard’s krankhaftem Ehrgefühl, mit all seinen Forderungen hatte ich Nachsicht, denn er selbst verdiente Achtung und Du liebtest ihn, jetzt indessen scheint es mir fast eine Wohlthat, wenn ein Verhältniß sich löst, in dem Du nimmer glücklich werden konntest, sei es, daß Reinhard so gering von Dir dachte, als er es augenblicklich thut, oder auch, daß Heftigkeit sein Urtheil so ganz verblenden, ihn so ungerecht selbst gegen seine Braut zu machen vermag. Ich fordere es als einen Beweis Deiner Liebe zu mir, daß Du keinen Versuch machst, Dich mit Reinhard zu verständigen, eine friedliche Lösung Eurer Bande herbeizuführen, wenn er es nicht ausdrücklich von Dir verlangt. Du warst Reinhard’s Braut, aber Du bist auch meine Tochter; auch die Ehre Deines Vaters muß Dir heilig sein, auch ihr mußt Du ein Opfer bringen können, ja, ich fordere, daß Du es mir bringst.
Und so geschah es. Reinhard und Jenny sahen sich nicht wieder, niemals fand irgend eine Erklärung zwischen ihnen statt, und ein Brautpaar, das mit leidenschaftlicher Sehnsucht nach seiner Vereinigung gestrebt hatte, war plötzlich und auf die schmerzhafteste Weise für immer getrennt.
Still und einsam verlebte man den Sommer in Berghoff, da auch Therese einige Zeit nach diesen Ereignissen zu ihrer Mutter zurückkehrte. Sie behauptete, zu Hause nöthig zu sein, und man sah es nicht ungern, als sie selbst den Wunsch aussprach, die Freunde zu verlassen, weil ihre Anwesenheit Jenny nicht angenehm zu sein schien.
Erst spät im Jahre kehrte man in die Stadt zurück. Jenny hatte sich allmälig wieder in die Verhältnisse einzuleben, die ihr fremd geworden, da ihnen die Beziehung auf Reinhard genommen war.
Und als diesmal der Sylvesterabend erschien, der im vorigen Jahre so glückliche Menschen in ihrem Vaterhause vereinte, war die Familie allein und nahm selbst Steinheim’s Besuch nicht an, um Jenny’s schmerzliche Erinnerungen zu schonen, wennschon man mit Dank sein Bestreben erkannte, den Freunden, mit denen er die guten Stunden verlebt, auch am bösen Tage ein treuer Gefährte zu sein.
* * *
Nahezu acht Jahre waren seit diesen von uns erzählten Vorgängen entschwunden, als im Schatten der Bäume, welche sich auf der Klosterwiese in Baden-Baden erheben, an einem Junimorgen eine Dame ruhig vor ihrem Zeichenbrette saß. Es war eine kleine schlanke Figur. Lange schwarze Locken fielen auf das Papier nieder und verbargen das Gesicht der Arbeitenden; aber man war berechtigt, feine Züge zu erwarten, wenn man von ihrer schmalen Hand und dem zierlichen Fuß auf ihr Gesicht schließen sollte. Ein sechsjähriger, hellblonder Knabe spielte in einiger Entfernung und versuchte vergebens, die Aufmerksamkeit der Dame auf sich zu ziehen. Er kam endlich näher und rief: Sieh hin Tante! dort kommt der Vater mit Graf Walter. — Dann, als die Dame sich erhob, um die Kommenden zu begrüßen, sprang er fröhlich fort und bot den Herren in seinem fremdklingenden Deutsch seinen Willkomm und guten Morgen.
Ist Deine Mutter noch in ihrem Zimmer, Richard? fragte der Vater des Knaben.
Nein! antwortete für ihn die Zeichnerin, die unsere Leser wohl wieder erkannten, nein, lieber Hughes; Clara ist Ihnen mit der Wärterin und Lucy entgegen gegangen, um Ihnen von den neuesten Fortschritten zu erzählen, welche die Kleine gemacht hat. Ich wundre mich, daß Sie ihr nicht begegnet sind. Sie wollte am Goldbrünnlein auf Sie warten.
O, Schade! rief Hughes, daß wir durch die Stadt gingen und sie verfehlten. Ich will sogleich zurückkehren, sie zu holen. Sie bleiben wohl hier bei unserer Freundin, lieber Walter, und erwarten unsere Rückkehr.
Mit dem größten Vergnügen! antwortete der Angeredete, wenn ich das Fräulein nicht in der Arbeit störe!
Ach! die kann ich später beenden, sagte Jenny freundlich. Kommen Sie, Herr Graf, und beichten Sie, warum man Sie in den letzten Tagen gar nicht mehr gesehen hat?
Er that, wie sie von ihm begehrte, und Hughes ging mit seinem Knaben davon, die Mutter und das kleine Schwesterchen zu holen.
Während nun der Graf von seinen Ausflügen und Streifereien in der Umgegend erzählt, sei es uns vergönnt, mit flüchtigen Umrissen den Zeitraum von acht Jahren auszufüllen, der zwischen der ersten und zweiten Hälfte unserer Erzählung liegt.
* * *
Der Schmerz über die Trennung von Reinhard hatte Jenny’s Seele in ihren innersten Tiefen erschüttert und sie prüfend in ihr eigenes Herz blicken lassen, um dort einen Grund für Reinhard’s ihr unerklärliches Betragen zu finden. Es schien ihr leichter, Unrecht zu haben, sich selbst eines Fehlers zu zeihen, als Reinhard eine Schuld beizumessen: denn wahre Frauenliebe klagt lieber sich, als den Geliebten an. Nun ist das menschliche Herz recht eigentlich der Acker, den man nur zu durchwühlen braucht, um die köstlichsten Schätze zu entdecken. Auch Jenny fand deshalb in sich, statt des Unrechts, das sie in ihrem Herzen suchte, die Kraft, das Leben zu ertragen, es trotz seiner Schmerzen zu lieben. Sie gewann es über sich, fremdes Glück und Leid zu dem ihren zu machen und in der Hingebung an Andere, an ihre Freunde, Trost für einen Verlust zu finden, der ihr unersetzlich schien.
Als Herr Meier sie so weit beruhigt und fähig sah, sich durch den Wechsel äußerer Gegenstände zerstreuen zu lassen, machte er den Vorschlag zu einer Reise, die im Beginn des Frühjahrs angetreten wurde. Man ging nach dem südlichen Frankreich, verlebte einen Winter in Paris und besuchte Italien im folgenden Jahre. Hier war es, wo Jenny den Maler Erlau wiederfand, dessen Name aus der Ferne ruhmvoll erklungen war, und dessen treffliche Arbeiten sie in Paris zu bewundern Gelegenheit gehabt hatten.
Das Wiedersehen war ein Augenblick tiefer Bewegung für Beide. Erlau, seinem Vorsatz getreu, hatte außer aller Verbindung mit seinen Freunden gelebt; er wähnte Jenny längst mit Reinhard verheirathet und die Entdeckung des Gegentheils erfüllte ihn mit Hoffnung. Von der Stunde an wurde er Jenny’s unermüdlicher Führer in der Wunderwelt, die sich in Italien vor ihren Augen erschloß und die ihren vollen Zauber auf zwei so lebhaft fühlende Menschen auszuüben nicht verfehlte. Aber nicht lange sollte Jenny diese Freude ungetrübt genießen. Sie gewahrte mit Sorge, daß Erlau’s Leidenschaft für sie nicht erloschen sei, daß sie jetzt in dem täglichen Beisammensein wieder heftig entbrannte und sich von Hoffnungen nährte, die Jenny nicht zu erfüllen vermochte. Dies veranlaßte die Ihren, auf Jenny’s Wunsch Italien zu verlassen, und rief Erlau’s Erklärung hervor, daß auch er entschlossen sei, der befreundeten Familie zu folgen und bald in seine Heimath zurückzukehren. Je weniger Jenny dieses erwartet hatte, um so mehr hielt sie es für Pflicht, sich offen und frei gegen Erlau über ihr gegenwärtiges Verhältniß zu erklären. Sie gestand ihm, wie jetzt, kaum genesen von ihrer Herzenswunde, ihr der Gedanke an eine neue Liebe unmöglich sei. Sie beschwor ihn, um seiner und ihrer Ruhe willen, ihr nicht zu folgen. Sie sagte ihm, wie werth er ihr sei, wie sie hoffe, statt seiner Liebe einst seine Freundschaft zu erwerben, und erlangte endlich von ihm das Versprechen, daß er nach England gehen und dort in William’s und Clara’s Nähe leben wolle, da er versicherte, ohne Jenny jetzt in Italien nicht ausdauern zu können.
So trennten sie sich zum zweiten Male und Jenny kehrte nach einer Abwesenheit von anderthalb Jahren in ihre Heimath zurück. Hier fand sie in den äußern Verhältnissen nur wenig verändert. Ihr Bruder ging ruhig und ernst die Bahn, welche er sich vorgezeichnet hatte. Geschätzt und unermüdlich in seinem ärztlichen Beruf, hatte er zugleich unverwandt das Wohl und den Fortschritt seines Volkes im Auge, dessen freie Entwicklung aber nur dann möglich war, wenn überhaupt eine freie, zeitgemäße Verfassung in seinem Vaterlande Raum fand. Sein eifriges Bestreben, zur Erreichung dieses Zieles beizutragen und, der Gesammtheit nützend, zugleich sein Volk zu erlösen, verband ihn mit vielen Gleichgesinnten aus allen Ständen. Die Besten des Landes erkannten seine Fähigkeit und die große Uneigennützigkeit seines Charakters an; denn die Hoffnung, nach erlangter Emancipation der Juden, für sich selbst Würden und Ehrenstellen zu erwerben, hatte ebenso wenig Einfluß auf ihn, als die Furcht vor jenen Verantwortungen, denen sein kühnes Wort und seine freisinnigen Schriften ihn bereits häufig unterworfen hatten. Ihm genügte sein Bewußtsein und die achtende Anerkennung seiner Mitstrebenden. — Noch immer lebte er in seinem väterlichen Hause. Sei es, daß seine Thätigkeit ihn so ganz hinnahm und ihn sein Alleinstehen nicht fühlen ließ, oder daß er kein Mädchen gefunden hatte, das seine Neigung erregte, er war unverheirathet geblieben.
Den Eltern Clara’s, welche sie scheidend seiner Sorgfalt empfohlen, war er ein treuer und geschätzter Freund geworden. Ihm, das wußten sie jetzt, verdankten sie das Glück ihrer Tochter, das in einer vollkommen übereinstimmenden Ehe mit William immer schöner erblühte. In Eduard’s Brust schüttete die Commerzienräthin ihren Kummer über das Schicksal ihres Sohnes aus, der unstät Deutschland und Frankreich durchstreifte und, von seiner Frau beherrscht, ein unwürdiges Leben führte. Ferdinand fühlte bereits das Elend und die Schande, in die er sich gestürzt hatte, aber er war zu schwach, die Sklavenketten zu brechen, die ihn entehrten. Auf den ausdrücklichen Wunsch der Horn’schen Familie war Eduard mit ihm in Verbindung getreten, und da es ihm gelungen, Ferdinand’s Vertrauen zu gewinnen, gab er die Hoffnung nicht auf, es werde ihm einst möglich sein, den Verlornen seiner Familie wiederzugeben.
Mit herzlicher Freude empfingen Eduard und der treue Joseph die heimkehrenden Lieben. Der Anblick jener Räume, in denen sie so glücklich gewesen und so viel gelitten hatte, erweckte in Jenny’s Brust die wehmüthigsten Erinnerungen, und sobald sie sich mit Eduard allein sah, wagte sie, nach Reinhard zu fragen, was sie in ihren Briefen nie gethan hatte. Sie wußte, daß er sein Amt angetreten hatte und die verdiente Liebe und Achtung seiner Gemeinde besaß. Das hatte ihr Therese mitgetheilt, deren Mutter bald nach der Abreise der Meier’schen Familie gestorben war. Seit aber Therese eine Gouvernantenstelle auf dem Lande angenommen, hatte Jenny auf einige Briefe, die sie ihr schrieb und in denen sie ihr die freundschaftlichsten Anerbietungen machte, keine Antwort erhalten. Um so unerwarteter traf sie die Nachricht, Therese habe durch Vermittlung der Pfarrerin jene Stelle, ganz in der Nähe von Reinhard’s Wohnort, erhalten, und sich vor wenigen Wochen mit ihm verlobt.
Als Jenny dies erfuhr, zog ein trübes Lächeln um ihren Mund, und Eduard drückte ihr schweigend die Hand. Er und Joseph schienen sich jetzt Jenny’s Zufriedenheit gleichsam zum Zweck ihres Lebens gemacht zu haben; und in beglückender Eintracht, in friedlicher Ruhe schwanden der Familie einige Jahre nach ihrer Rückkehr still dahin. Treffliche Männer hatten sich um Jenny werbend ihr genaht, die Wünsche von Jenny’s Eltern hatten sie unterstützt, aber kein Erfolg ihre Bemühungen gekrönt. Wagte die besorgte Liebe ihrer Mutter, ihr ja zuweilen Vorstellungen deshalb zu machen, so bat Jenny, man möge Nachsicht mit ihr haben, denn es sei ihr unmöglich, die Wünsche zu erfüllen, die man für sie hege. Ich bin ja zufrieden und glücklich, liebe Mutter! sagte sie dann; ich habe Dich, Vater, Eduard, Joseph und Alles, was nur irgend mein Herz begehrt an Liebe und Schonung. Würde ich das in dem Hause eines Mannes finden, den ich nicht liebte? Und da alle Zumuthungen und Gespräche dieser Art Jenny sichtlich für längere Zeit verstimmten, war es endlich der Vater selbst, der seiner Frau anrieth, nicht in Jenny zu dringen, sondern ruhig eine Zukunft zu erwarten, in der die Erinnerung an Reinhard ihren Einfluß auf Jenny verloren haben und die Vorschläge ihrer Freunde leichter Gehör bei ihr finden würden.
Aber diesen Zeitpunkt sollte die Mutter nicht erleben; ein plötzlicher, schmerzloser Tod entriß sie ihrer Familie. Wie tief der Verlust empfunden wurde, wie er die Engverbundenen nur noch fester aneinander schloß, wie Jeder die Lücke auszufüllen strebte, die dadurch in den Herzen der Andern entstanden war, bedarf kaum einer Erwähnung. Nun stand Jenny allein an der Spitze ihres Hauses, auf sie war ihr Vater gewiesen. Dies Bewußtsein erhob sie in ihren eigenen Augen und tilgte jeden andern Wunsch aus ihrem Herzen, als den, für ihren Vater zu leben und sein Alter zu verschönen. Jene religiösen Zweifel, welche einst das Glück ihrer ersten Jugend untergraben hatten, waren längst und glücklich besiegt. Eigenes Nachdenken und der Beistand der Ihren hatten sie zu dem Standpunkt einer Gottesverehrung geführt, zu dem ihre ganze Erziehung sie hingeleitet hatte. Geistig frei und mit klarstem Bewußtsein, die zärtlichste Tochter, der Trost aller Leidenden und doch wieder die heitere, geistreiche Wirthin ihres gastfreien, väterlichen Hauses, so erschien Jenny, nachdem der Schmerz über den Tod ihrer Mutter sich gemildert hatte. So finden wir sie auch einige Wochen nach ihrer Vereinigung mit Clara in Baden wieder.
Der Wunsch, sich zu sehen, war bei beiden Freundinnen gleich mächtig geworden, doch hatten Umstände mancher Art die Erfüllung desselben bis jetzt unmöglich gemacht und mit wahrer Freude trafen sie nach achtjähriger Trennung in Baden-Baden zusammen. Dort hatte man sich rendez-vous gegeben und wollte später gemeinschaftlich in die Heimath der Damen zurückkehren, um Clara’s beide Kinder den Großeltern vorzustellen. Anfänglich sollte auch Erlau, der sich ganz in England angesiedelt und dort eine ehrenvolle Stellung erworben hatte, William nach Deutschland begleiten. Die unruhige, rasche Lebhaftigkeit des Jünglings war aber in dem Manne nicht erloschen und er hatte den Wunsch, sein Vaterland und seine Freunde zu sehen, aufgegeben, um sich einer englischen Gesandtschaft nach dem Orient anzuschließen, bei der sein Hang für das Ungewöhnliche volle Befriedigung zu finden hoffen durfte.
Die beiden befreundeten Familien hatten nun, sobald sie in Baden angelangt waren, absichtlich ihre Wohnung außerhalb der eigentlichen Stadt genommen, um allein in dem Besitz des gemietheten Hauses und in der freien, ländlichen Natur zu sein. Man wollte sich selbst leben und Jenny war gar nicht damit zufrieden, als William ihr gleich nach ihrer Ankunft erzählte, wie er in einigen Tagen einen Freund, den Grafen Walter, erwarte, den er ihr als einen Genossen für die Zeit ihres Aufenthalts in Baden ankündigte.
Graf Walter gehörte einer der ältesten Familien Deutschlands an. Wie die meisten Jünglinge seines Standes früh in das Militair getreten, war er mit seinem Regiment in die Vaterstadt Clara’s gekommen und in ihrem elterlichen Hause fast mit allen Personen unserer Erzählung bekannt, mit Hughes befreundet geworden. Später hatte er den Dienst verlassen, bedeutende Reisen gemacht und war, um sich zur Uebernahme seiner Güter in landwirthschaftlicher Beziehung vorzubereiten, auch nach England gegangen, wo er aufs Neue mit William und Clara zusammen getroffen war. Auf ihre Bitten war er ihr Gast geworden, so lange er in England verweilte, und noch jetzt rechnete er die Zeit, welche er mit ihnen, theils in London, theils in ihrem Landhause verlebt hatte, zu den anmuthigsten Erinnerungen seines genußreichen Lebens. Nichts konnte ihm also willkommener sein, als die zufällige Begegnung mit jenen Freunden an den Ufern des Rheines; und unabhängig, wie er es in jeder Beziehung war, ließ er sich bereitwillig finden, den Sommer mit ihnen in Baden zuzubringen.
Jenny hatte er früher nur flüchtig gesehen, aber obgleich er sie nicht näher kannte, erinnerte er sich dunkel, von ihrer Liebe zu einem jungen Theologen sprechen gehört zu haben. Jetzt hatte er von Clara, auf sein Anfragen, nähere Auskunft über Jenny und die Lösung jenes Verhältnisses erhalten und war, durch Clara’s und William’s Erzählungen, gespannt auf die Bekanntschaft eines Mädchens geworden, an dem beide Gatten mit solcher Liebe hingen. Trotz der günstigen Vorurtheile aber fand er doch in Jenny bald noch mehr, als er erwartet hatte; und sie sowohl als ihr Vater wußten es William sehr bald Dank, den Grafen für ihren kleinen Kreis gewonnen zu haben, da auch ihnen der Umgang des hochgebildeten Mannes große Freude gewährte.
* * *
Nachdem Walter an jenem Morgen Jenny den verlangten Bericht abgelegt, bat er um die Erlaubniß, die Arbeit zu besehen, mit der sie sich beschäftigt hatte, als er ankam. Bereitwillig nahm sie ihr Skizzenbuch wieder vor und zeigte ihm eine Gruppe von Bäumen, die sie am Tage vorher in der Nähe des kleinen Wasserfalls entworfen hatte.
Ich kann es nicht ausdrücken, sagte Jenny, wie ich diese schönen, großen Bäume liebe. Sie geben mir immer ein Bild unsers Lebens, das fest in der Erde gewurzelt, doch sehnsüchtig himmelan strebt; und in dem Spiel der sonnenbeschienenen Blätter liegt außerdem für mich ein hoher Genuß. Die schönsten Träume meiner Kindheit, die rosigsten Märchen gaukeln an mir vorüber, und alle Wunder der Feenwelt scheinen mir möglich, wenn ich das flüsternde Kosen der Blätter höre.
Das ist eine ächt deutsche Empfindung, bemerkte Walter, die ich vollkommen begreife und mit Ihnen theile. Ich bin so glücklich, in meinem Park die herrlichsten Eichen zu besitzen, und weiß meinen Voreltern Dank, die mir jene Bäume gepflanzt. Auch für mich sind sie eine Quelle immer neuen Genusses, wie die ganze Natur, die uns umgibt. Sie schreitet mit uns fort, sie lebt mit uns, sie hat Antwort für unsere Fragen, und es ist für mich das Zeichen eines wahren Dichters, wenn er die Sprache versteht, welche die Natur in seinen Tagen zu den Menschen spricht.
Glauben Sie denn, fragte Jenny, daß die Einwirkung der Natur auf das Gemüth des Menschen nicht zu allen Zeiten dieselbe blieb?
In so fern gewiß, antwortete der Graf, als sie immer die höchsten, heiligsten Empfindungen seiner Seele anregt. Aber je nachdem diese Gefühle sich im Laufe der Zeiten ändern, wechselt auch der Eindruck, den sie auf uns macht. Der heitre Grieche sah in den schönsten Bäumen seines Waldes liebliche Dryaden, die ihn mit Liebe umfingen. Dem deutschen Mittelalter predigten sie den Ernst, der auch in den düstern Domen gelehrt wurde, sie sprachen ihm von dem Kreuz, das aus ihrem Holze gezimmert worden ...
Und uns? fragte Jenny lebhaft.
Uns weisen sie hinauf in die Region der Klarheit, uns predigen sie Freiheit und Licht mit ihren himmelan strebenden Zweigen, sagte Walter mit schöner Erhebung, und eben deshalb hoffe ich, wir werden nun endlich auch eine Menge veralteter, stereotyp gewordener Bilder los werden, von denen viele mir geradezu verkehrt erscheinen und schädlich wirken.
Verkehrt? wiederholte Jenny, wie meinen Sie das? und welche Bilder rechnen Sie dazu?
Walter sann einen Augenblick nach, dann sagte er: Um gleich eines der gewöhnlichsten zu nennen: Das Bild des Baumes und des Schlingkrautes für die Ehe. Sie glauben nicht, wie müde ich dieser starken Eichen bin, an die sich zärtlich der Epheu anschmiegt; der Ulmen, an denen die Rebe sich vertrauend emporrankt. Leider ist es in vielen Ehen so wie in dieser Naturerscheinung. Es gibt Bäume und Männer genug, die in angebornem Naturtrieb hoch und kühn emporstreben und sich von einer kümmerlichen Pflanze umrankt finden, die weder sie zurückzuhalten noch sich aufzuschwingen und zu gedeihen vermag in einer Höhe, für die sie nicht geschaffen ist! Aber schlimm genug, daß es so ist, und kein Dichter dürfte dies Bild brauchen, wenn er das Ideal schildern will, das von dieser innigsten Vereinigung in uns lebt. Das Gleichniß ist falsch! schloß er und sah verwundert auf Jenny, die, während er gesprochen, den Stift aufgenommen hatte und mit dem größten Eifer zeichnete. Nach einigen Minuten reichte sie dem Grafen, der über ihre scheinbare Zerstreutheit ein wenig verletzt und schweigend neben ihr saß, ihre Zeichnung hin und fragte: Und so, Herr Graf! befriedigt dieses Gleichniß Sie?
Sie hatte mit kunstgeübter Hand eine vortreffliche Skizze entworfen. Zwei kräftige, üppige Bäume standen dicht nebeneinander, frisch und fröhlich emporstrebend, mit eng verschlungenen Aesten. Darunter las man die Worte: »Aus gleicher Tiefe, frei und vereint zum Aether empor!«
Walter betrachtete das kleine Bild mit Freude; sah dann mit einem Ausdruck hoher Bewunderung in Jenny’s glühendes Gesicht und sagte: So vermag man nur das wiederzugeben, was tief empfunden in uns selbst lebt. Schenken Sie mir dies Blatt, als Zeichen, wie unsere Gesinnung in dieser Beziehung übereinstimmt. Ich bitte, lassen Sie es mir!
Nein! antwortete Jenny, wenn Ihnen die kleine Zeichnung gefällt, wenn sie Ihnen richtig scheint, werden Sie es natürlich finden, daß ich sie meinen schönen Vorbildern zueigne; daß ich sie Clara gebe, welche eben mit ihrem Manne und den Kindern über die Brücke kommt. Auch mein Vater ist mit ihnen! Lassen Sie uns ihnen entgegengehen.
Es war ein gar erfreulicher Anblick, die Familie zu sehen, als sie über die Wiese dahinschritt. William nun gegen das Ende der dreißiger Jahre, war ein Bild selbstbewußter, kräftiger Männlichkeit geworden. Er und die blühend schöne Mutter führten die kleine Lucy in ihrer Mitte, die seit einigen Tagen die ersten Versuche machte, auf den eigenen Füßchen fortzukommen, und mit aller Gewalt dem Bruder nachlaufen wollte, der fröhlich jubelnd voransprang. Man konnte kein anmuthigeres Bild ehelichen Glückes finden und Walter’s Augen suchten Jenny, die plaudernd am Arme ihres Vaters hing und nur allein mit ihm beschäftigt war.
Nachdem man sich niedergelassen und eine lange Zeit mit den lieblichen Kindern vertändelt hatte, sagte William zu Walter: Ich habe gewünscht, daß wir alle beisammen wären, ehe ich Ihnen einen Plan enthülle, den ich schon seit einigen Tagen in mir ausgebildet habe. Ich wollte Ihnen vorschlagen, jetzt, wie einst in England, unser Hausgenosse zu werden, um die flüchtige Zeit unsers Beisammenseins recht zu genießen. Sie finden Raum genug bei uns und sollen durchaus nicht genirt sein. Auch für Ihre Dienerschaft, Ihre Equipage ist hinreichend Platz, und wie sehr es mich erfreuen würde, Sie wieder einmal als meinen Gast zu sehen, bedarf keiner Versicherung.
Der Vater vereinte seine Bitte mit William’s, und ohne lange zu überlegen, nahm Walter den Vorschlag unbedingt und mit sichtlichem Vergnügen an. Man machte Entwürfe, wie man sich einrichten wolle, um so viel als möglich mit einander zu sein und doch Jedem die nöthige Ruhe und Freiheit zu gönnen, ohne welche auf die Länge kein behagliches Dasein denkbar ist; und man trennte sich erst, nachdem man übereingekommen war, Walter solle noch im Laufe des Tages sein Hotel verlassen, um sich gleich heute bei seinen Freunden einzurichten.
Als er fortgegangen war, bemerkte Jenny: Mir hat die Art sehr gefallen, mit der Walter William’s Erbieten annahm. Ein Anderer hätte vielleicht Einwendungen gemacht, das Bedenken geäußert, er könne beschwerlich sein, und zuletzt sich in Danksagungen erschöpft, wenn er die Einladung angenommen hätte. Von dem Allen that er nichts. Er dachte offenbar im ersten Augenblick nur daran, ob es ihm selbst zusagend sei; dann, als er sich davon überzeugt hatte, sagte er, ohne weitere Umstände: Ich komme mit großer Freude, wenn Sie mich haben wollen! und doch lag gerade in dieser Einfachheit für mich etwas besonders Angenehmes.
Das ist es auch! bestätigte der Vater. Es spricht sich darin ein festes Zutrauen zu dem Freunde und zu sich selbst aus; die Ueberzeugung, er wisse, wie willkommen er seinen künftigen Wirthen sei, und die Versicherung, er sei ihnen gern verpflichtet. Ueberhaupt charakterisirt sich ein edles Gemüth, ein freier, durchgebildeter Sinn am meisten in der Art, mit welcher man Dienste empfängt und Gefälligkeiten annimmt. Sie auf eine schickliche Weise zu leisten, erlernt Mancher.
Ach! auch das ist nicht jedes Menschen Sache! wandte William ein. Wie oft erdrückt man uns mit der Art, in der man sich uns dienstwillig und gefällig zeigt!
Eben weil man es nicht ist! erwiderte der Vater. Weil man sich das für eine Tugend, für eine Pflichterfüllung, oder gar für ein Opfer auslegt, was dem wohlwollenden Sinne ganz einfach und natürlich erscheint. Wer bereit ist, Andern zu dienen und gefällig zu sein, wer empfunden hat, wie viel Freude darin liegt, der gönnt diesen Genuß auch den Uebrigen und nimmt Hülfsleistungen und Gefälligkeiten so gern und unbefangen an, als er sie erzeigt. Er weiß, daß Geben seliger sei als Nehmen, und daß die Befriedigung des Gewährenden gewiß ebenso groß ist, als die des Empfangens. Darum habe ich Vertrauen zu Personen, die mit guter Art anzunehmen verstehen, ohne den innerlichen Vorbehalt, durch einen Gegendienst bald möglichst quitt zu werden oder zu vergelten. Dies Vertrauen hat mich fast niemals betrogen und findet in Walter auf’s Neue seine Bewährung. Damit aber auch er sich nicht getäuscht finde, lassen Sie uns selber danach sehen, daß Alles für ihn bereit sei, wenn er kommt.