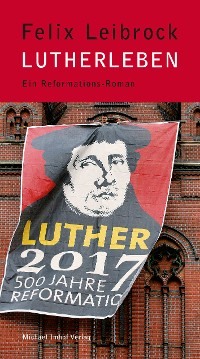Kitabı oku: «Lutherleben», sayfa 3
V
„Na, Rosemarie, was guggsche dann so traurisch?“
Renate Omlor sah der Campingplatzbetreiberin ihre Sorgen an. Es war Freitagabend, ein heißer Sommertag ging zu Ende. Die Terrasse der Seeklause war bis auf den letzten Platz gefüllt. Nasik, die aus Armenien stammende Aushilfe mit den rehbraunen Augen, trug in luftigem Kleid Dutzende Krüge mit frisch gezapftem Bier zum durstigen und lebhaft sich unterhaltenden Campingvolk. Untermalt wurde der Geräuschpegel von CD-Musik. Die Flippers, Ute Freudenberg, Udo Jürgens.
„War schön, wenn manchmal Monsieur Wolle ier gespielt at!“, versuchten die Beauchamps aus Metz, Rosemarie ins Gespräch zu ziehen.
„Dass kannsche laud saan“, pflichtete Richard Omlor bei, der wie alle Saarländer ungeniert in vollem Dialekt sprach. „Wenn der Wolle sei Schiffaklawier ausgepaggd hadd, do is die Poschd abgang, aba gewaldisch!“
Rosemarie stocherte mit dem Löffel abwesend in ihrem Sex on the Beach. Eine Ärztin und eine Schwester Petra von der Reha-Klinik hatten sie angerufen. Sie war schockiert. Darüber zu reden, fiel ihr schwer. Sie schämte sich ein wenig. Was sollten die anderen von Wolle denken, wenn sie das hörten? Andererseits lief die Zeit in der Reha-Klinik ab, in einer Woche kam er zur Blauen Bucht zurück. Die Brüche, Prellungen, alles war geheilt. Nur die posttraumatische Belastungsstörung war geblieben und die Ärzteschaft stand vor einem Rätsel. So wenig er sich an sein Leben vor dem Unfall erinnern konnte, so präzise sprach er über Luthers Lieder. Dass er von sich behauptete, Martin Luther selbst zu sein, das musste doch allen auf dem Campingplatz den Eindruck vermitteln, er habe, ganz einfach gesagt, einen Dachschaden. Sie hatte keine Vorstellung, wie Wolle auf dem Campingplatz wieder arbeiten sollte, wenn er sich als Martin Luther empfand. Würde er dann wie der Reformator die Leute am Eingang mit Worten wie „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ begrüßen? Den Satz hatte sie im Internet gelesen, als sie einmal kurz das Stichwort Luther in eine Suchmaschine eingegeben hatte. Pflanzte er, nach einem angeblichen Luther-Zitat, das sie dort auch gesehen hatte, angesichts depressiver Stimmungen, von denen sein Arzt gesprochen hatte, jeden Tag einen Apfelbaum auf dem Gelände? Es war zum Heulen. Andererseits: War es nicht besser, die Stammgäste und Dauercamper ein wenig vorzubereiten, wenn Wolle bald als Reformator des 16. Jahrhunderts an der Blauen Bucht aufschlagen würde? Hinzu kam die veränderte Physiognomie, die kantigere Nase, die wulstigen Lippen, die tiefer liegenden Augen. Natürlich konnte sie das mit dem Unfall begründen, die Auszehrung, das Krankenhausessen. Aber war das wirklich glaubhaft? Schwester Petra hatte sie zur Hälfte der Reha-Zeit um ausschließlich weiße und schwarze Hemden und ebensolche Hosen in XXXL-Format gebeten. Wolfgang Trödler weigerte sich, in Holzfällerhemden oder Jeans herumzulaufen. Das sei seiner Würde als Geistlicher nicht angemessen. Außerdem stopfte er sich die Hemden nicht mehr in den Hosenbund, sondern trug sie offen, wie ein priesterliches Gewand. Nur so, so habe er gesagt, brachten ihm die Mitpatienten mehr Respekt entgegen. Auch fragte er bei der Klinikleitung an, ob man eine Näherei beauftragen könne, ihm sein Zeichen, die Lutherrose, auf alle Hemden und die Gesäßtaschen der Hosen zu nähen. Ein Lazarus Spengler habe ihm 1530 eine Zeichnung dieser Lutherrose auf die Veste Coburg geschickt, während der Verhandlungen auf dem Augsburger Reichstag. Er, Wolle alias Luther, habe die Rose später zu seinem Siegel gemacht.
Rosemarie starrte nach all diesen Mitteilungen ihr Mobiltelefon an. War sie in irgendeine Versteckte-Kamera-Sendung geraten? Vielleicht gibt sich die Schwester am anderen Telefon als Mitarbeiterin eines Fernsehsenders zu erkennen und der ganze Spuk ist vorbei, hoffte sie. Doch nichts davon geschah. In ihrer Not bat sie den Zivi bei einem seiner Stadtgänge, ihr eine leicht verständliche Luther-Biographie aus der Buchhandlung mitzubringen. Sie las gebannt die ersten Seiten über das Leben des Reformators und wusste schon bald mehr über dessen Kindheit als über die ihres Lebensgefährten. Etwas Hoffnung keimte in ihr auf, auf diesem Wege vielleicht auch ein wenig über Wolles Vorleben zu erfahren. Ich muss die schwierige Situation annehmen, sagte sie sich, und das Beste daraus machen.
„Ei, ich glaab“, ergänzte Heinz Ruffing, „dass med dem Wolle is nur voriewergehend. Wenn der widder e Zeidlang unner uns is, dann werd der sich aach widder erinnere.“
Schön wäre es, sagte sich Rosemarie. Dass Wolle keine Erinnerung mehr hatte, das hatte sie den befreundeten Campern erzählt. Aber der Anruf heute, der war eine noch viel größere Zumutung für alle. Sie zog noch einmal einen kräftigen Schluck aus dem Cocktailglas.
„Wolle leidet an einer multiplen Persönlichkeitsstörung“, sagte sie halblaut. Die etwas weiter am Tisch wegsitzenden wie Renate Omlor und Hilde Ruffing beugten sich ganz weit zu ihr hin. „Er weiß zwar nichts mehr von seiner eigenen Geschichte, glaubt aber, ein anderer zu sein.“
„E annerer?“, hakte die rotbackige Hilde Ruffing vorsichtig nach und holte sich einen Zigarillo aus dem Etui, „saa nur!“
„Loss mich roode“, ging Richard Omlor dazwischen, „ich saan emol, er glaabt, er is de Papschd!“
Rosemarie Aicher sah verblüfft auf den Saarländer, der immer so einfältig daherkam.
„Gar nicht so weit weg!“, entgegnete sie. Sie musste sogar ein bisschen schmunzeln.
Das Schmunzeln blieb nicht unbemerkt und ermutigte die anderen zu einem munteren Rätselraten.
„Ei, vielleischd iss er jo enner von denne Prieschder, die sich do an denne Kinner vergang hann“, spekulierte Hilde Ruffing vor sich hin, „er had bestimmd das Gefiehl, Schuld ze sinn an dem Unfall. Unn weil er in de Zeidung vor dem Unfall von denne Prieschder gelees had, iss dass in seim Kopp hänge geblieb unn deswee glaabt er a, eener von denne zu sinn.“
„Isch saan emool, er glaabt, er is de Jürgen Fliege“, sprang Heinz Ruffing auf den Zug auf.
So ging es noch eine Weile weiter. Es fielen Namen wie Eugen Drewermann, Margot Käßmann und Bischof Mixa.
„Er meint, er ist Martin Luther!“
Der Satz Rosemarie Aichers saß. Stille trat ein und Albert Beauchamp hielt sich instinktiv am Tisch fest.
„Noch eine Runde?“
Nasik, die Bedienung, sah etwas verwundert auf die stumme Versammlung.
„Jetzt brauchen wir alle einen Cognac, oder?“, rief Hans-Peter Schmitz und nickte Nasik zu.
Es ist raus, sagte sich Rosemarie erleichtert. Die Campingfreunde fanden allmählich wieder Worte und debattierten, wie man ihn wohl empfangen solle. Man könne ihn wie Martin Luther begrüßen und ihn als Reformator anerkennen, meinten die einen. Andere schlugen vor, ihn in seiner neuen Identität auf den Arm zu nehmen, bis er selbst über sich lachen müsse. Dann platze der Knoten und er sei wieder der alte Wolle. Von Seiten des Ehepaars Schmitz aus dem Rheinland kam der Vorschlag, Ablassbriefe auszustellen.
„Wir bieten einen Sündenerlass gegen Zahlung an, wie vor 500 Jahren“, begeisterten sich die Rheinländer, „die Briefe bieten wir dann dem Wolle an. Das reizt den als Martin Luther dann so dermaßen, dass er austickt. Der bricht zusammen, emotional und so. Und dann findet er aus seiner Rolle heraus!“
Rosemarie zweifelte an solchen hobbypsychologischen Überlegungen. Auf der anderen Seite freute sie sich, mit ihrem Problem nicht allein zu sein. Auf die Camper-Freunde war wenigstens Verlass. Die Ärzte und Psychologen der Reha-Klinik hatten mehr oder weniger resigniert. Sogar die Hoffnung, die Erinnerung an das Akkordeon sei ein erster Schritt auf dem Weg ins alte Leben, hatten sie ihr zerstört: Die Musiktherapeutin hatte, wie man ihr mitteilte, Wolle auf das Akkordeon hingewiesen. So wie er weiterhin wusste, wie man eine Gabel und ein Messer benutzte, so fand er sich auf dem Akkordeon zurecht. Nur dass er statt dem Schneewalzer und den lustigen Holzhackerbuam jetzt Neubearbeitungen des Dies irae, dies illa spielte.
Nasik brachte die Runde Cognac. Das gemeinsame Gespräch löste sich auf. Renate Omlor setzte sich direkt neben Rosemarie und flüsterte geheimnisvoll. Sie lenkte das Gespräch gezielt auf ein anderes Thema, nachdem sie bemerkt hatte, wie Wolles Verwandlung am Nervenkostüm der Campingplatzbetreiberin zehrte.
„Kennsch du e Liesel aus Leuna? So e Gelifdedie und Blondierdie?“
Sie habe diese Frau im Verdacht, ihren Mann, den Richard, zu bezirzen, führte Renate aus und rollte die Augen, sie glaube, diese Liesel sei mannstoll. Und ihr Richard, der sei ihr in gewisser Weise hörig. Schämen solle sich diese Frau, verheiratete Männer anzumachen. Die Männer interessierten sie eigentlich gar nicht. Der Reiz für diese Liesel sei es, andere Frauen zu demütigen. Sie wolle nur zerstören. Das verschaffe ihr ein Triumphgefühl.
„Abba lang loss ich mir das nimie gefalle“, wechselte sie in einen drohenden Ton, „ich hann e Plan, wie ich die ferdisch mach!“
„Ach Renate“, entgegnete Rosemarie und atmete tief durch, „ich wäre froh, ich hätte nur solche Sorgen.“
VI
Die Reha-Klinik war kein Gefängnis. Dennoch mussten die Patienten, wollten sie das Klinikgelände verlassen, einen Antrag stellen. Ein einfaches Formular reichte dazu aus. Man musste wissen, wo die Patienten waren. Für den Fall eines Falles.
Sonntagmorgen, von der Stadt her waren die Glocken der Friedenskirche zu hören. Um zehn Uhr begann dort der Gottesdienst. Trödler ging zum Stationszimmer und las den Aushang: „Klinikgottesdienst, jeden Sonntag 10.00 Uhr“. Aber er wollte nicht zu dieser Klinikseelsorgerin. Ihn zog es in die Stadt, raus aus der Klinik.
Bin im Gottesdienst. M. Luther
Er legte den Zettel der gerade abwesenden Stationsschwester auf den Tisch und begab sich auf den Weg Richtung Stadt. An der Auffahrt zur Klinik sah er mehrere Männer stehen. Nanu, was sind das für Metallkästen, an die sie sich anlehnen, wunderte er sich. „T-A-X-I“, entzifferte er laut und ging auf einen der Männer zu: „Wisset ihr, wo mein Rollwägelein ist?“ Mit einem solchen war er 1521 vom Wormser Reichstag ins Ungewisse geflohen.
„Rollwägelein?“, fragte ihn der Taxifahrer und zog an einem Zigarillo.
„Ja, auch mit einem Pferd wäre ich zufrieden.“
Der Fahrer drehte sich zu seinen Kollegen und imitierte mit einer Hand den Scheibenwischer vor seinem Kopf.
„Ein Pferd will er haben, so so. Na ja, ich habe unter meiner Haube hier 160 Pferde.“
Ungläubig starrte Luther den Mann an, der die Haube öffnete. Der Motor war gut gepflegt.
Dunkel erinnerte er sich an die Fahrt in die Reha-Klinik. Vor Antritt hatte man ihm einen schweren Trunk verabreicht, so dass er den Transport komplett verschlafen hatte.
160 Pferde, hier will sich jemand über mich lustig machen, sagte er sich. Im selben Moment kamen undefinierbare Geräusche aus dem Taxiinnern. Ein Pfeifen und Knattern, dann Worte wie „Otto 3 an Friedrich 1“.
Unglaublich, sagte sich Luther, die alten Kaiser leben also auch noch. Nur als Friedrich 1 aufgefordert wurde, eine alte Frau mit Namen Ilse Beinert zum Einkaufen zu fahren, war er verwirrt. „Das ist die alte Dame mit dem vielen Trinkgeld“, knatterte die Stimme. Der Mann warf die Haube zu, den Zigarillo in den Straßengraben und rief: „Ab, schnell ins Auto!“ Er drückte ein paar Knöpfe und fuhr davon. Fuhr der Stauferkaiser jetzt Metallkasten und rauchte braune Stangen?
„Huch“, rief er laut, als der Wagen ihm beinahe über die Füße fuhr. Jetzt erst sah er auf der Straße vor der Klinik ganz viele dieser Metallkästen fahren, ohne die Schilder auf dem Dach und an den Seitenteilen. Sollten sie die Rollwägelein abgelöst haben? Im Inneren sahen sie jedenfalls bequemer aus als sein Gefährt mit der Holzbank. Wie war er da immer hin und hergeworfen worden, wenn der Kutscher die Pferde mit der Peitsche über die Untiefen und durch die Schlammlöcher jagte!
Kopfschüttelnd stolzierte er weiter. Das schwarze Baumwollhemd, das er über der Hose trug, und sein wiegender Schritt gaben ihm etwas Erhabenes, Weihevolles. Auf dem Weg die Straße abwärts Richtung Friedenskirche begegneten ihm zwei perlenkettenbehängte Damen, die er freundlich grüßte. Während er weiterging, blieben die beiden Damen stehen und eine flüsterte: „Jesus, wer war jetzt das? Sieht ja aus wie ein Kirchenvater!“
Der Gottesdienst in der Friedenskirche war spärlich besucht. Trödler saß ganz weit hinten. Der Aufforderung des Pfarrers, sich doch weiter vorne zu platzieren, damit man eine bessere Gemeinschaft sei, folgte er nicht. Der Pfarrer, der Mitte vierzig sein mochte und den das Gemeindeblatt vielfach als Lukas Kraushaar auswies, predigte von der Kanzel mit stetem Blick in seine Blätter von den Mühen des christlichen Lebens. Irgendwann, so tröstete er mit pathetischer Stimme, seien diese Mühen vorbei und fänden in einer anderen Welt verdienten Lohn. Der Gemeindegesang drohte oft zu ersterben, so schwierig und fremd waren die alten Lieder, die der Organist intonierte. Trödler war froh, wieder die Sonne zu erblicken. Beeindruckt war er nur von den Kästchen und Stäben, in die der Pfarrer mit ganz normaler Lautstärke gesprochen hatte und trotzdem bestens zu verstehen war. Ob das die Geräte und Schläuche waren, die die Stimme auch in sein kleines Radio ins Zimmer der Reha-Klinik übertrugen? Oder die Knatterstimme im Metallkasten? Das wäre eine Katastrophe, sagte er sich, wenn diese nichtssagende Predigt in alle Krankenzimmer der deutschen Lande und in die unzähligen Metallkästen übertragen würde. Er beeilte sich, noch vor dem Pfarrer die Kirche zu verlassen. Er wünschte keinen Handschlag, wie es schon vor dem Gottesdienst zur Begrüßung der Fall gewesen war. Hinter dem Türbogen stehend sah er unauffällig von hinten auf den Geistlichen. Sein Talar war an den Schultern dicht mit Schuppen belegt. Er hörte, wie er sich nach der Verabschiedung der Gemeindeglieder über einen Pfarrer in der Nachbarstadt ereiferte. Ein schmalbrüstiger Mann in grauem Anzug hörte ihm zu.
„Dieser sogenannte Kollege hat ein Kind aus unserem Bezirk getauft. Ohne mich um Erlaubnis zu fragen! Ich bin doch zuständig! Natürlich hätte ich ihm das auch nicht genehmigt. Wo kommen wir hin, wenn jeder sich seinen eigenen Pfarrer aussucht! Dann bricht unsere Gemeinde noch mehr auseinander! Zur Not muss man die Leute zwingen, dorthin zu gehen, wie es die Bezirkseinteilungen vorschreiben. Oder sie sollen es bleiben lassen! Der hat auch schon mal ein Paar aus unserer Gemeinde getraut. Ohne Genehmigung! Der hat wohl geahnt, dass er keine Erlaubnis bekommt und einfach getauft und getraut. Das Brautpaar sind Bekannte von mir, hat er als Ausrede vorgebracht. Na ja, ich habe den Vorgang schon an die Vorgesetzten weitergeleitet. Da bekommt der Kollege hoffentlich ein Disziplinarverfahren.“
Er zog leicht die Nase hoch. Der Mann in Grau blinzelte in die hochstehende Sonne. „Ja, ja, schlimm“, sagte er mit Fistelstimme. Doch der Pfarrer war noch nicht fertig.
„Und dann gibt’s da noch diese Schwester Harder. Die wirbt offensiv Gemeindeglieder von der Friedenskirche ab.“
„Ja, ich weiß, um wen es sich handelt“, bestätigte der Schmalbrüstige, offenbar ein Statistiker, „das ist ein Skandal. Die beiden Gemeindeglieder machen exakt 16,66 Prozent der regelmäßigen Gottesdienstbesucher aus. Ein Aderlass, dem wir nicht länger tatenlos zusehen können. Ich habe selbst mehrere Sonntage beobachtet, wie die beiden Damen ihre Wohnungen um 9.25 Uhr verlassen haben. Um 9.30 Uhr haben sie sich auf der Straße vor dem Discounter getroffen, um dann bergaufwärts ins Klinikum zu streben. Dort haben sie zwischen 9.42 Uhr und 9.45 Uhr die automatische Eingangstür durchlaufen, um rechts in Richtung Klinikkapelle einzubiegen. Die Indizien sind eindeutig.“
Pfarrer und Statistiker überlegten, einen Rundbrief an alle 899 Gemeindeglieder zu senden und sie nochmals auf die Ordnungen der Kirche hinzuweisen und die Pflichten der Gemeindeglieder klarzustellen.
Trödler trat hinter dem Türbogen hervor. Die beiden Herren, die sich alleine gewähnt hatten, zuckten kurz zusammen.
„Kommen Sie, Herr Strunz, wir wollen die Kollekte zählen“, forderte Pfarrer Kraushaar den Rechenmeister auf und schob im Weggehen, den Kopf leicht nach hinten gedreht, nach: „Und die hinteren Sitzreihen sollten wir in Zukunft einfach mit einem Seil absperren!“
Ich war immer für die Ordnung, erinnerte sich Trödler-Luther, gerade am Anfang meiner Reformen. Die Ordnungen sollten den einfachen Menschen, den Bauern helfen, sich zu orientieren, wenn die Zeiten unübersichtlich waren. Damals waren alle Menschen vom Nachdenken über Hölle, Tod und Teufel besessen. Eine Kirche, die da mit klaren Ordnungen und langsamen Reformen Halt gab, war gut und wichtig. Doch heute ist das ja offenbar ganz anders. Viele brauchen die Kirche nicht mehr. Denn wo sind die Menschen heute Morgen zur Gottesdienstzeit gewesen? Aber ist ja auch furchtbar, diese Kirche, wie ich sie eben erlebt habe! Warum freuet sich dieser Pfarrer nicht über eine Taufe und eine Trauung von Menschen aus seiner Stadt? Egal wo das stattfand und wer die Handlung durchgeführet hat? Gott ist die Freiheit und das bedeutet auch: Wenn Ordnungen überhaupt noch nötig sind in der Kirche, dann doch so, dass sie den Menschen dienen. Nicht umgekehrt.
Lautes Reifenquietschen schreckte ihn aus seinen Gedanken auf. Ein untersetzter Mann mit dem Blick einer Bulldogge riss die rostige Tür seines kleinen Peugeots auf und sprang auf ihn zu.
„Du Hornochse, hast du denn keine Augen im Kopf? Siehst du denn nicht, dass hier Autos fahren?“
Aus dem Wageninneren wummerten die Bässe einer Hiphop-Band. Beinahe hätte er Luther über den Haufen gefahren. Der war abwesend über die Straße gelaufen, ohne nach links und nach rechts zu schauen. Autos, überhaupt dieses Getrieben- und Gehetztsein der Menschen, das war ihm nicht vertraut. Wie anders schlug doch die innere Uhr vor 500 Jahren. Auf seinen weiten, schier endlosen Fußmärschen als Mönch hatte er seine innere Ruhe gefunden, um wichtige Dinge zu bedenken, Pläne zu schmieden. Wie sollte das in so einem Metallkasten, den sie Auto nannten, gehen?
Knurrend zog sich die Bulldogge ins Auto zurück und gab Gas. Zu viel Gas, zu wenig Kupplung, er würgte den Peugeot ab und das Auto sprang auf Luther zu. Panisch rannte der davon.
Am Eingang der Fußgängerzone spielte ein südländisch aussehender Mann in zerknautschtem Anzug ungarische Weisen auf der Geige. Passanten warfen gelegentlich ein paar Münzen in den offen vor ihm stehenden Geigenkasten. Luther schlenderte gedankenversunken von der Kirche zum nahegelegenen Spielplatz. Mehrere Mütter waren in ein Gespräch vertieft, während die Kinder Sandburgen bauten und sich zwischendurch um Schaufeln und Siebe stritten.
„Letzte Woche war ich mit meinem Mann und den Kindern im Spaßbad“, sagte eine Brünette mit Lederjacke und Flickenjeans.
„Das kann ich mir nicht leisten“, klagte eine mit roten Haaren, „kostet für mich und Valentina für zwei Stunden 12 Euro. Das ist mehr als uns für den ganzen Tag zur Verfügung steht. Und etwas essen und trinken müssen wir ja auch.“
„Geht mir genauso“, pflichtete eine mit Nasenpiercing bei, „nicht mal Urlaub ist dieses Jahr drin. Ich wollte mit meinem Luis ja nur ein paar Tage in die Sächsische Schweiz. Aber jetzt ist das Auto kaputt. Neuer Keilriemen und so. Kostet mehr als 200 Euro. Das war’s mit Sächsischer Schweiz.“
Während die Frauen so vor sich hin klagten, starrte Wolfgang Trödler in den Wipfel einer Birke. So mancher verstohlene Blick der Frauen traf ihn. Sie waren skeptisch. Vor einiger Zeit hatte ein Unbekannter ein Kind auf einem Spielplatz in der Nähe unsittlich berührt. Die Polizei hatte den Täter zwar geschnappt, doch man konnte ja nie wissen. Aber die Blicke waren nicht nur misstrauisch. So manche der alleinerziehenden Mütter hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, einen Partner zu finden, der ihr Halt geben konnte. Einer, der ihr eine Perspektive eröffnete, ein Leben jenseits staatlicher Mindestzuwendung und alleiniger Verantwortung für das Kind zu führen. Der graubärtige Brummbär auf der Bank, auch wenn er vielleicht 15 Jahre älter war, könnte er ein solcher Erlöser sein?
„Entschuldigen Sie, verehrte Frauen“, wandte sich Wolfgang Trödler an die Mütter, „darf ich Ihnen zwei Fragen stellen?“
Die Frauen verstummten. Die Nasengepiercte blickte ihn forsch an und sagte dann ein gedehntes „Jaaaaaa???“
„Danke, gute Frau, mich interessiert zum einen, was das bedeutet: Ein Spaßbad.“
„Mama, was will der Onkel da?“, rief ein Knirps mit Ball in die Stille, die sich nach Trödler-Luthers Frage ausgebreitet hatte.
„Luis, das kannst du mal dem Onkel erklären, was ein Spaßbad ist!“, freute sich seine Mutter über eine unkomplizierte Lösung des Problems.
„Also, im Spaßbad, da gehen Leute hin, die viel Geld haben. Meine Mama sagt, sie ist Hartz-Vierer. Deshalb können wir da nicht hin.“
„Ich weiß noch nicht genau, was das meint: Ein Spaßbad“, blinzelte ihn Luther jetzt an.
„Na also, einmal, da habe ich gehört, wie meine Mama mit ihrer Freundin gesprochen hat. Sie hat zu der Freundin gesagt, ich sei in einem Spaßbad gemacht worden. Deswegen heißt das Spaßbad.“
„Luis!“, kam es jetzt schrill von der Nasengepiercten und alle anderen Mütter lachten unbändig.
Luther hatte das Gefühl, etwas Geheimnisvolles angesprochen zu haben, etwas, was ihm nicht zustand. Als sich das Lachen der Mütter gelegt hatte, fragte er eine andere Mutter, wo denn eigentlich die Väter seien.
„Gute Frage!“, kam es jetzt von einer dicklichen Frau mit Leberfleck über der Lippe. „In der Kneipe? Beim Fußball?“ Sie schaute Luther herausfordernd an und erzählte ihm vom Alltag einer Frau, die ein Kind alleine großzieht. Er erfuhr Bestürzendes: Väter, die Kinder in die Welt setzten und sich dann dünne machten. Die nicht als treusorgende Familienoberhäupter für die Ihren sorgten, sondern die Verantwortung scheuten wie der Teufel das Weihwasser.
„Das gibt es doch nicht!“, zeigte er sich aufrichtig erschüttert und die Mütter waren froh, endlich einmal einen mitfühlenden Mann kennenzulernen.
„Sage Sie mir, bitte, gute Frau, was hat Sie getan, dass man Ihr zur Strafe einen Ring durch die Nase gezogen hat?“, wandte er sich an Luis’ Mutter.
„Jetzt will er mich wohl auf den Arm nehmen?“, fragte sie lachend. Luther starrte gebannt auf den glitzernden Ring und war zugleich ratlos. Mit großen Buchstaben schrieb sie in den Sand: PIERCING.
„Das ist Schmuck, Zierde, wie Ohrringe, nur durch die Nase, guter Mann!“, gab sie ihm amüsiert zu verstehen.
„Noch eine letzte Frage sei mir gestattet“, versuchte Luther seine Neugierde einzugrenzen. Ihm knurrte der Magen und in der Klinik war Mittagstisch angesagt. „Warum gehen die verehrten Frauen nicht in den Gottesdienst am Sonntagmorgen?“
Bei dieser Frage wendeten sich alle Frauen merklich von ihm ab und bliesen zum Aufbruch. Er hatte ein Thema angesprochen, das sie sichtbar peinlich berührte. Komisch, sagte er sich, wir haben doch früher nur dieses eine Thema in unseren Gesprächen gehabt, nämlich die Frage nach Gott. Und jetzt? Er dachte an das merkwürdige Spiel, das einige Kinder aufgeführt hatten. Ein Kind rief „Wer fürchtet sich vorm Schwarzen Mann“ und dann liefen alle vor diesem sogenannten Schwarzen Mann davon. War für die Mütter Gott dieser Schwarze Mann? Oder dieser komische Pfarrer? Der hatte in der Tat schwarze Locken. Vielleicht hatten sie ihn ein Mal erlebt und seitdem Ängste wie vor dem Jüngsten Gericht? Sonst war dieser eilige Aufbruch nicht zu erklären. Während sie Spielsachen und Kinder hastig zusammenpackten, fragte er sich, was die Mütter aus dem Gottesdienst an Inhalten für ihr Leben ohne Väter und in offenbarer Armut hätten mitnehmen können. Ob die Nasenringträgerin etwas mit dem von ihm vor Urzeiten komponierten Choral Christ lag in Todesbanden hätte anfangen können, das sie dort gesungen hatten? Nur alte Menschen und zwei 13-, 14-Jährige waren in die Kirche gegangen. Die Jugendlichen hatten dem Pfarrer am Ausgang ein Heft entgegengestreckt, welches er abzeichnete. Waren sie nur wegen dieser Unterschrift gekommen?
Nachdenklich begab er sich auf den Weg zurück in die Klinik. An der Kreuzung begegnete ihm noch mal die Nasenringfrau, die ihren Luis auf den Rücksitz gepackt hatte. Sie teilte die beiden Stöpsel eines kleinen Kastens mit ihm. Ein Lied, das ein Haus am See besang, drang daraus hervor. War das der Traum dieser jungen Frau? Der ganzen Generation? Ein Haus am See, wo einen keine Autos jagten. Der Mensch lebt von Träumen. Sie müssen sich nicht mal erfüllen. Nur wer nicht träumt, geht verloren. Man könnte das, was diese Frau und mit ihr offenbar viele andere wünschen, zusammenfassen in dem Begriff Geborgensein. Warum war davon in der Kirche, im Gottesdienst keine Rede gewesen?
Aus dem Stationszimmer traf ihn ein tadelnder Blick der Schwester. Ausgang sei früher anzumelden und bedürfe erst der Zustimmung, gab sie ihm zu verstehen. Wortlos, ohne eine Miene zu verziehen, ging er weiter. Vor seinem Zimmer standen zwei Personen, die ihn erwarteten: Die Klinikseelsorgerin Sabine Harder, mit Talar über dem Arm, und ein Mann, der wie er ein langes schwarzes Hemd trug und den ihm Sabine Harder als Klaus Schulz vorstellte, ihren katholischen Kollegen in der Klinik. Ob sie beide mit ihm das Gespräch vom letzten Mal noch fortsetzen könnten. Sabine Harder fragte das höflich und vorsichtig. Sie hatte in der Zwischenzeit mit Rosemarie Aicher telefoniert. Der Lebensgefährtin von Wolfgang Trödler war es peinlich, fast gar nichts über dessen Vergangenheit zu wissen. Die Seelsorgerin sagte ihr Vertraulichkeit zu und notierte eifrig das Wenige mit, was sie erfuhr: In München hatte er Jura studiert, bei der Deutschen Bahn hatte er gekellnert, in einem Möbelzentrum war er als Verkäufer beschäftigt. Vom Satan habe er nie gesprochen. Das waren immerhin ein paar Ansatzpunkte für Recherchen. Aus Sorge, sie könne sich in eine Spinnerei verirren, hatte sie den Kollegen Schulz gebeten, am Gespräch mit Trödler-Luther teilzunehmen. Mit Schulz verstand sie sich gut. Sie wollte seine Meinung zum sonderbaren Patienten hören.
„Herr Trödler-Luther“, eröffnete sie das Gespräch, nachdem sie sich an den Tisch im Patientenzimmer gesetzt hatten. Sie erntete sofort fragende Blicke von beiden Herren: Vom Patienten, weil sie ihn offenbar immer noch nicht in seiner alleinigen Identität als Martin Luther anerkannte; von Klaus Schulz, weil er nicht glauben konnte, dass sich eine so vernünftige Seelsorgerin dem obskuren Willen eines Patienten unterwarf und ihn mit dem Namen des Reformators ansprach.
„Also, wir haben beim letzten Mal über das Geborgensein gesprochen …“, fuhr sie fort, doch Trödler fiel ihr alsbald ins Wort: „Ja, das scheint mir heute eine entscheidende Kategorie, um Menschen die Nähe Gottes zu veranschaulichen.“
Er breitete aus, was er aus den Gesprächen der Mütter auf dem Spielplatz aufgeschnappt hatte, tat Lektüreeindrücke aus psychologischen Zeitschriften kund und sezierte die Predigt in der Friedenskirche, die er gehört hatte. Nichts daran habe mit der Lebenswirklichkeit der Menschen zu tun, nur faules und seichtes Geschwätz sei das. Ständig habe der Pfarrer selbstherrlich etwas von einem Praktikum in einem fernen Land erzählt, das er gemacht habe. So sehr er, Luther, für Beispiele aus der eigenen Lebenswelt sei, bei diesem Mann auf der Kanzel habe nicht der Heilige Geist geweht, sondern Frau Eitelkeit habe sich ein herrlich Gewand umgeworfen und ihn zu ihrem Sprachrohr gemacht.
Auch wenn sie es sich verbieten wollte, konnte Sabine Harder ein kleines Triumphgefühl nicht unterdrücken, das die herbe Kritik am Kollegen in ihr auslöste. Genau dieser Kollege hatte sie wegen ihrer Anstellung in der Klinik mit einer Klage überzogen. Trotzdem wollte sie die Situation nicht auskosten und den Kollegen vor den beiden anderen gerade verteidigen, da fuhr Trödler-Luther aufgebracht fort:
„Kein einziges Amen hat die Gemeinde gesprochen. Ist das der neue Katechismus? Dass der Pfarrer sich selbst das Amen zuspricht? Oder muss das nicht respondieren? Der Pfarrer betet mit Worten auch für die anderen und die bestätigen mit einem lauten und geschlossenen Amen! das Gesagte? Was ist von der Gemeinde geblieben, wie ich sie zum Exempel 1544 in der Schlosskirche zu Torgau bei deren Eröffnung beschrieben habe? Ein Alleinunterhalter vorne und eine vor sich hin dösende Gemeinde!“
Klaus Schulz nickte zustimmend und schob ein: „Bei uns in der katholischen Kirche ist das etwas anders. Da weiß die Gemeinde zumindest, wann sie das Amen zu geben hat.“
Trödler-Luther starrte den Geistlichen an und überging dessen Einwurf. Eine Stechmücke umschwirrte sein rechtes Ohr. Ärgerlich schlug er nach ihr.
„Kann mir jemand von der hier versammelten Geistlichkeit erklären, warum dieser Bruder in der Friedenskirche auf die Kanzel gestiegen ist? Nein? Keine Antwort? Als ich die großen Predigten gehalten habe, anno 1517, 1521, 1522, da war die Kirche voll. Und es gab noch nicht diese Stäbe und Kästchen, in die man spricht und die den Ton lauter machen. Damit auch die oben auf den Emporen und die, die im Eingang standen, etwas hörten, habe ich die Kanzel genutzt, weil sich dort der Klang am besten verbreitet. Doch heute ist das eine ganz andere Situation. Da muss doch der Prediger die Kanzel nicht mehr besteigen! Da muss doch der Prediger sich nicht an seinen Zetteln festhalten! Vielmehr ist ihm aufgetragen, frei das Wort Gottes zu verkünden, nachdem er sich gründlich darauf vorbereitet hat. Memorieren ist Übungssache. Dem Prediger ist es so möglich, auf Käthchen Müller zuzugehen und sie während der Predigt zu trösten. Er kann sie als Exempel für eine trauernde Witwe nehmen, die des Trostes bedarf. Legt er den Arm um sie und sagt vernehmlich für alle: Wir wollen dem Herrn als unserem guten Hirten vertrauen, dass er uns nicht verloren gebe, so wie er dem verirrten Schaf bis ins äußerste Gebirge hinterhereilt, um es zu erretten, dann, ja dann wächst ein Trost für alle daraus. Die anschauliche Geste, das persönliche Wort, der engagierte Vortrag, so was muss doziert, geübt und zur Meisterschaft gebracht werden!“
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.