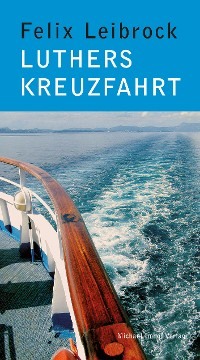Kitabı oku: «Luthers Kreuzfahrt», sayfa 2
„Ich mache das mit dem Animationsassistenten!“, sagte er bestimmt zum Sachbearbeiter.
„Na endlich. Warum nicht gleich so!“
Der Leblose tippte einige Daten in den Computer, druckte dann ein Formular in mehrfacher Ausfertigung aus und legte es dem Arbeitsuchenden zum Unterschreiben vor. Als Wolle wankend den Raum verlassen hatte und ein Herr namens Rainer Rausch, der sich selbst Rauschi nannte, eingetreten war, sah Heinz Schmidt irritiert auf die Sätze, die Wolle unter eine seiner Unterschriften gesetzt hatte:
„Über allen Gipfeln
Ist Krach.
In allen Wipfeln
Ist von Ruh
Kein Hauch.
Die Vögelein streiten im Walde.
Warte nur, balde,
bist im Stress du auch.“
III
Als Kind kannte Didi das Gefühl, besser nicht geboren zu sein. Auch wenn er ihr einziges Kind war, hatten seine Eltern eigentlich keine Zeit für ihn. Sein Vater, Erich Dollmann, betrieb einen Ein-Mann-Sanitärbetrieb in Bruchköbel, einer hessischen Kleinstadt. Die Aufträge, die er bekam, waren mehr als bescheiden. Hier mal ein verstopftes Abflussrohr bei einer alten Witwe, da mal ein tropfender Wasserhahn, das war zum Leben zu wenig. Ein paar Mal hatte er versucht, bei größeren öffentlichen Aufträgen mitzuhalten. Die neuen Sanitäranlagen der städtischen Grundschule, die Gemeinschaftsdusche in der Kreis-Sporthalle. Er plante, Arbeitskräfte zumindest befristet einzustellen, um den Auftrag auszuführen. Didi saß im Peugeot-Lieferwagen, wenn der Vater zur Gebotseröffnung in die Stadtverwaltung oder ins Landratsamt fuhr. Er wartete im Auto und sah schon am schleppenden Gang des Vaters, dass es wieder mal nicht geklappt hatte. Auf der Rückfahrt war der Vater einsilbig, murmelte etwas von illegalen Absprachen und griff zu Hause immer häufiger zur Cognacflasche. Das waren die Augenblicke, in denen Didi höchst wachsam sein musste. Mehr als einmal hatte der Vater den ersten Anlass genutzt, um seinen Frust an ihm abzureagieren. Nicht nur mit Worten. Auch die Hand rutschte ihm das ein oder andere Mal aus, wie er euphemistisch die Tracht Prügel beschrieb, die er dem Sohn verabreichte. Aus schlechtem Gewissen heraus nahm er ihn dann am nächsten Tag mit zu einem Auftrag, gab ihm einen Groschen für das Halten des Rohres oder das Tragen der Wasserpumpenzange und erlaubte ihm, für ihn die Knöpfe des Spielautomaten in den Kneipen zu drücken, die sie auf der Heimfahrt aufsuchten und in denen Vater Erich nicht nur ein Pils trank. Obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten konnten, fuhr der Vater mit Didi einige Jahre im Sommer für ein, zwei Wochen zu einem Bauernhof in der Nähe des oberbayerischen Wolfratshausen. Der Vater half dem Bauern, einem entfernten Verwandten, gegen freie Kost und Logis bei der Ernte, während Didi an der Isar entlangzog, ohne wirklichen Kontakt zu den Kindern des Ortes zu finden. Am Abend pichelte der Vater mit dem Bauern selbstgebrannten Schnaps. Didi blieben nur die Katzen, Schweine, Kühe und Bobo, der Hofhund, als Bezugswesen. Wen er schmerzlich bei diesen Urlauben vermisste, war die Mutter. Hier hätte er vielleicht eine innigere Beziehung zu ihr gefunden! Sie wäre mit ihm gemeinsam an der Isar spazieren gegangen, hätte ihm Käfer und Gräser erklärt und ihm gezeigt, wie man Steine auf dem Wasser hüpfen lässt. Aber seine Mutter war nie dabei. Sie musste Geld verdienen, um die Existenz der Familie abzusichern. Die wenigen Einnahmen des Vaters wanderten zunehmend in seinen Alkoholkonsum.
Christel Dollmann war in jungen Jahren eine schöne, sportliche Frau. Mit ihren eingedrehten blonden Locken und ihrer natürlichen Eleganz erinnerte sie nicht wenige an die damals von allen bewunderte Grace Kelly. Erich Dollmann hatte Christel beim Tanz kennengelernt. Es imponierte ihr, wie aufgeschlossen er den neuen Tänzen Boogie-Woogie und Rock ’n’ Roll gegenüber stand. Wild warf er sie bei diesen Tänzen hin und her und bei innigen Tangoschritten zu Freddy Quinns Die Gitarre und das Meer hauchte er ihr ins Ohr, er möchte mit ihr alt werden. Die Hochzeit fand in großer Bescheidenheit statt, alles Geld wurde gespart für die Flitterwochen am Lago Maggiore, wo man dem Brautpaar in einem kuscheligen Albergo das schönste Zimmer gab, mit Blick auf den See.
Didi kam ein Jahr später zur Welt. Die Ehe ging sehr schnell in Routine über, in ein Zusammensein, das geprägt war von Streiten über fehlendes Geld, Trunkenheit des Vaters und Gesprächen nur noch an der Oberfläche. Die Familie, das zeigte sich bald, brauchte ein zweites, ein sicheres Einkommen. Christel Dollmann erwarb als eine der ersten Frauen in Bruchköbel den Führerschein. Mit Hilfe eines Kredites kauften sie einen VW-Bus T1, den sie zu einem Verkaufswagen umbauten und mit dem fortan Christel Dollmann über die Dörfer fuhr, um Brot, Eier, Wurst und andere frische Lebensmittel zu verkaufen. Vor allem die alten, nicht automobilisierten Leute auf dem Dorf waren dankbar für diesen Service. Der Service funktionierte aber nur, so dachte Didis Mutter, wenn sie 365 Tage im Jahr immer zur gleichen Zeit bei Wind und Wetter die Dörfer anfuhr. Verlässlich zu sein war das A und O, sonst überließen die alten Leute zunehmend den Kindern die Versorgung. Und die, die fuhren in die wie Pilze aus dem Boden schießenden Supermärkte. Dort fanden sie eine größere Auswahl, und die Preise waren auf Grund der Massenkontingente beim Einkauf günstiger. Darum fuhr die Mutter nie mit nach Oberbayern. Darum war Didi immer alleine an der Isar unterwegs. Urlaub war für seine Mutter, die selbst an Heiligabend über die Dörfer fuhr, ein Fremdwort, und er musste sich alleine beibringen, wie Steine auf der Isar hüpfen.
An die Schulzeit dachte Didi nie gerne zurück. Jede Klasse hat mindestens einen Außenseiter, und manchmal gab es auch einen Außenseiter für die ganze Schule. Didi war so einer. Oft war er Gesprächsthema in allen Schulklassen des von ihm besuchten Knaben-Realgymnasiums. So einmal, als ihm einige Jungs der höheren Klassen mit Nägeln seine neue Windjacke, auf die er so stolz war, auf einer der Holzbänke unter der alten Linde des Schulhofs festtackerten. Der Schulgong ertönte. Er bemühte sich, eilig in den Unterrichtsraum zu kommen, ergriff die Jacke im Rennen. Mit einem großen Ratsch riss sie mitten entzwei. Natürlich war das keiner der Jugendlichen gewesen, als es zur Gegenüberstellung beim Direktor kam. Sie gaben sich gegenseitig ein Alibi. Didi stand alleine da mit seiner kaputten Jacke – und musste ein häusliches Donnerwetter vom Vater zusätzlich fürchten. Tagelang sah er in grinsende Gesichter der höherklassigen Schüler. Als er einmal auf einen losstürmte und ihm die Faust ins Gesicht schlagen wollte, stürzten sich die anderen auf ihn und lieferten ihn beim Direktor ab. Mehrere Tage Nachsitzen!
Demütigend war vieles in der Schule. In den Hofpausen bildeten sich mehrere Teams, die mit einem Tennisball auf verschiedenen Feldern des Schulhofs Fußball spielten. Nicht, dass er davon ausgeschlossen war. Aber am Anfang stand die Wahl der Mannschaften. Die beiden Anführer bildeten einen Abstand von einigen Metern und gingen dann, abwechselnd Fuß vor Fuß setzend und Schnick-Schnack rufend, aufeinander zu. Wer den Fuß am Schluss auf den Fuß des anderen setzte, begann mit der Wahl. In Form eines neuzeitlichen Sklavenhandels gingen zuerst die guten und beliebten Spieler weg. Zwar war Didi gar kein so schlechter Fußballer. Aber warum sollten sich die Mitschüler diese Gelegenheit entgehen lassen, ihn zu demütigen? Also wählten sie auch die schwächeren Spieler in die Teams und ließen ihn am Schluss alleine schmoren. Obwohl klar war, dass er nun zu dem Team kam, das als letztes an der Wahl war, sagte deren Anführer demonstrativ: „Nee, lieber spielen wir mit einem weniger als mit DEM da.“ Erst nachdem sich alle eins abgelacht hatten, durfte er gnadenhalber mitspielen. Oft ging er dann ruppig zur Sache, was ihm die kollektive Wut der gegnerischen, manchmal sogar der eigenen Spieler bescherte. In ihm stieg in solchen Situationen ein schwarzes Tier auf, ein unbändiger Hass auf die Mitschüler, das Leben überhaupt. Warum, so fragte er sich, wenn er einsam nach Hause trottete, bin ich auf der Welt?
Oft überlegte er, warum er in diese Außenseiterrolle geraten war. Ihm kam dabei stets die verwundete Katze in den Sinn. Sie war ihm und einigen Klassenkameraden über den Weg gelaufen, humpelnd, da ihr ein Bein fehlte. Die anderen machten sich einen Spaß daraus, das geplagte Tier durch den Park neben der Schule zu jagen, nach ihm zu treten und es mit übelsten Schimpfworten zu belegen.
„Halt, hört auf, lasst sie in Ruhe!“, war er, Didi, damals vehement dazwischengegangen. Er hatte den Klassenkameraden sogar gedroht, es ihren Eltern zu sagen. Mit Katzen hatte er auf dem Bauernhof bei Wolfratshausen geschmust, sie waren ihm lieb und wertvoll. Verächtlich hatten ihn die anderen angeschaut. Einer, Kalle, spuckte ihm ins Gesicht. Am nächsten Tag machte das Erlebnis die Runde in der Klasse, dann in der Schule: Didi, das Weichei! Der Katzenfreund!
Einige Wochen später, bei einer Exkursion, versuchte Didi, sein Image aufzupolieren. Sie kamen an einen Tümpel voller Frösche. Der Biologielehrer, Herr Weschke, war mit einem Teil der Klasse bereits weitergegangen. Didi zog den Strohhalm aus seiner Caprisonne, grapschte nach einem Frosch, steckte ihm vor den verwunderten Augen seiner Mitschüler den Strohhalm in den Hals und blies ihn kräftig auf. Erst als das Tier zu platzen drohte, warf er es ins Wasser zurück. Erwartungsvoll sah er auf die Umstehenden, die sogleich murmelnd in Gruppen davongingen. Er trottete alleine hinterher. Am Ende der Exkursion bat ihn Weschke zu einem Einzelgespräch. Ob es stimme, dass er einen Frosch gequält habe und so weiter. Eine Woche Nachsitzen und alleiniger Tafeldienst. Die Aktion war danebengegangen. Nichts mehr konnte ihn aus der Außenseiterrolle herauskatapultieren. Er hatte das Kainsmal auf der Stirn, unwiderruflich. Weil er keine Katzen quälte.
Doch es gab auch lichte Momente in seiner Jugendzeit. Mit zwölf Jahren hatte er Geld angespart und kaufte sich eine gebrauchte Gitarre. Lange hatte er davon geträumt. Sogar sein Vater steuerte fünf Mark für ein Lehrbuch zum Selbstunterricht bei; denn für den Unterricht in der städtischen Musikschule reichte sein Geld nicht. Stundenlang saß er in seinem Zimmer oder am Schmelz-Weiher und übte Griffe. Manchmal gab ihm sein Musiklehrer am Gymnasium, Herr Leyser, ein paar Tipps. Er begeisterte sich für Jimi Hendrix an der Gitarre und die Liedtexte von Jim Morrison. Beide genial als Musiker, aber jung gestorben. Morbide Anwandlungen. Träume von Jamsessions mit Gleichgesinnten. Der Reiz der Drogen. Erstmals taten sich ihm Auswege aus seinem tief empfundenen Verlorensein in dieser Welt auf. Seine erstaunlichen Fortschritte brachten ihm auch kleinere Auftritte bei Schulfesten. Gelegentliche Versuche, eine eigene Band zu gründen, scheiterten an fehlender Disziplin der Mitspieler, die oft die Proben schwänzten. Live fast, love hard, die young, das war die Lebensmaxime nicht nur von Hendrix und Morrison. Auch er nahm sich mehr und mehr vor, schnell und intensiv zu leben, aus der Isolation auszubrechen, heftig zu lieben und jung zu sterben. Ohne genau zu wissen, wie ihm geschah, hatte er eines Tages seinen ersten Samenerguss. Verwundert sah er auf die milchige Flüssigkeit und fragte sich, wie er wohl diesen Teil des Dreiklangs erfüllen sollte: Love hard, heftig lieben. Noch nie hatte sich ein Mädchen für ihn, den Außenseiter, das Spottobjekt der Schule interessiert. Mit seinem kastenförmigen Kopf und den damals stark abstehenden Ohren, mit seinen vielen Pickeln auf der blassen Gesichtshaut war er alles andere als ein Schönling. Auch sein Interesse am anderen Geschlecht war noch nicht erwacht. Im Gegenteil. Bei einer Klassenfahrt nach Mannheim mit einer Übernachtung in der Jugendherberge kam es im Schlafsaal eines Nachts zu einer homoerotischen Orgie. In der Dunkelheit gab einer aus der Klasse das Kommando vor. Alle zogen sich aus und langten sich in wildem Durcheinander an ihre schon bald erigierten Glieder. Auch er war Teil dieses juvenilen Erlebnisses, weil ihn niemand erkannt hatte und der Kick des Abenteuers die Lust am Demütigen seiner Person überwog. Die Mitschüler hatten schlicht und einfach vergessen, dass auch er an der Orgie teilnahm. Für ihn ein positives Erlebnis, auch wenn am nächsten Tag alle betreten beim Frühstück saßen und sich ihrer Ausgelassenheit schämten. Die Wochen darauf waren die Zeit der Paarbildung. Die Penisorgie verletzte die Mannesidentität. Mädchen erobern, das war der Weg, das Selbstbild zu korrigieren, vor sich selbst und den anderen. Die Jungen seiner Klasse eilten nach Schulschluss zum nahe gelegenen Mädchengymnasium. Schon bald gingen sie mit einer Auserwählten Händchen haltend zur Eisdiele oder in das Eye, den Jugendclub, in den nur reinkam, wer gute Beziehungen zum Türsteher hatte. Didi gehörte nicht dazu. Wütend drosch er zu Hause die Akkorde in die Gitarre. Auch er sehnte sich jetzt plötzlich nach einer Freundin, die er von ganzem Herzen liebte und die ihm diese Liebe erwiderte. Doch die Beutezüge ans Mädchengymnasium liefen ohne ihn ab.
Wie ein Wunder erschien es ihm, als sie plötzlich in seinem Leben auftauchte: Ulrike Braunholz. Nie zuvor hatte er sie gesehen. Den Namen las er auf ihrer Schultasche, als sie vor ihm in den Bus stieg. Er empfand sie überirdisch schön. Einmal erhaschte er an der Bushaltestelle einen Blick in ihre dunkelbraunen Augen. Für ihn war es der Blick in die Tiefe seines Lebens. In ihr, Ulrike, lagen alle Antworten auf seine existenziellen Fragen verborgen. Sie, nur sie war die Frau, mit der zusammen ein Weiterleben einen Sinn hatte. So dachte der Fünfzehnjährige. Wie aber sollte er, der, von einer langweiligen Cousine bei Familienfeiern abgesehen, noch nie mit einem Mädchen gesprochen hatte, wie sollte er sie kennenlernen? Er hatte keine Ahnung, wie man anmacht, anbaggert, aufreißt. Begriffe, die er von Klassenkameraden aufgeschnappt hatte. Ulrike ansprechen, allein der Gedanke bereitete ihm Schweißausbrüche. Aber sie war sein einziger Ausweg. Für sie war er in die Welt gekommen. Und sie, hoffentlich, hoffentlich, für ihn. Sie kennenlernen. Nichts essen konnte er in dieser Zeit, an Schlaf war nicht zu denken. Er war krank, herzkrank, ulrikekrank. Dann war sie da. Die Idee, wie sie anzusprechen war.
IV
Urlaub, Zeit zum Ausschlafen. Nicht so auf der NOFRETETE. Vor Sonnenaufgang, exakt um 5.15 Uhr, joggte auf Deck 15, dem Sonnendeck, die sehnige, drahtige, stirnbandgezierte Gazelle Gesine Harms aus Harrislee an der dänischen Grenze, das blonde Haar zu einem Hochzopf zusammengeflochten, die Ohren iPod-bestöpselt, ihre Runden um den Schornstein. Das war nur das Vorspiel zur einstündigen Übungseinheit an den Foltergeräten des Fitness-Centers. Auf diese Art bereitete sie vielen, in die Restaurants zum Frühstück strömenden Gästen am Rand der Adipositas ein schlechtes Gewissen. Nicht ohne Absicht. Die erwünschte Wirkung war aber fragwürdig, hörte sie doch einen schmerbäuchigen Herrn mit tiefsitzender Cordhose Worte wie „Fitness-Terroristin“ und „Schau dir das Wäschegestell an“ zu seiner ebenfalls kugelrunden Gattin nicht gerade leise sprechen. Gesine Harms belegte Kurse in Tae Bo, Ballooning Ball, Power Dumbell, Step, Yoga und Pilates, um dann zur Mitternachtsstunde am Indoor-Cycling auf dem Sonnendeck teilzunehmen. Am Abend zuvor, beim Auslaufen aus Palma de Mallorca, hatte sie sich beim Buffet auf den Caesar Salad, die gebratene Ananas mit Kokossorbet und die glasierten Perlzwiebeln gestürzt. Dabei fragte sie den philippinischen Buffethelfer, dem ein Schild den in diesem Zusammenhang irritierenden Namen „Bonsai“ zuwies: „Ist die Geflügelbrust auf dem Caesar auch schön mager?“ „Ja, Mam“, kam es zurück. Gesine Harms war nicht überzeugt, er habe sie verstanden. Bonsai hatte offenbar die Anweisung, die Fragen der Gäste stets zuvorkommend, mit einem Lächeln und zustimmend zu beantworten. Sein freundlicher Blick verleitete die Fastdänin, die etwas Sinnenverachtendes verströmte, zu einem Augenaufschlag und einem Deut mit dem rechten Zeigefinger auf ihr eigenes karges Dekolleté, das sich in einer lila Strickweste verlor. Gerade wollte sie zu formulieren beginnen, wie man es Fremdsprachigen gegenüber gelegentlich tut: „Ich“ (Zeigefinger), „ich“ (noch mal Zeigefinger) „nix fett essen ...“, da sah er auf ihren Oberkörper und sagte mit breitem Lächeln: „Ah, verstehe, ja, Hühnerbrust, mager, Mam“. Kurz überlegte sie, ob sie da was falsch verstanden hatte. Dann war ihr klar, dass die Äußerung des Kochs mit ihrer Handbewegung zusammenhing. „Unerhört“, sagte sie vor sich hin, „Was dieser Bonsai sich wohl untersteht!“ Kurz überlegte sie, sich beim Front Office Manager zu beschweren, unterließ es aber angesichts der kompromittierenden Beweisführung, die anzutreten ihr nicht erspart bliebe. Dafür bekommt der kein Trinkgeld, nicht einen müden Cent, schwor sie sich.
Während sie ihre Runden drehte, hatte sich an exponierter Stelle auf Deck 13, dort, wo sich auf anderen Kreuzern Liebende das Weiterschlagen des Herzens Hüfte an Hüfte und unter elegischen Klängen zusichern, eine Armada von Photographen aufgebaut. Mit ihren Stativen und überdimensionierten Objektiven erweckten sie den Anschein, neue Galaxien, das Heranrücken der mittelalterlichen Türkenflotte oder zumindest den Start der Air Force 1 auf der anderen Seite des Erdballs einzufangen. In Wirklichkeit ging es ihnen, mit dem Sinn für außergewöhnliche, einmalige, noch nie dagewesene Naturereignisse, um den Aufgang der Sonne, den sie in Myriaden von Fotos festhielten. Bedauernswert die Verwandten und Bekannten, die, an verregneten Abenden in muffigen Wohnstuben in Hoyerswerda oder Hanau mittels dieser Aufnahmen das millimeterweise Aufsteigen eines roten Punktes am Horizont nachzuvollziehen gezwungen waren, begleitet von einem emphatischen „Da, da, da ist sie, seht ihr sie, da, da, die Sonne, da, seht ihr sie …“ des Photographen.
An einer abgelegenen Stelle des Decks stand Wolle Luther. In der rechten Hand hielt er eine Plastiktüte von Aldi. Seine Blicke schweiften über das Deck. Niemand durfte ihn bei der Aktion beobachten. Umständlich kramte er ein schwarzes Kleidungsstück hervor. Sein Lutherrock war es, den ihm ein Kirchenvertreter während der Zeit geschenkt hatte, als er glaubte, Martin Luther höchstselbst zu sein. Nein, das war er nicht. Aber er fühlte sich als Luthers Anwalt. Dem Reformator sollte Gerechtigkeit widerfahren. Keine Anachronismen! Keine Luther-Sätze aus der Reformationszeit, die heute noch genauso gelten sollen! Schutz des Reformators vor seinen blinden Verehrern! Um diese Aufgabe umzusetzen, um seine neue Rolle anzunehmen, brauchte Wolle eine Symbolhandlung. Er sah ein letztes Mal, nicht ohne Wehmut, den Lutherrock an und packte ihn dann wieder in die Plastiktüte. Auf einen Zettel schrieb er: „Zur allgefälligen Benutzung. Wolle Luther.“ Den Zettel gab er ebenfalls in die Tüte, verschnürte und verklebte sie und holte weit aus. Der so eingetütete Lutherrock schwebte in die von den Schiffsschrauben aufgewühlten Wellen. Ein kurzer Tanz auf den Schaumkronen, und Neptuns Kleiderkammer hatte sich erweitert.
Das eigentliche Leben bei aufgehender Sonne spielte sich auf dem Pooldeck ab. Die Philippina Mary Ann, die gerade die Handtuchausgabe eröffnete, sah sich verschlafenen, aber dennoch nicht aggressionsfreien Gesichtern ausgesetzt. Die drei Söhne der Familie Becker aus dem Saarland; Jupp Schmitz aus Köln mit der elfjährigen Tochter Julia; die mit zwei anderen Witwen verreisende Helga Haseneier aus Offenbach, die ihren Namen, um anzügliche Gedanken zu vermeiden, seit Kindheit an „Hase-neier“ aussprach; Ottilie Greis und zwei andere Mitglieder des Frauenkneippvereins Harmonie Stuttgart-Bad Cannstatt; Pfarrer Cornelius Schwacke, Leiter einer Luthertagung (auch das war auf der NOFRETETE mit ihrem hochmodernen, allen technischen Wünschen gewachsenen Conference Center möglich); Hugo Frank mit Panamahut als Vertreter der Sächsischen Imker. Bis auf Schwacke, der abwartete, entrissen sie Mary Ann geradezu die Pool-Handtücher, um sie, ergänzt mit Sonnenbrillen, vergilbten Bastei-Lübbe-Schmökern und fast leeren Cremetuben auf die in geordneter Phalanx stehenden Liegen zu werfen. Die Handtuchholer waren nach einem undurchschaubaren, aber effizienten Selektionssystem von ihrem Clan oder ihrer Stammesgemeinschaft auserkoren, stellvertretend für die anderen die besten Plätze für die Vergnügungen des ersten Tages, eines Seetages, also das Animationsprogramm mit Gewinnmöglichkeiten, das Freibier des Kapitäns und andere Lustbarkeiten, zu okkupieren. In an paramilitärische Operationen erinnernden Formationen gingen sie vor und binnen weniger Minuten hatte die Pooldeckguerilla den ersten Grabenkampf gewonnen. Alle Liegen vor den diversen Pools und der später als Bühne dienenden Freitreppe hatten sie unter Zeugen belegt. Kein Zweifel, hier waren Wiederholungstäter am Werk, notorische NOFRETETE-Reisende, die auf der ersten Fahrt leer ausgegangen waren und auf einem abgelegenen Liegestuhl fernab des Geschehens unter der prallen Sonne dahindarbten. Aus dieser frustrierenden Erfahrung klug geworden, hatten sie jetzt das kryptische Motto verinnerlicht, das Darwins survival of the fittest nur unwesentlich nachstand: Der frühe Vogel fängt die Liege.
Ab 7.00 Uhr füllten sich die Restaurants mit Frühstücksgästen, denen der viele Gratis-Wein beim Buffet des ersten Abends anzusehen war. Der in Zivil umherstreifende Schiffsarzt Dr. Moll, ein Ruheständler, der im Gegenzug für seine Leistungen kostenfrei reiste, erspähte erste Opfer und gab beim Frühstück Ferndiagnosen. Ein Spiel, das er sich seit Jahren mit seiner Gattin, einer Krankenschwester, die er in vierter Ehe geheiratet hatte und die also auch vom Fach war, gönnte. Gastritis, Bluthochdruck, Fettleber, Reflux, Gallensteine, das ganze Programm war abzusehen. Einmal kam beiden gleichzeitig die Anorexia nervosa über die Lippen, als sich nämlich Gesine Harms an ihnen vorbei zur Obstbar schlängelte.
Die Sonne war ein gutes Stück am Horizont hochgeklettert, eine leichte Brise wehte. Auf dem Pooldeck erschien das strahlend weiß gekleidete Animationsduo: Jenny, 25 Jahre, Studienabbrecherin aus der Hansestadt Bremen, die einfach gerne was mit Menschen machen wollte und mal gucken wollte, was sich beruflich vielleicht so ergibt, und die NOFRETETE ist ja irgendwie toll, da sind so viele spannende Leute und immer schönes Wetter und das Meer und mit der Crew einen Cocktail zwischendurch trinken und, ach, ich weiß auch nicht. Kai aus Leipzig, sein Abitur lag schon acht Jahre zurück, wollte nur mal ein paar Monate nach den Prüfungen relaxen, war ja echt Stress, auch wenn’s nur mit dem Notendurchschnitt drei Komma zwei endete, aber dann waren die Fristen zum Einschreiben an der Uni verstrichen, BWL und so, und dann hat ein Kumpel in einem Hotel auf Ibiza den Animateur gegeben und geschwärmt und dann hat sich das mit der NOFRETETE ergeben und ist ja auch total cool, obwohl, ich mein, manchmal geht’s auch ganz schön auf den Geist, jede Woche das gleiche Programm abziehen, den ganzen Sommer über, und manchmal gibt’s richtig Ärger mit Gästen, die rummaulen, und was soll aus mir werden, frag ich mich schon und überhaupt, und, ach, ich weiß auch nicht.
Mit ein paar launigen Floskeln weckten die beiden Animateure die vom Frühstück erschöpften Beckers, Schmitz’, Haseneiers (gesprochen Hase-neiers), Greis’, den Frauenkneippverein, die sächsischen Imker und all die anderen. Wie dösende Seelöwen, speckig glänzend von der ersten Sonnenmilch, hatten sie dagelegen. Jetzt stellten sie die Liegen in die Sitzposition um. Jenny piepste begeistert: „Nun präsentieren wir Ihnen unseren Neuzugang. Wir, Kai und ich, wir haben unser Team erweitert. Freuen Sie sich mit uns über unseren neuen Animationsassistenten, Wolle Luther!“
Bei diesen Worten trat Wolle aus der Pool-Bar hervor und zeigte sich der Menge. Der anfangs noch sehr spärliche Applaus ging, für ihn rätselhafterweise und ohne, dass er etwas getan hatte, in ein Gelächter über, das sich wie ein Lauffeuer über das ganze Deck verbreitete. Wie er aus manchen witzig gemeinten Äußerungen mitbekam, war es seine Kleidung, die diese Wirkung erzielte. Wie seine beiden Kollegen hatte er eine weiße kurze Hose und ein gleichfarbiges T-Shirt an, beides mit dem marineblauen Emblem der NOFRETETE. Bei der Bestellung der Größen war man offenbar von Bonsai und seinen Kollegen ausgegangen. Die riesigen Bestände an Mannschaftsbekleidung auf der NOFRETETE reichten nicht über die Größe XL hinaus. So hing das T-Shirt an Wolle mit seinen stattlichen 150 Kilogramm eher wie ein Lätzchen am Säugling. Nicht mal bis zum Bauchnabel reichte der Stoff, darunter quoll die gewaltige Plautze in mehreren Wulsten hervor. Die Hose war an Wolles Körper nur ein Höschen und erinnerte fatal an einen String-Tanga, bedeckte sie gerade mal das Geschlecht und einen Teil des Gesäßes, nicht den größten.
„Wolle, wenn wir absaufen, leihst du mir dann einen deiner Rettungsringe?“, prustete Hans Blumenstiel los, einer der Imker.
„Sexy, sexy“, riefen die drei Becker-Söhne fast unisono frech.
„Is dat Hagrid, Rubeus Hagrid?“, staunte Julia Schmitz, die ausgewiesene Harry-Potter-Expertin an der Seite ihres zähnebleckenden Vaters.
Nur Pfarrer Cornelius Schwacke, der mit seinen raspelkurzen Haaren und seiner rauhen Stimme verblüffend an den Sänger Sting erinnerte, fragte ernst hinter seiner Sonnenbrille hervor, einem Gucci-Imitat: „Schreibt er sich wirklich Luther? Wie der Reformator?“
„Ja, ihr Lieben“, griff Kai die Worte auf, „ich merke, Wolle schlägt voll bei euch ein. Mit seinen 51 Jahren ist er im Herzen jung geblieben, wie ihr seht. Sonst hätte er sich nicht auf so einen Job beworben. Ha, ha. Vielleicht sagst du mal selbst was zu deiner Person. Ich meine, wer du so bist, Wolle, und wo du herkommst und so. Echt cool, dass du hier bist, altes Haus.“
Er drückte Wolle, der auf die Freitreppe gestiegen und damit für alle gut sichtbar war, das Mikro in die Hand. Dieser stierte verärgert ins Wasser des neben ihm sprudelnden Whirlpools.
„Los, sag was, Wolle, ha, ha“, spornte Kai ihn an.
Wolle pumpte Luft in sich, das T-Shirt spannte bis zum Äußersten, dann brüllte er los:
„Ihr wollt mich hier alle verarschen, was? Lachen auf meine Kosten, oder was? Wisst ihr, wie ich das nenne? He? Gottlos ist das!“
Wolle stand auf der Freitreppe wie King Kong auf dem Empire State Building, bereit zum Sprung auf die unter ihm liegende Meute.
Gespenstische Stille trat ein. Einige klappten die Liegen wieder runter und machten den Seelöwen. Vom hinteren Teil des Pooldecks riefen einige „Pfui“, „Dafür haben wir nicht bezahlt“, „Uns noch beschimpfen lassen! Sauerei! Wir wollen Spaß haben!“, „Was soll das mit Gott? Wir sind doch hier in keiner Kirche. Unverschämt. Ich bin Atheist!“
Kai und Jenny lösten sich erst langsam aus der Erstarrung, die sich ihrer bemächtigt hatte. Sie baten um eine kurze Unterbrechung und zogen Wolle in die Küche der Pool-Bar.
„Sag mal, du bist wohl völlig bescheuert“, erregte sich Kai, „du kannst doch nicht die Leute anpflaumen. Wir müssen die unterhalten, verstehst du? Sonst verlieren wir hier alle unseren Job!“ Jenny nickte heftig. Die beiden taten Wolle leid. Er hatte sie in richtig große Schwierigkeiten gebracht, weil er die Gepflogenheiten auf dem Schiff und die strengen Anweisungen für das Personal nicht kannte. Kleinlaut fragte er die beiden, was er tun solle, um die Scharte wieder auszuwetzen. „Keine Ahnung, lass dir was einfallen! Wir machen jetzt erst mal weiter.“
Jenny und Kai sprangen wieder aufs Freideck, zeigten beste Laune und begannen ein Quiz, bei dem Cocktails und andere leckere Preise winkten. Wolle dagegen saß geknickt in der Küche der Pool-Bar. Schon mit seinem ersten Auftritt hatte er sich viele Sympathien verscherzt! Wie sollte er da seine Vision umsetzen, Luthers kreatives Denken und sein Vertrauen in die höhere Macht unters Volk zu bringen, wenn er selbst so ein Spielverderber war? Der Mann aus Nazareth, erinnerte er sich, hat auf der Hochzeit zu Kana nicht die Party mit irgendwelchen Befindlichkeiten verdorben. Im Gegenteil, als der Wein alle war, hat er noch besseren besorgt, damit die Party weitergeht.
Auf Deck war sie schnell wieder da, die unverwechselbare, einzigartige NOFRETETE-Laune. Schepperndes, brüllendes, wieherndes Lachen auch beim dünnsten Witz, gierige Blicke beim Verteilen der Strohhalme auf richtige Fragen, die den erfolgreichsten Sammlern reiche Cocktail-Ausbeute in Aussicht stellten. Jenny und Kai hatten es binnen kurzer Zeit geschafft, den von Wolle angerichteten Flurschaden nicht nur einzudämmen, sondern vergessen zu machen. Das Quiz war abgeschlossen, viele zufriedene Gesichter. Die beiden Animateure setzten an, mit Waka-Waka, This Time for Africa von Shakira auf den nächsten Hafen, La Goulette in Tunesien, einzustimmen, da ertönte Wolles ein wenig pastoral wirkende Stimme unverkennbar aus dem Poollautsprecher. „Achtung, Achtung, eine Durchsage. Hier spricht ein reuiger Sünder. Wolle Luther hat sich noch nicht akklimatisiert auf dem Schiff. Er kennt den NOFRETETE-Code noch nicht. Doch gelobt er jetzt Besserung. Hinter dem Vorhang zur Pool-Bar steht eine kleine Versöhnungsgabe. Bitte bedient euch. Ende der Durchsage. Euer Wolle.“
Zwei Philippiner zogen den Vorhang, der vor der Pool-Bar aufgebaut war, auseinander und legten den Blick frei auf einen länglichen Tisch mit Hunderten Plastebechern voller frisch gezapften deutschen Pilsbieres. Eigentlich war das der Begrüßungstrunk des Kapitäns. Wolle aber hatte das erfahren, sich vergewissert, dass dieser nicht persönlich vorbeikam, sodann das Zweitmikrophon ergattert und sich die Runde Freibier auf die eigenen Fahnen geschrieben. Jenny, Kai und der philippinische Barchef der Pool-Bar durchschauten das Manöver. Allerdings sprangen die Seelöwen jetzt erstaunlich behände von ihren Liegen hoch und sicherten sich jeder einen, manche auch zwei der Halbliterbecher. Sie stießen auf Wolle an und ließen ihn hochleben. Dieser strahlte mit den kleinen Augen hinter seinem wallenden Bart hervor, stieß mit jedem fröhlich an und hatte am Schluss selbst einige Becher bei mittlerweile starker Sonnenhitze gekippt. Jenny und Kai waren froh, den Stimmungsfauxpas auf diese Weise ausgebügelt zu wissen. Waka Waka ertönte, und Wolle schritt stark hin und her wackelnd übers Deck und lud andere ein, ihm zu folgen, eine Polonaise zu bilden. Schon bald schlängelte sich ein langer Zug, darunter alle Jüngerinnen des Gesundheitsapostels Sebastian Kneipp aus Stuttgart-Bad Cannstatt und die sächsischen Imker mit Panamahüten, über Liegen, steuerbord an den Tischtennisplatten vorbei zur Afrika-Bar und backbord zurück. Die Stimmung war prächtig. Jenny und Kai strahlten um die Wette. Wolle fühlte sich ermutigt, die Polonaise nun auch die Freitreppe hinauf an den Whirlpools vorbei zum Sonnendeck zu führen. Der Zug geriet ein wenig ins Stocken, als Wolle mit seinen kurzen Beinen Stufe für Stufe der Freitreppe erklomm. Von hinten gab es einen leichten Druck der Polonaisemasse. Plötzlich spürte Wolle ein Kitzeln an seinem Oberschenkel, verursacht durch die Yucca-Palme, die zwischen den beiden oberen Whirlpools zur Staffage stand und afrikanische Assoziationen wecken sollte. Kitzeln hatte Wolle noch nie ertragen! Hinzu kam der Druck der nachrückenden Polonaiseschar und die Wirkung der Pilsbecher. Wolle strauchelte und stürzte mit einem riesigen Platsch in einen der Whirlpools. Zuerst der Kopf und dann der ganze Körper hinterher. Gierig schlürften die Düsen des Pools nach Wasser, das aber nur noch in Restmengen im Pool selbst vorhanden war, dafür in umso größerem Maße jetzt die Freitreppe hinunterströmte. Auf ähnliche Weise musste das Nördlinger Ries entstanden sein, als ein gewaltiger Meteorit einschlug. Wer die Entstehung von Impaktkratern nachvollziehen wollte, war hier Zeuge einer beeindruckenden geologischen Demonstration geworden.