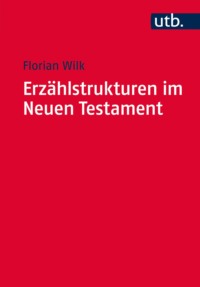Kitabı oku: «Erzählstrukturen im Neuen Testament», sayfa 3
2.4 Sprachorientierte Analyse
Jede als Text dargebotene Erzählung stellt eine »sprachliche Äußerung[ ]« dar, »die als Einheit betrachtet werden« kann[58]. Bei ihrer Segmentierung ist daher zu berücksichtigen, welche sprachlichen Mittel in ihr verwendet werden. Es kann freilich angesichts der Aufgabe, einen Überblick über ihren Aufbau zu gewinnen, nicht darum gehen, eine umfassende linguistische Analyse durchzuführen.[59] Vielmehr muss die Untersuchung auf Textmerkmale beschränkt werden, die an |18|der Textoberfläche liegen und dort der Abgrenzung und/oder Verknüpfung von Sinneinheiten dienen. Als solche Merkmale können gelten
die Einbindung von Sätzen, die direkte Rede anzeigen und damit jeweils eine weitere Kommunikationsebene in die Erzählung einführen,
Wiederholungen (von Satzfolgen, Aussagen oder Begriffen), die einzelne Abschnitte der Geschichte miteinander verknüpfen,
Wiederaufnahmen (von Personen oder Gegenständen bzw. Sachverhalten), die wesentlich zur Kohärenz des Textes beitragen, sowie
auffällige syntaktische Phänomene.[60]
Was Zusammenstellung und Auswertung dieser Merkmale erkennen lassen und was nicht, wird bei der Anwendung auf Lk 15,11b–32 gut sichtbar.
2.4.1 Metakommunikative Sätze mit folgender direkter Rede
Innerhalb der Erzählung[61] finden sich folgende Belege: a) Nach Lk 15,12a–c brachte der jüngere Sohn einen Wunsch vor den Vater; anstelle einer Antwort wird vom Vollzug des Erbetenen erzählt. b) In 15,17–19 wird ein Selbstgespräch jenes Sohnes zitiert, in dem er auch eine Ansprache an den Vater konzipierte (15,18afin.–19); es folgt (beginnend mit V. 20a) die Darstellung der Umsetzung seines Vorhabens. c) Laut V. 21 trug der Sohn dem Vater auf dessen wortlose Begrüßung hin den ersten Teil der geplanten Ansprache vor. Die Verse 22–24b bieten dann, statt einer Antwort an den Sohn, einen Auftrag des Vaters an seine Diener, dessen Erledigung V. 24c voraussetzt. d) V. 27 stellt dar, was eine Bursche, den der ältere Sohn gerufen hatte (V. 26init.), auf dessen in indirekter Rede angeführte Frage (V. 26fin.) antwortete; die Reaktion des Sohnes erfolgte ohne weitere Worte (V. 28a). e) Während V. 28b erzählt, wie der Vater diesem Sohn »zuredete«, wird zum Schluss ein Wortwechsel zwischen Sohn (15,29f.) und Vater (15,31f.) wörtlich wiedergegeben.
Die Relevanz der Sequenzen aus Redeeinleitung und direkter Rede erhellt schon daraus, dass sie insgesamt gut die Hälfte des Textes ausmachen.[62] Zudem enthalten sie Wertungen des Geschehens.[63] In der Tat lassen sie sich anhand der Identitäten von Sprecher und Adressat sowie des jeweils Gesagten zu Gruppen verbinden, die den Aufbau der Erzählung erkennbar machen. Zuerst redet nur der jüngere Sohn: Er fordert den Vater auf, ihm sein Erbteil auszuzahlen (Lk 15,12a–c), und bereitet damit seinen Fort- sowie Niedergang vor; er gedenkt im Selbstgespräch seines Vaters und plant Aufbruch und Rückkehr (15,17–19), inklusive einer Ansprache an ihn; angekommen – und voll Mitleid begrüßt –, bekennt er dem Vater, gesündigt und den Sohnesstatus verspielt zu haben (V. 21). Daraufhin spricht der Vater, wendet sich aber an seine Diener (15,22–24b); das in Auftrag gegebene Fest wird sofort begonnen. Ab V. 25 ist es der ältere Sohn, der Gespräche führt: zunächst mit einem der Burschen, der, herbeigerufen und befragt, ihm erklärt, warum es ein Fest gibt (15,26f.); sodann mit dem Vater, der |19|ihm in seinem Zorn zuredet (V. 28a–b) und auf seinen Protest hin (15,29f.) das Schlusswort spricht, das ihn der Gemeinschaft mit dem Vater versichert, zugleich aber das Fest für den »Bruder« für notwendig erklärt (15,31f.). Demnach ist der Text wie folgt zu gliedern:

Diese Betrachtungsweise lässt die Zweiteiligkeit der Erzählung (mit der Grenze zwischen Lk 15,24 und 25) klar zutage treten. Sie macht darüber hinaus deutlich, dass auf der erst entworfenen,[64] dann dem Vater vorgetragenen Ansprache des jüngeren Sohnes (15,18b–19.21) – der Sache nach also auf dessen Reue und Umkehr – ein starker Akzent liegt. Nicht zuletzt vermittelt sie die Einsicht, dass die beiden Hauptteile zum Ende hin parallel strukturiert sind: Beiden Söhnen kam der Vater freundlich entgegen (V. 20b, V. 28b); beide betonten, auf je eigene Weise, ihre innere Distanz zum Vater (V. 21 und 15,29f.); beide vergewisserte er daraufhin ihrer Gemeinschaft mit ihm (V. 22b–c, V. 31b–d)[65], um abschließend hier wie dort von dem Fest zu sprechen, mit dem die Rückkehr des jüngeren Sohnes ins Leben gefeiert wurde (15,23–24b und 32). Freilich richtet sich das Wort des |20|Vaters in 15,22–24b an seine Diener. Ihnen, die er zu Mitfeiernden gemacht hat (V. 23c.24c), wird also in der Erzählung der ältere Sohn gegenübergestellt, der sich fernhielt und von dem am Ende offen bleibt, ob er sich zur Mitfreude bewegen ließ.
Am Beispiel von Lk 15,11b–32 zeigt sich somit: Anhand der Einbindung wörtlich zitierter Äußerungen von und Gespräche zwischen den Protagonisten einer Erzählung kann man einen Überblick über ihre Anlage gewinnen und erkennen, welche Rollen jene Figuren in einzelnen Abschnitten und im Gesamtgefüge des Textes einnehmen. Zudem wird sichtbar, welche Impulse das Fortschreiten der Handlung bewirken. Offen bleibt freilich, in welchem hierarchischen Verhältnis zueinander die einzelnen Sequenzen stehen und welche Sinnlinien sie miteinander verbinden; dabei geraten auch begriffliche Differenzierungen (wie die zwischen »dein Sohn« in V. 30a und »dein Bruder« in V.32b) aus dem Blick. Eine sprachorientierte Analyse muss deshalb auch die »Wiederaufnahmestruktur«[66] eines Textes erheben. Deren auffälligstes Element ist die schlichte Wiederholung; sie ist deshalb als Nächstes zu erörtern.
2.4.2 Wiederholungen
Innerhalb von Lk 15,11b–32 werden an zwei Stellen ganze Sätze wiederholt: In V. 21b–d zitiert der jüngere Sohn die ersten zwei Drittel seiner in 15,18b–19b konzipierten Ansprache; der letzte Teil des Konzepts: »Mache mich wie einen deiner Tagelöhner«, wird durch den unmittelbar auf sein Schuldeingeständnis folgenden Auftrag des Vaters an die Diener, den Heimkehrer feierlich als Sohn willkommen zu heißen (15,22–24b), verdrängt. In V. 32 weist der Vater seinen älteren Sohn dann mit signifikanten Modifikationen auf denselben Zusammenhang hin, den er in 15,23c–24b den Dienern angezeigt hat:
| 15,23c–24b | 15,32 |
| »Lasst uns essen und feiern, | »(Jetzt) aber war es nötig, zu feiern und fröhlich zu sein, |
| denn dieser mein Sohn war tot | denn dein Bruder da war tot |
| und ist wieder lebendig geworden, | und ist lebendig geworden, |
| er war verloren | und (er war) verloren |
| und ist gefunden worden.« | und ist gefunden worden.« |
Beide Wiederholungen verstärken die innere Geschlossenheit des Gesamttextes;[67] im Übrigen erfüllen sie jedoch verschiedene Funktionen. Das wörtliche Zitat von 15,18b–19a in V. 21b–d unterstreicht, dass gerade das Schuldbekenntnis den Vater veranlasste, die feierliche Aufnahme des Heimgekehrten als seines Sohnes zu vollziehen – und markiert somit unübersehbar die aus dem Elend ins Fest führende Wende auf dessen Lebensweg. Dies Zitat verknüpft also Teilabschnitte innerhalb des dem jüngeren Sohn gewidmeten Teils der Erzählung. Die Variation von 15,23c–24b in V. 32 verstärkt hingegen den Kontrast zwischen den Dienern, die eingeladen wurden, an der Freude des Vaters über die Rettung des jüngeren Sohnes teilzuhaben, und dem älteren Sohn, der genau jene Freude nicht teilte, |21|damit aber seine Aufgabe als Bruder des Jüngeren verfehlte. Diese Variation hebt also die analoge Zuspitzung der auf je einen der Söhne fokussierten Hauptteile hervor. So zeigt sich: Wiederholungen können auf verschiedenen Ebenen der Erzählung als Gliederungsmerkmale dienen; gewichten lassen sie sich jedoch nur aufgrund einer mit anderen Kriterien vorgenommenen hierarchischen Ordnung jener Ebenen.
Dies wird noch deutlicher im Blick auf die Aussagen zur Schlachtung des »Mastkalbes«. Dreimal ist davon die Rede – nacheinander in der Anweisung des Vaters, im Bericht des Burschen und im Protest des älteren Sohnes:
15,23: »und holt das Mastkalb, schlachtet es, und lasst uns essen und feiern.«
15,27: »… Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet …«
15,30: »als aber dein Sohn da … kam, hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet.«
Die doppelte Wiederholung signalisiert, dass etwas Außergewöhnliches vollzogen wurde: ein Akt, der zugleich die große Freude des Vaters ausdrückt und den zornigen Protest des älteren Sohnes erklärt.[68] Damit aber knüpft sie die Begegnungen des älteren Sohnes mit Bursche und Vater an das Fest, mit dessen Eröffnung die Darstellung der Heimkehr des jüngeren Sohnes schließt.
Verschiedenen Zwecken dienen auch die Wiederholungen bestimmter Ausdrücke. So markiert die Aufnahme des Adjektivs μακρά »fern« aus Lk 15,13 (»ein fernes Land«) im Adverb μακράν (V. 20b: »Als er … noch fern war …«) den Beginn des Abschnitts, der die Rückkehr des ausgewanderten Sohnes behandelt. Zuvor werden zum einen sein Selbstgespräch durch zwei Hinweise auf die »Tagelöhner« (V. 17b.19b), zum andern die ganze Schilderung seines inneren wie faktischen Aufbruchs durch Kombinationen des Reflexivpronomens ἑαυτόν/ἑαυτοῦ mit dem Verb »gehen« (V. 17a: »Er … ging in sich …«; V. 20a: »… und ging zu seinem eigenen Vater«) gerahmt; dabei repetiert V. 20a zugleich die Formulierung ἀναστὰς … πρὸς τὸν πατέρα aus V. 18a. Die Rede vom tötenden »Hunger« (λιμός) des Sohnes in V. 17c greift die Erwähnung der »schweren Hungersnot« (λιμὸς ἰσχυρά) in V. 14a auf, verknüpft also sein Selbstgespräch (15,17–19) mit der Darstellung seines Elends (15,14–16). Später zeigt die Umsetzung des Adhortativs »lasst uns feiern« (V. 23fin.) in die Aussage »und sie begannen zu feiern« (V. 24c) das Ende des Hauptteils an, der vom Werdegang des jüngeren Sohnes handelt; die erneute Aufnahme des Verbs »feiern«[69] im Disput zwischen älterem Sohn (V. 29fin.: »auf dass ich … feiere«) und Vater (V. 32a: »… war es nötig zu feiern …«) unterstreicht dann, wie der Schluss der Erzählung auf den jenes Hauptteils zurücklenkt.
Im letztgenannten Zusammenhang ist eine weitere Beobachtung bedeutsam. Die Erwähnung der δούλοι »Diener« in Lk 15,22a spiegelt sich im Selbstporträt des älteren Sohnes wider, der in V. 29b von sich sagt: »Siehe, so viele Jahre diene (δουλεύω) ich dir …« Der Erzähler verstärkt also den Kontrast zwischen den Dienern, die auf Anweisung des Vaters das Fest der reuigen Heimkehr des jüngeren Sohnes nicht nur ausrichteten, sondern auch mitfeierten (V. 23c.24c), und dem älteren Sohn, der dem Fest für seinen Bruder voller |22|Zorn fernblieb (V. 28a),[70] dadurch, dass er jenen Sohn sich selbst die Rolle eines Dieners zuschreiben lässt.
So dienen Wortwiederholungen in 15,11b–32 zur Kennzeichnung von Neueinsätzen (vgl. V. 20b nach V. 13), zur Rahmung von Abschnitten (vgl. V. 17a / 20a und V. 17b / 19b), zur Verklammerung von Absätzen (vgl. V. 17c im Gefolge von V. 14), zur Anzeige eines Abschnittsendes (vgl. V. 24c nach V. 23fin.) etc. Wie und auf welcher Ebene der Erzählung sie auf deren Aufbau hindeuten, kann man deshalb nur im Verein mit weiteren, deutlich segmentierenden Textmerkmalen entscheiden. Dies gilt umso mehr, als manche begrifflichen Doppelungen für die Gliederung wenig bis gar nichts besagen.[71]
Demnach ist festzuhalten: Wiederholungen von Sätzen, Aussagen und Begriffen können innerhalb einer Erzählung durchaus Grenzen oder Verknüpfungen zwischen einzelnen Abschnitten anzeigen; verlässlich in diesem Sinne deuten darf man sie jedoch nur im Konnex mit anderen, klaren Gliederungsmerkmalen. Wie aber steht es mit Rückbezügen, die sich nicht (primär) auf begrifflicher, sondern auf funktionaler und semantischer Ebene vollziehen?
2.4.3 Wiederaufnahmen
»Die explizite Wiederaufnahme besteht in der Referenzidentität bestimmter sprachlicher Ausdrücke in aufeinanderfolgenden Sätzen eines Textes.«[72] Eine »implizite Wiederaufnahme« liegt dort vor, wo zwischen den Bezeichnungen »bestimmte … semantische Beziehungen« wie z.B. eine »Teil-von-Relation« bestehen.[73] Solche Wiederaufnahmen sind für die Struktur einer Erzählung zumal dann bedeutsam, wenn sie an den Handlungsträgern und den zentralen Gegenständen oder Sachverhalten des Textes vollzogen werden.
Achtet man zunächst darauf, wo und wie in Lk 15,11b–32 die Handlungsträger eingeführt und wieder aufgenommen werden, so ergibt sich folgender Befund: Als Hauptfigur wird in Lk 15,11b »ein Mensch« mit zwei Söhnen benannt. Er heißt im Weiteren »der Vater« (V. 12a.22a) bzw., mit Bezug auf den einen oder anderen Sohn, »sein Vater« (V. 20a.b, V. 28b.29a); bisweilen wird er auch nur mit Artikel im Nominativ (V. 12d.31a) oder Personalpronomen (V. 21a: Dativ, V. 22a.25a: Genitiv) bezeichnet.
Innerhalb von Passagen direkter Rede wird er zum einen als »mein Vater« (so der jüngere Sohn in Lk 15,17b.18a) oder »dein Vater« (so der Bursche in V. 27b) betitelt, zum andern auf verschiedene Weisen angesprochen: vom jüngeren Sohn als »Vater« (V. 12b.18b.21b) und mit Imperativen (V. 12c.19b), von beiden Söhnen mit Pronomina der 2. Person Singular (15,18c–19b.21c–d, V.29b.30a), vom älteren Sohn auch mit Verben derselben Person (V. 29c.30b); zweimal spricht er zudem von sich selbst in der 1. Person Singular (V. 24a.31c–d), und einmal fasst er sich mit den Dienern in der 1. Person Plural zusammen (V. 23c).
|23|Die beiden Söhne kommen gemeinsam nur in Lk 15,11b sowie – bezeichnet durch Personalpronomina der 3. Person Plural – in V. 12a.d in den Blick, freilich nie als Handlungssubjekte.[74]
Danach ist primär vom jüngeren Sohn die Rede. Er wird in Lk 15,12a »der jüngere von ihnen«, in V. 13 »der jüngere Sohn« und in V. 21a »der Sohn« genannt. In 15,13fin.–16b und 20b verweisen je fünf Personalpronomina der 3. Person Singular, in V.17a und V. 20a je ein Reflexivpronomen derselben Person auf ihn; zudem fungiert er als Subjekt der Verben in V. 15a.16a.
In den Passagen direkter Rede heißt er »dieser mein Sohn« aus Sicht des Vaters (Lk 15,24a), »dein Bruder« im Mund des Burschen (V. 27a), »dein Sohn da« aus Sicht des älteren Sohnes (V. 30a) und »dein Bruder da« im Mund des Vaters (V. 32b); er selbst spricht sich in V. 19a.21d in Bezug auf seinen Vater den Titel »dein Sohn« ab. Ferner sind innerhalb der direkten Rede Personalpronomina der 1. und 3. Person Singular (15,12c.17b–18a.19b und V. 22b–c.27c.30b) sowie Verben der 1. Person Singular (15,18a–19a.21c–d) auf ihn bezogen.
Der andere Sohn wird erst in Lk 15,25a mit der Angabe »sein (sc. des Vaters) älterer Sohn« eingeführt und fortan mit Artikel im Nominativ (V. 29a) oder mit Personalpronomen (V. 27a.31a: Dativ, V. 28b: Genitiv und Akkusativ) bezeichnet; außerdem agiert er in 15,25b–26 und 28a als Subjekt.
Innerhalb direkter Rede wird er in Lk 15,27a–b (vom Burschen) und V. 31c–d.32b (vom Vater) mit Personalpronomina der 2. Person Singular, in V. 31b überdies mit dem Ausdruck »Kind« adressiert; in V. 29b.c spricht er mit Verben und Personalpronomina der 1. Person Singular von sich selbst.
Von den weiteren Erzählfiguren werden die »Freunde« des älteren Sohnes nur einmal in wörtlicher Rede genannt (Lk 15,29c). Die übrigen nimmt der Erzähler nach ihrer Vorstellung auf verschiedene Weisen wieder auf: Erstens ist nach dem Verweis auf »einen der Bürger jenes Landes« (V. 15a) erst von »seinen Feldern« (V. 15b), dann implizit von sonstigen Bewohnern des Landes (V. 16b: »niemand«) und schließlich von dort lebenden »Huren« (V. 30a) die Rede. Zweitens beginnt und endet das Selbstgespräch des jüngeren Sohnes mit einem Blick auf die »Tagelöhner« des Vaters (V. 17b.19b). Drittens wird aus der Gruppe der »Diener« (V. 22a) – an die der Vater etliche Imperative richtet (15,22b–23b) – einer noch zweimal erwähnt: in V. 26 mit der Angabe »einer der Burschen« und in V. 27a mit dem Artikel im Nominativ.
Während die je neu anzustellenden »Tagelöhner« von den dauerhaft tätigen »Dienern« unterschieden werden müssen, herrscht dem lukanischen Sprachgebrauch zufolge zwischen Letzteren und den »Burschen« Referenzidentität.[75] Allerdings setzen beide Begriffe unterschiedliche Akzente: Während δοῦλος auf ein durch »unaufhebbare Pflichterfüllung und Dienstleistung« geprägtes Dasein und somit auf dessen »Bindung an einen Übergeordneten« hinweist,[76] unterstreicht παῖς als »Sammelbegriff für die im Haus dem Herrn unterstehenden Glieder des Hausstandes« deren »Zugehörigkeit« zum Haus[77]. Der Be|24|griffswechsel fällt umso mehr auf, als die Erwähnung der Diener (Lk 15,22a) implizit auch in den pluralischen Verbformen in V. 23c (»lasst uns feiern«) und V. 24c (»und sie begannen zu feiern«) wiederaufgenommen wird, durch die sie mit dem Vater – und im zweiten Fall wohl auch mit dem jüngeren Sohn – verbunden sind. Der bereits notierte[78] Kontrast zwischen den mitfeiernden Dienern und dem sich fernhaltenden älteren Sohn wird also noch dadurch verstärkt, dass jene im Verlauf des Festes als Glieder des väterlichen Hauswesens erscheinen.
Dieser Befund ist nun zu komplex, um in einer Textübersicht abgebildet und somit für die Gliederung des Textes ausgewertet werden zu können. Dazu ist eine Konzentration auf die wesentlichen Daten erforderlich. Zu diesen gehört erstens die Abfolge begrifflicher Substitutionen, bei denen der Erzähler die Erstbezeichnung eines Handlungsträgers (z.B. »ein Sohn«) präzisiert (»der jüngere Sohn«), determiniert (»der Sohn«), relational bestimmt (»sein Sohn«) oder pronominalisiert (»er«) und dann – durch Rückgriff auf eine der vorausliegenden Substitutionsstufen – wieder renominalisiert.[79] Zumal die Renominalisierung ist relevant, da sie oft anzeigt, dass eine Erzählfigur erneut aktiv oder nach längerer Zeit wieder erwähnt wird,[80] in jedem Fall aber ihrer Erwähnung besonderes Gewicht verleiht. Bedeutung hat zweitens, ob eine Person als Subjekt oder Objekt eines Satzes fungiert und ob eine direkte Rede an sie gerichtet ist oder von ihr handelt. Drittens ist zu beachten, welche Beziehungen zwischen den Handlungsträgern durch relationale Bestimmungen oder durch mehrere Personen betreffende Aussagen geknüpft werden.
Unter diesen Gesichtspunkten lässt sich die Wiederaufnahmestruktur der Erzählung Lk 15,11b–32 hinsichtlich der Handlungsträger in der nebenstehenden Tabelle darstellen. Sie gibt zu erkennen:
1 Die Einleitung in diese Geschichte von »ein(em) Mensch(en)« und seinen »zwei Söhne(n)« erfolgt in Lk 15,11b–12; sie benennt die Figurenkonstellation und die auf Initiative des jüngeren der Söhne vom Vater für beide geschaffene Ausgangssituation.
2 Lk 15,13 eröffnet den ersten Hauptteil, in dem »der jüngere Sohn« die zentrale Figur darstellt. Der Handlungsstrang reicht vom Fortgang in ein fernes Land bis zum Sündenbekenntnis bei der Heimkehr (V. 21). Dabei wird in 15,15f. ausdrücklich von Kontakten zu Bewohnern jenes Landes erzählt; anschließend heißt es, er gehe »in sich« (15,17–19) und erneuere gedanklich die Beziehung zu »(s)einem Vater«, in der er jetzt aber nicht mehr dessen »Sohn« heißen, sondern nur noch als »Tagelöhner« für ihn arbeiten könne; Aufbruch (V. 20a) und Annäherung ans Haus ziehen dann die Begrüßung durch »sein(en) Vater« nach sich (V. 20b), die »der Sohn« mit seinem Bekenntnis beantwortet (V. 21).
3 In Lk 15,22a lenkt der Ausdruck »der Vater« auf die Einleitung zurück. Die folgende Rede (15,22b–24b) bildet den Höhe- und Wendepunkt der Erzählung: Einerseits rundet sie den ersten Hauptteil ab, insofern hier der Heimkehrer – in antithetischer Aufnahme des vorgetragenen Bekenntnisses – vom Vater »dieser mein Sohn« (V. 24a) genannt wird. Andererseits begründet der |26|Zusammenschluss des Vaters mit »den Dienern« zu einem »Wir« (V. 23c) eine neue Gemeinschaft, deren gemeinsames Handeln (V. 24c) den Rahmen der anschließend dargestellten Begegnungen schafft.
4 Der Blick auf »sein(en) ältere(n) Sohn« in Lk 15,25 leitet den Schlussteil ein. Dessen Ziel wird bereits im Gespräch mit »einem der Burschen« erkennbar, weist dieser doch dem Sohn mit den Bezeichnungen »dein Bruder« und »dein Vater« (V. 27) diejenige Rolle im Familienverband zu, die er einnehmen müsste. Im anschließenden Dialog macht ihm »sein Vater« auf seinen Protest hin diese Aufgabe unmissverständlich klar, indem er einerseits ihn seiner Stellung als »Kind« vergewissert, andererseits seine distanzierende Redeweise »dein Sohn da« durch die Rede von »dein(em) Bruder da« korrigiert. Zugleich greift der Dialog mit der Aussage »ich diene dir« die Festgemeinschaft des Vaters mit den Dienern (15,22a.23.24c), mit dem Ausdruck »dein Sohn da« die Aufnahme des reuigen Sünders durch den Vater (15,18f.20b–21.22b–c.24a–b) und mit der Erwähnung von »Huren« das Leben des jüngeren Sohnes in der Fremde (15,13–16) auf und führt auf diese Weise alle wichtigen Fäden der Erzählung zusammen.

Wie sich an Lk 15,11b–32 zeigt, hilft diese Betrachtungsweise dazu, eine Erzählung plausibel zu strukturieren; sie macht zudem die Funktion der einzelnen Abschnitte im Verhältnis zueinander und somit das narrative Gefälle des Textes erkennbar. In einer Übersicht lässt sich Letzteres wie folgt darstellen:

Die Fokussierung auf die Bezeichnungen der Handlungsträger ist freilich relativ einseitig; die Anlage der Erzählung in zeitlichen und räumlichen Dimensionen bleibt dabei ebenso unberücksichtigt wie ihre thematische Ausrichtung.
Der letztgenannte Mangel lässt sich nun dadurch beheben, dass man verfolgt, wie die wesentlichen Gegenstände und Sachverhalte der Erzählung in deren |27|Verlauf wieder aufgenommen werden. Hierzu sind folgende Verknüpfungen zu verzeichnen:
a) Das vom jüngeren Sohn anteilig erbetene, vom Vater aufgeteilte Erbe wird in Lk 15,12c (vom Sohn) οὐσία »Gut«, in V. 12d (vom Erzähler) βίος »Eigentum« genannt.[81] Der dem Sohn zustehende Anteil (τὸ ἐπιβάλλον μέρος) wird in V. 13init. mit dem Ausdruck πάντα »alles« wiederaufgenommen; danach wird dreimal auf die Verschwendung dieses Anteils verwiesen: Der Sohn habe »sein Gut vergeudet« (V. 13fin.), »alles ausgegeben« (V. 14a) und – so hält es der ältere Sohn dem Vater vor – »dein Eigentum … aufgezehrt« (V. 30a). Der andere, in V. 12d implizit dem älteren Sohn zugesprochene Erbteil wird in V. 31d vom Vater erwähnt, indem er jenem Sohn gegenüber feststellt: »alles (πάντα), was mein ist, ist dein«.[82] In den Blick gerät dieser Erbteil freilich schon vorher: zum einen in der Nennung der »Tagelöhner«, die beim Vater in Lohn und Brot stehen (V. 17b.19b), zum andern mit dem »Ring«, den der Vater dem jüngeren Sohn »an seine Hand« stecken lässt (V. 22c) – denn damit gibt er dem Heimkehrer erneut die Verfügungsgewalt, die ihm als Sohn zustand, die er mit dem Empfangen seines Anteils aber aufgegeben hatte.[83]
Die logische Spannung, die damit zu der Zusage des Vaters an den älteren Sohn: »alles, was mein ist, ist dein« (Lk 15,31d), entsteht, gehört gerade zu der »Zumutung des Irrealen«[84], die die Erzählung als Gleichnis, als metaphorische Rede von Gott, ausweist.
b) Die »heillose Lebensweise« (Lk 15,13fin.) des jüngeren Sohnes gipfelt in seiner Arbeit als Schweinehirte (15,15f.)[85]; in V. 18c und V. 21c wertet er selbst sie als Sünde »gegen den Himmel und vor dir (sc. dem Vater)«. Der Vater bestätigt die Wertung, indem er erst zu den Dienern (V. 24), dann zum älteren Sohn (V. 32) sagt: »Dieser … war tot … [und] verloren«. Dabei lassen der Rückbezug seines Kommentars auf die reuevolle Rückkehr des jüngeren Sohnes (15,20b–21) und der Kontrast zu seiner an dessen Bruder gerichteten Feststellung: »du bist allezeit bei mir« (V. 31c), erkennen, dass jedenfalls der Vater schon den Fortgang jenes Sohnes »in ein fernes Land« (vgl. V. 13) als Schritt in den »Tod« ansieht.[86] In V. 30a spricht zudem der Bruder den Vater auf die heillose Lebensweise des Jüngeren an; indem er diesem vorwirft, er habe mit Huren »dein (sc. des Vaters) Eigen|28|tum … aufgezehrt«, bezieht er auch die Vergeudung des zugeteilten Gutes (vgl. 15,13–14init.) ein. Dass der jüngere Sohn infolge dieser Vergeudung Mangel und Hunger litt (V. 14b.16), wird an sich nur innerhalb seines Selbstgespräches aufgenommen: »ich komme hier vor Hunger um« (V. 17c); über das doppeldeutige Stichwort ἀπόλλυμαι »ich komme um / bin verloren« ist das Motiv des tötenden Hungers jedoch auch mit den Kommentaren des Vaters in V. 24b.32c verbunden[87].
c) Der jüngere Sohn plant (Lk 15,18f.) und vollzieht (V. 20a.21) seine Rückkehr zum Vater; dieser heißt ihn willkommen (V. 20b) und bestätigt mit einem Auftrag an die Diener die Aufnahme des Sohnes in das Haus (V. 22). Rückkehr und Aufnahme werden dann mehrfach kommentiert: zuerst und zuletzt vom Vater (V. 24a–b.32b–c: »dieser … ist [wieder] lebendig geworden, … gefunden worden«), dazwischen vom Burschen (V. 27: »… dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat …, weil er ihn gesund zurückerhalten hat«[88]) und vom älteren Sohn (V. 30a: »als aber dieser dein Sohn … kam«).
d) Die mit der Schlachtung des Mastkalbes eingeleitete Feier der Rückkehr des jüngeren Sohnes wird vom Vater angeordnet (Lk 15,23), von allen Beteiligten begonnen (V. 24c) und dann eingehend besprochen: Der Erzähler notiert, der ältere Sohn habe »Musik und Tanz« gehört (V. 25c), sich bei einem Burschen erkundigt, »was dies sei« (V. 26fin.), und sich nach dessen Auskunft entschieden, »nicht hinein(zu)gehen« (V. 28a). Ferner reden Bursche (V. 27b) und älterer Sohn (V. 30b) davon, dass der Vater »das Mastkalb geschlachtet« hat.[89] Auf den Protest des Älteren hin – dass der Vater ihm trotz seines treuen Dienstes »niemals eine Ziege gegeben« habe, »auf dass ich mit meinen Freunden feiere« (V. 29c) – betont der Vater dann, es sei »nötig« gewesen, »zu feiern« und, wie es jetzt ausdrücklich heißt, »fröhlich zu sein« (V. 32a).
e) In seinem Protest gegen das Fest weist der ältere Sohn mit der Aussage »so viele Jahre diene ich dir« (V. 29b) zumindest auf die seit der Erbteilung (V. 12d) verstrichene Zeitspanne zurück, vielleicht auch auf das Dasein beim Vater insgesamt (V. 11b). Letzteres ist auf jeden Fall in der Antwort des Vaters im Blick, wenn dieser ihn als »Kind« anspricht und ihm in Erinnerung ruft: »Du bist allezeit bei mir« (V. 31c).
Insgesamt ergibt sich zur Wiederaufnahme von Gegenständen und Sachverhalten in Lk 15,11b–32 das nebenstehend abgedruckte Bild. Es macht deutlich, wie die oben anhand der Bezeichnungen der Handlungsträger definierten Hauptteile und Szenen miteinander verbunden sind, und darüber hinaus auf weitere Übergänge aufmerksam:

1 |30|Die Notiz, dass der jüngere Sohn »alles zusammengeholt hatte« (V. 13init.), schließt die Darstellung der Erbteilung in V. 12 ab.[90]
2 Die Schilderung seines verschwenderischen Lebens (V. 13) gipfelt in dem Satz, er habe begonnen zu darben (V. 14b); und die ab V. 15 geschilderte Elendssituation spiegelt der Auftakt seines Selbstgesprächs (V. 17) wider.
3 Planung und Vollzug der Umkehr zum Vater (15,18–20a) münden in dessen von Mitleid bestimmtes Entgegenkommen (V. 20b); und das Bekenntnis, gesündigt zu haben, zieht – über die Hoffnung auf Anstellung als Tagelöhner (V. 19) hinaus – die Wiederaufnahme als Sohn (V. 22) nach sich.
4 Die Beschreibung des Festes in 15,23f. wird mit dem Hinweis vollendet, der ältere Sohn habe bei seiner Annäherung ans Haus »Musik und Tanz« gehört (V. 25b–c); und seine auf die Befragung eines Burschen (15,26f.) folgende Weigerung »hineinzugehen« (V. 28a) führt dazu, dass der Vater »herauskam und ihm zuredete« (V. 28b).
Zudem wird beim Blick auf die Gegenstände und Sachverhalte ein zweiphasiger Verlauf der Geschichte erkennbar: Zunächst erweist sich V. 22 dadurch als Höhepunkt, dass der Vater hier den jüngeren Sohn mit dem Auftrag zur Übergabe des besten Gewands und des Rings erneut in die eingangs aufgehobene Haus- und Erbengemeinschaft aufnimmt. Sodann zeigt sich, wie der Passus 15,30–32 die Erzählung abrundet: Hier kommen alle zuvor eingeführten Gegenstände und Sachverhalte noch einmal zur Sprache, und hier wird die ab V. 11b behandelte Zeitspanne insgesamt überblickt. Die in letztgenannter Hinsicht vorgenommene Fokussierung auf den älteren Sohn setzt freilich schon in V. 29 ein.
Eine an diesen Beobachtungen orientierte Gliederung sähe wie folgt aus:

|31|Solch eine Gliederung lässt vor allem die narrativen Verknüpfungen und damit den inneren Zusammenhang einer Erzählung zutage treten; sie bringt insofern auch ihre thematische Ausrichtung zur Geltung. Freilich überdeckt sie die Einschnitte zwischen den einzelnen Szenen, die durch zeitliche Abstufungen, Ortsveränderungen oder Wechsel im Personentableau markiert werden.
Bei beiden Varianten einer wiederaufnahme-orientierten Gliederung wird darüber hinaus außer Acht gelassen, wie der Text syntaktisch gestaltet ist. Diese Gestaltung ist deshalb im Folgenden auf ihre Bedeutung für den Aufbau einer Erzählung hin zu analysieren.