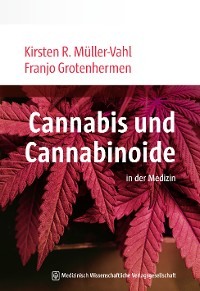Kitabı oku: «Cannabis und Cannabinoide», sayfa 9
Samen
Bei den Samen der Hanfpflanze handelt es sich um ovale Nüsse, die aus einsamigen Fruchtknoten entstehen und in verschiedenen Farben erscheinen können (vgl. Abb. 14); von hell oder cremefarben bzw. gelblich bis orangefarben bis hin zu braun, grau und schwarz. Zuweilen weisen die Samenkörner eine Marmorierung auf. Dabei müssen die Samen auch an einer einzigen Pflanze nicht homogen erscheinen, sondern können von der Färbung und Textur her variieren. Verantwortlich für das unterschiedliche Aussehen von Hanfsamen sind unter anderem anthocyanhaltige Moleküle, die in Palisadenzellen oder subepidermalen Schichten des Saatguts entweder anwesend sind oder fehlen.

Abb. 14 Samenkörner einer Marihuanapflanze
Blätter
Die typischen Blätter des Hanfes erscheinen mit fünf bis elf Blattfingern, die am Rand gezahnt sind und lanzettförmig wachsen. Je nach Art und Form der Pflanze sind die Blattspreiten (Lamina) entweder eher breit, ausladend und von dunkelgrüner Farbe (Richtung indica) oder schmaler und eher länglich und von hellgrüner Färbung (Richtung sativa). Beim ersten, dem Samen entspringenden Blattpaar handelt es sich um die Keimblätter (Kotyledonen), bevor das erste echte Blattpaar erscheint. Dieses besteht aus jeweils einem Einzelblättchen oder Blattfinger, gefolgt von einem Blattpaar mit je drei Fingern. Anschließend bilden sich Blätter mit fünf Blattfingern und so weiter. Bis zu elf solcher Einzelblättchen kann ein Hanfblatt schließlich aufweisen. Zuweilen kann bereits das erste echte Blattpaar, das auf die Kotyledonen folgt, drei Einzelblättchen aufweisen, gefolgt von einem weiteren mit fünf Blattfingern und so weiter.
Wachstumszyklen
Cannabis unterliegt verschiedenen Wachstumszyklen, so zunächst der vegetativen Phase, in der die Vegetationsorgane ausgebildet werden. Der vegetativen Phase folgt die generative, auch reproduktive Phase, die der Sicherung der Fortpflanzung dient. Der richtige Reifepunkt einer Pflanze hängt von diversen Parametern ab, zum Beispiel von der Photoperiode (Tageslänge), vom Alter der Pflanze und weiteren Umwelteinflüssen. Nach etwa zwei Monaten in der vegetativen Wachstumsphase ist die Hanfpflanze für die Blüte bereit. Wenn nach dem 21. Juni die Tage wieder kürzer werden, geht die Pflanze in die Blütephase über. Während der Blüte weisen neu austreibende Blätter weniger Einzelblättchen auf, sind die Blütenstände vollständig ausgeprägt, wachsen nur noch kleine Blätter mit drei oder auch nur einem Blattfinger nach. Nach der Blüte setzt schließlich ein Alterungsprozess (Seneszenz) ein, bei dem die Blätter nach und nach vergilben und abfallen, und der mit dem Tod der Pflanze endet. Weibliche Pflanzen leben dabei bis zu drei Monate länger, um noch ihren Samen produzieren zu können. Männliche Pflanzen blühen hingegen schneller und geben ihren Pollenstaub frei.
Cannabis ruderalis bildet, was die Abhängigkeit von der Tageslänge zur Einleitung der Blüte angeht, eine Ausnahme. Diese Art beginnt unabhängig von der Photoperiode ab einem gewissen Reifestadium mit der Blütenbildung. Dies ist häufig zwischen der Entwicklung des fünften und siebten Nodiums (Blattpaares), also nach spätestens zwei Monaten der Fall. Moderne Hybriden vereinen diese Eigenschaft des Ruderalhanfs mit den potenten psychoaktiven Eigenschaften anderer Sorten, sodass Cannabisanbauer, die im Haus anbauen, nicht mehr auf die strikte Einhaltung der Lichtzyklen achten müssen.
Männliche versus weibliche Cannabispflanzen
Als potenzielle Medizinalpflanzen sind die weiblichen Cannabispflanzen ausschlaggebend, denn diese bilden deutlich mehr Drüsenhaare aus als männliche Pflanzen (weshalb von Hanfanbauern die Anzucht weiblicher Pflanzen präferiert wird – männliche Exemplare dienen im Grunde ausschließlich der Zucht). Bei diesen Drüsenhaaren, von denen es drei verschiedene Typen gibt (birnenförmige Drüsen, ungestielte Kopfdrüsen und gestielte Kopfdrüsen), handelt es sich um die Cannabinoidquellen der Pflanzen. „Allgemein sind sich die meisten Forscher darüber einig, dass der von den Drüsenhaaren abgesonderte Harz die psychoaktiven Bestandteile der Hanfpflanze enthält. Forschungen von Fujita et al. (1967) weisen jedoch darauf hin, dass die scheibenförmige Zellkappe des Drüsenhaares und nicht das von diesen Zellen abgesonderte Harz das psychoaktive THC enthalten“ (Clarke 1997: 214). Einfache Pflanzenhaare (Trichome), die aus einer einzelnen Zelle bestehen, sind an der gesamten Pflanze zu finden, mit Ausnahme des Wurzelbereichs. Sie schützen die Pflanze unter anderem vor Austrocknung und bis zu einem gewissen Grad vor Schädlingen.
Literatur
Anderson LC (1980) Leaf Variation among Cannabis Species from a Controlled Garden, Botanical Museum Leaflets 28(1), 61–69
Berger M (2017) Psychoaktive Drogen, Nachtschatten Verlag, Solothurn
Clarke RC (1997) Hanf – Botanik, Anbau, Vermehrung und Züchtung, AT Verlag, Aarau
Emboden WA (1974a) Cannabis – A Polytypic Genus, Economic Botany 28, 304–310
Emboden WA (1974b) Species Concepts and Plant Nomenclature, California Attorneys for Criminal Justice Forum Nr. 5 Aug./Sept. 74, 2–4
Emboden WA (1981) The Genus Cannabis and the Correct Use of Taxonomic Categories, Journal of Psychoactive Drugs 13(1), 15–21
Fujita M, Shimomura H, Kuriyama E und Shigehiro M (1967) Studies on Cannabis, II. Examination of the Narcotic and its Related Components im Hemps, Crude Drugs and Plant Organs by Gas-Liquid Chromatography and Thinlayer Chromatography, Tokyo College of Pharmacy, Tokyo 17, 99
Herer J, Bröckers M und Katalyse Institut Köln (1993) Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, Zweitausendeins, Frankfurt/M
MoD M (2013) Enzyklopädie der Cannabiszucht, Nachtschatten Verlag, Solothurn
Rätsch C (2018) Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen, 14. überarbeitete und aktualisierte Auflage, AT Verlag, Aarau
Schultes RE, Klein WM, Plowman T und Lockwood TE (1974) Cannabis: An Example of Taxonomic Neglect, Botanical Museum Leaflets, Cambridge 23(9), 337–364
Schultes RE, Hofmann A (1998) Pflanzen der Götter, AT Verlag, Aarau
Small E, Cronquist A (1976) A Practical and Natural Taxonomy for Cannabis, Taxon 25(4), 405–435
Small E (1978) A Numerical and Nomenclatural Analysis of Morpheogeographic Taxa of Humulus, Systematic Botany 3(1), 37–76
Stearn WT (1974) Typification of Cannabis sativa L., Botanical Museum Leaflets 23(9), 325–336
Zhukovskii M P (1964) Cultivated Plants and Their Wild Relatives, Publishing house Kolos, Sankt Petersburg
3 Das Endocannabinoid-System
Beat Lutz
3.1 Einführung
Die Entdeckung des Endocannabinoid-Systems wurde durch die Entdeckung der psychoaktiven Komponente von Haschisch ermöglicht und erklärt auch die Namensgebung. Es handelt sich um ein körpereigenes (d.h. endogenes) Signalsystem, welches sich aus der Pflanze Cannabis sativa einen körperfremden (exogenen) Stoff, die sogenannten Cannabinoide, als Wegbereiter für seine Entdeckung bediente. 1964 konnten die Forscher Raphael Mechoulam und Yechiel Gaoni nachweisen, dass spezifisch die chemische Substanz δ 9-Tetrahydrocannabinol (in der Kurzform hier als THC bezeichnet) die typischen pharmakologischen Effekte von Haschisch vermitteln (Mechoulam et al. 2014). Es ist bemerkenswert, dass in der Vielfalt von Duzenden von strukturell ähnlichen Substanzen aus der großen Familie der Cannabinoide schließlich nur THC die bekannten Effekte von Haschisch, z.B. das „High“, vermitteln. Die anderen Cannabinoide können jedoch auch pharmakologische Effekte erzeugen, die zurzeit intensiv beforscht werden, um diese Erkenntnisse in therapeutische Anwendungen umsetzen zu können, die aber hier nicht im Fokus dieses Kapitels stehen. Die Entdeckung von THC stellte das Eingangstor für Studien dar, um verstehen zu können, wie THC auf den menschlichen Körper wirkt. Die eindeutige Charakterisierung von THC als Vermittler der typischen Wirkungen von THC-haltigem Cannabis initiierte zahlreiche pharmakologische Experimente in Tier und Mensch, ermöglichte aber auch die chemische Synthese von hochaktiven THC-Abkömmlingen, welche dann in biochemischen Studien dazu verwendet wurden, mögliche körpereigene (d.h. endogene) Bindungsproteine von THC (d.h. Rezeptoren) zu finden und zu isolieren. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass Cannabinoide praktisch nicht wasserlöslich sind, was biochemische Experimente sehr erschwert.
Im ersten Schritt wurden 1990 und 1993 körpereigene „THC-Rezeptoren“ gefunden, die Cannabinoidrezeptoren Typ 1 und Typ 2 (CB1 und CB2) genannt wurden, was dann 1992 und 1993 die Charakterisierung des ersten körpereigenen Cannabinoids, den einem sogenannten Endocannabinoiden, ermöglichte. Die Entdeckung von Cannabinoidrezeptoren und Endocannabinoiden erwirkte einerseits Erkenntnisse über ein neuartiges köpereigenes Signalsystem, andererseits half diese Entdeckung aber auch, die durchaus komplexen und dosisabhängigen pharmakologischen Wirkungen von THC besser verstehen zu können.
3.2 Ein neuartiges Kommunikationssystem
Die Kommunikation zwischen verschiedenen Zelltypen und Organsystemen innerhalb eines komplexen Organismus, wie wir es beim Menschen vorfinden, ist essenziell für das Überleben und stellt die Grundlage dafür dar, dass der Organismus auf externe und interne Reize und „Stresssituationen“ reagieren und adaptieren kann. Solche Kommunikationsprozesse können z.B. über Botenstoffe endokrin, d.h. über den Blutstrom, vermittelt werden; diese Botenstoffe werden Hormone genannt, z.B. Cortisol, Adrenalin, Insulin. Kommunikationsprozesse können aber auch lokal stattfinden, von einer Zelle zur benachbarten Zelle, wie wir es bei den Neurotransmittern an den Endigungen von Nervenfasern (den sogenannten Synapsen) vorfinden. Kommunikation kann auch innerhalb einer Zelle von einem subzellulären Kompartiment zu einem anderen Kompartiment stattfinden. Im Endocannabinoid-System übernehmen die Endocannabinoide die Aufgabe der Botenstoffe und können die Signale, also die Information, an die Cannabinoidrezeptoren weitergeben. Diese Cannabinoidrezeptoren „übersetzen“ diese Information in biochemische und/oder neurophysiologische Prozesse innerhalb der Zelle, was dann eine „Reaktion“ dieser Empfänger-Zelle bewirkt, und seinerseits ein neues Signal entstehen lassen kann, welches dann wieder weitergeleitet wird. Solche Übermittlungsprozesse von Informationen stellen die Grundlage dafür dar, dass ein Organismus, wie der Mensch, in koordinierter Weise als „Ganzes“ funktionieren und reagieren kann.
3.3 Ein räumlich definiertes und dynamisches Signalsystem
Aus biochemischer Sicht war die Entdeckung der zwei hauptsächlichen Endocannabinoide eine Überraschung (s. Abb. 15). Sie zeigen keine strukturelle Ähnlichkeit zu THC, sind aber wie THC sehr schlecht wasserlöslich, bzw. sehr gut fettlöslich. Während THC ein sogenanntes Isoprenoid ist, eine Substanzklasse, die in der Natur, v.a. in der Pflanzenwelt, sehr verbreitet vorkommt, z.B. in Duftstoffen oder als pharmakologisch aktive Stoffe (z.B. zur Abwehr), sind die Endocannabinoide strukturelle Abkömmlinge von sogenannten Fettsäuren, welche in der Form von Phospholipiden, ein Hauptbestandteil der Zellmembran, darstellen und in dieser Form dort gespeichert sind. Die zwei wichtigsten und am besten untersuchten Endocannabinoide sind Anandamid (Arachidonoylethanolamid, AEA) und 2-Arachidonoylglycerol (2-AG), welche aus Arachidonsäure, einer Fettsäure mit 20 C-Atomen und vier Doppelbindungen, enzymatisch hergestellt werden (s. Abb. 15). Daneben gibt es noch weitere Botenstoffe, welche aus Arachidonsäure hergestellt werden und den Endocannabinoiden sehr ähnlich sind, aber nicht die Cannabinoidrezeptoren aktivieren können. Auch diese Botenstoffe haben bemerkenswerte endogene Funktionen, wie zum Beispiel Palmitoylethanolamid (PEA), welches anti-epileptische und anti-inflammatorische Funktionen aufweist. Ein weiterer Botenstoff ist Oleoylethanolamid (OEA), welches ebenfalls anti-inflammatorische Funktionen hat, wie auch das Essverhalten beeinflussen kann. Diese Endocannabinoid-artigen Botenstoffe sollen nicht im Fokus dieses Kapitels sein, sind jedoch therapeutisch möglicherweise ebenfalls bedeutsam sind und werden aktuell intensiv beforscht.

Abb. 15 Chemische Strukturen von Phytocannabinoid THC und der Endocannabinoide THC und Endocannabinoide gehören zwei verschiedenen Klassen von Lipiden an, den Isoprenoiden, bzw. den Abkömmlingen von Fettsäuren. Endocannabinoide enthalten die Fettsäure Arachidonsäure, an welche bei der Carbonsäure eine weitere Struktur verknüpft ist, z.B. Ethanolamin oder Glycerol.
Die hohe Fettlöslichkeit der Endocannabinoide ermöglicht eine recht effiziente Passage durch die Membranen. Deshalb können Endocannabinoide nicht in den kugelförmigen und von einer Membran aufgebauten Vesikeln gespeichert werden, wie das andere Botenstoffe können, wie z.B. der Neurotransmitter Glutamat oder das Hormon Insulin. Hier sind die Endocannabinoide eher anderen Botenstoffen ähnlich, wie den Prostaglandinen oder dem Cortisol. Diese Unfähigkeit, Endocannabinoide in Vesikeln zu speichern, führt uns zu einem wichtigen Prinzip der Funktionsweise des Endocannabinoid-Systems. Das Anschalten des Endocannabinoid-Signals wird über die Stimulation der de novo Biosynthese der Endocannabinoide bewirkt. Enzyme, welche die Synthese von Endocannabinoiden aus Membranbestandteilen bewerkstelligen (s. Abb. 16), werden durch bestimmte Auslöser (Stimuli) auf die jeweiligen Zellen aktiviert. Das Endocannabinoid-Signal ist nicht statisch, sondern ist durch eine hohe Dynamik ausgezeichnet, weil die Endocannabinoid-Synthese nicht nur Stimulus-abhängig ausgelöst wird, sondern weil die gebildeten Endocannabinoide auch sehr schnell durch spezifische Enzyme abgebaut werden (s. Abb. 16). Wir können verallgemeinert festhalten, dass das Endocannabinoid-Signal räumlich definiert entsteht und mit einer zeitlichen Dynamik agiert (Lutz et al. 2015; Busquets-Garcia et al. 2018). Diese zwei Aspekte können experimentell auch untersucht werden, indem die Konzentrationen der zwei Endocannabinoide mittels einer sehr empfindlichen Analysemethoden, der sogenannten Massenspektrometrie, bestimmt werden. Im Tiermodell, z.B. Maus oder Ratte, konnten räumliche Begrenzung und zeitliche Dynamik des Endocannabinoid-Signals nach Stress, bei akuten epileptischen Anfällen oder bei Lernprozessen gezeigt werden. Beim Menschen werden Endocannabinoide vor allem im Blut oder Speichel bestimmt. Dabei wurde beobachtet, dass die Konzentrationen z.B. einem Tag/Nacht-Zyklus oder dem Hunger/Sättigung-Zustand folgen. Weiter konnte beobachtet werden, dass die Endocannabinoid-Konzentrationen bei pathologischen Zuständen, wie Depression, Inflammation, etc. im Vergleich zu Kontrollen verändert sein können. Bemerkenswert ist, dass die Endocannabinoide im Körper sehr verbreitet sind, sowohl im zentralen Nervensystem (ZNS) als auch in vielen peripheren Organen, inkl. Blut. Es ist wahrscheinlich nicht übertrieben zu behaupten, dass Endocannabinoide praktisch in allen Zellen und Organen des Menschen vorkommen. Dies wirft natürlich die Frage auf, wie ein solch ubiquitäres System spezifische Wirkungen erzeugen kann.
Abschließend soll nicht unerwähnt gelassen werden, dass das Endocannabinoid-System in andere Signalsysteme integriert ist. Wie oben beschrieben werden Endocannabinoide aus Arachidonsäure synthetisiert bzw. zu Arachidonsäure abgebaut. Arachidonsäure bildet aber auch den Vorläufer für die Biosynthese von einer weiteren wichtigen Klasse von lipidartigen Botenstoffen, den Eicosanoiden, wie Prostaglandine, Thromboxane und Prostacycline (s. Abb. 16). Somit sind gewissermaßen die Signalsysteme der Eicosanoide und Endocannabioide über Arachidonsäure miteinander verknüpft, sodass z.B. pharmakologische Manipulationen, genetische Dysregulationen oder pathologische Veränderungen der Synthese oder Degradation von Endocannabinoiden auch die Verfügbarkeit von Arachidonsäure und somit die Synthese der Eicosanoide beeinflussen können.

Abb. 16 Biosynthese und Abbau der Endocannabinoide und Endocannabinoid-artigen Lipiden Diese Lipidbotenstoffe werden nach Stimulation der Enzymaktivität durch z.B. Calciumionen aus Membranlipiden hergestellt. Die Synthese- und Abbauwege sind redundant und sind hier vereinfacht dargestellt. Neben den zwei hauptsächlichen Endocannabinoiden werden auch weitere Lipidbotenstoffe synthetisiert, wie Palmitoylenthanolamid (PEA) und Oleoylethanolamid (OEA), welche aber nicht an die Cannabinoidrezeptoren CB1 und CB2 binden. Anandamid besitzt die Besonderheit, auch andere Rezeptoren zu aktivieren, wie TRPV1, PPARY und GPR55. Das Abbauprodukt dieser Lipidbotenstoffe produziert Arachidonsäure, welches auch der Ausgangsstoff der Eicosanoide Prostaglandine, Prostacycline und Thromoxane darstellt. Dadurch ist das Endocannabinoid-System mit dem Eicosanoid-System verknüpft.
3.4 Unterschiede der Signale von Endocannabinoiden versus THC
Die räumliche Restriktion und die zeitliche Dynamik des Endocannabinoid-Signals sind im großen Gegensatz zu THC, das auch als Aktivator der körpereigenen Cannabinoidrezeptoren wirken kann. Exogenes THC „überschwemmt“ den gesamten Körper und das räumliche Aktivierungsmuster des Endocannabinoid-Signals wird nicht nachgeahmt bzw. THC kann die Aktivität des endogenen Systems sogar beeinflussen oder beeinträchtigen, da THC an die gleichen Rezeptoren bindet wie die Endocannabinoide. Zusätzlich ist THC chemisch in unserem Körper langlebig und wird nur langsam in der Leber abgebaut. Deshalb fehlt dem THC die für Endocannabinoide typische zeitliche Dynamik der Wirkung.
Warum sollen wir uns solchen biochemischen Aspekten widmen? Das Erkennen dieser biochemischen Unterschiede zwischen Endocannabinoiden und THC ist wichtig, um zu verstehen und möglicherweise erklären zu können, warum die zahlreichen pharmakologischen Effekte von THC nicht notwendigerweise mit den Effekten und Funktionen der Endocannabinoide übereinstimmen müssen. Dieser Aspekt wird unten noch ausführlicher besprochen.

Besonderheit des Endocannabinoid-Systems
Die Aktivität des Endocannabinoid-Signals ist durch räumliche Restriktion und zeitliche Dynamik charakterisiert. Diese Spezifität über das „wo“ und „wann“ ist bei direkter Stimulation des Systems durch exogene Botenstoffe wie THC nicht mehr gegeben.
3.5 Die Vielfältigkeit des Endocannabinoid-Systems
Wie oben erwähnt, können die Endocannabinoide an die beiden Cannabinoidrezeptoren CB1 und CB2 binden und diese aktivieren. Zusammen mit der räumlichen Restriktion und der zeitlichen Dynamik ergibt die Lokalisation der Cannabinoidrezeptoren die Spezifität des sehr weit verbreiteten Endocannabinoid-Signals. Die Bestimmung der Lokalisation dieser Rezeptoren im Körper gibt sehr gute Hinweise auf die möglichen Funktionen. Ursprünglich wurde der CB1-Rezeptor als der Gehirn-spezifische Cannabinoidrezeptor bezeichnet, während der CB2-Rezeptor mehrheitlich in Immunzellen sei. Diese Sichtweise ist nicht mehr haltbar, denn es finden sich CB1-Rezeptoren in nicht-neuronalen Zellen, während der CB2-Rezeptor auch in Neuronen des Gehirns exprimiert ist.
Der CB1-Rezeptor ist sehr abundant in den Neuronen und stellt einen der höchst exprimierten Rezeptoren im Gehirn dar. Besonders viele CB1-Rezeptoren sind in den inhibitorischen, GABAergen Neuronen zu finden, während die exzitatorischen, glutamatergen Neuronen eine 10–20-fach geringere Menge exprimieren (Monory et al. 2006; Lutz et al. 2015). Wie kürzlich publizierte Forschungsergebnisse zeigten, ist der CB1-Rezeptor aber auch in sogenannten Gliazellen (Unterstützungszellen des Nervensystems) exprimiert wird (Metna-Laurent u. Marsicano 2015), so in den Astrozyten, die z.B. für die Energieversorgung der Neuronen wichtig sind und eine Verbindung zur Blutversorgung herstellen, und in Oligodendrozyten, welche die Axone mit einer isolierenden Membranschicht umwickeln. Die Expressionshöhen in diesen zwei Zelltypen ist im Vergleich zu den Neuronen sehr niedrig und kaum detektierbar. Das gleiche trifft auf den CB2-Rezeptor zu, der in Neuronen in sehr niedriger Höhe exprimiert ist.
Der CB1-Rezeptor ist praktisch in allen Gehirnregionen präsent, so zum Beispiel in Regionen, die wichtig sind für Gedächtnisbildung (Hippocampus, assoziative Großhirnrinde), Emotionsregulation (Amygdala, Präfrontalkortex), Motorik (Striatum, Substantia Nigra, Cerebellum), Belohnungsverhalten (Nucleus Accumbens, Ventrales Tegmentales Areal) und Stress-, Hunger- und Energiebilanzregulation (Hypothalamus, peripheres Nervensystem). Der CB1-Rezeptor ist in einer sehr großen Vielzahl von physiologischen Prozessen involviert. Die Expressionsorte des CB1-Rezeptors können auch sehr gut die verschiedenen zentralnervösen Effekte von THC erklären. Für die THC-vermittelten Effekte spielt die Expression vom CB2-Rezeptor im Gehirn aber scheinbar eine untergeordnete Rolle. Andererseits ist die CB1-Expression in peripheren Organen (Ruiz de Azua u. Lutz 2019) sehr viel geringer als im Gehirn und wird u.a. in Fettzellen (Adipozyten), Niere, Leber, Gastrointestinaltrakt, Knochen, Lunge, Herz, Pankreas, Nebenniere, Hoden, Auge, Mund, Gefäßendothel, Prostata, Haut und Uterus gefunden.
Im Kontext dieses Buches ist die CB1-Rezeptorexpression während der Entwicklung des Gehirns von besonderem Interesse. Hier ist der CB1-Rezeptor speziell relevant während der Entwicklung der Schichtung der Großhirnrinde und während der Etablierung der synaptischen Verbindungen zwischen den Neuronen (Maccarrone et al. 2014). Diese Expression kann die verheerenden und irreversiblen Effekte von prä- und postnataler THC-Exposition erklären, in der Zeit, wo das Gehirn sich noch in der Entwicklung befindet, was bis etwa ins zwanzigste Lebensjahr reichen kann. Nach dieser Lebensstufe scheint THC sehr viel geringere irreversible, eventuell sogar vernachlässigbare Effekte auf die Struktur des Gehirns zu haben.
Der CB2-Rezeptor ist in Immunzellen besonders präsent, so in Makrophagen, T- und B-Lymphozyten, natürlichen Killerzellen, Monozyten und neutrophile Granulozyten. Auch ist der CB1-Rezeptoren in Mikrogila gefunden worden, Zellen, welche als Immunzellen im Gehirn agieren, und dort akute Entzündungs- und Degenerationsprozesse modulieren können. Der CB2-Rezeptor ist auch in Knochen, Milz, Pankreas, Haut, Lunge, Gastrointestinaltrakt, enterischem Nervensystem, Reproduktionstrakt präsent, und – wie oben schon erwähnt – in Neuronen des Gehirns. Generell ist die CB2-Expression in Immunzellen sehr viel höher als in den anderen Zelltypen. Ebenso scheinen die typischen „psychotropen“ Effekte von THC nicht über CB2-Rezeptoren vermittelt zu sein.