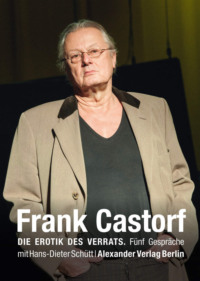Kitabı oku: «Die Erotik des Verrats», sayfa 2
Das erste Gespräch
Ein Sozialismus wie New York
Vielleicht habe ich nur noch fünf Minuten zu leben,
aber das sind fünf Minuten nach meinen Bedingungen.
GEORGE JACKSON
HANS-DIETER SCHÜTT: Frank Castorf, können Sie gut mit dem Hammer umgehen?
FRANK CASTORF: Es geht. Ich komme ja aus einer langen Tradition von Eisenwarenhändlern. Der Großvater meines Vaters hat die Firma gegründet. Drahtseile. Kochtöpfe. Hundert Jahre Prenzlauer Berg.
Also fast ein geborener Zertrümmerer, wenn man an Ihren Umgang mit Dramatikern denkt.
Oft funktioniert Theater nach einem Rezept: Man lasse auf der Bühne jene Charaktere agieren, aus denen sich das Publikum zusammensetzt, und der Beifall ist garantiert. Vordergründig wird die Gesellschaft angegriffen, aber in Wirklichkeit feiert sich die Gesellschaft im Theatersaal selbst. Das finde ich uninteressant. Als ich zum Beispiel 1989 in München Lessings Miss Sara Simpson inszenierte …
Und Sie dort für einen der handfestesten Skandale sorgten …
Ja, die Inszenierung stand kurz vor dem Verbot, leider kam es nicht dazu. Mich interessierte an Lessing nicht nur das erste bürgerliche Trauerspiel, dieser Kampf um eine neue, eben die bürgerliche Würde – mich interessierte ebenso die drunterliegende Triebstruktur. Also das, was dafür sorgt, dass die Ideale und die Poesie, die Utopie und das sich Aufschwingende sofort wieder auf die Erde runtergeholt werden.
Ein Mann macht einer Frau begreiflich, dass er von der Welt alles will, von einem Menschen dieser Welt aber nichts: Er onaniert in Papier.
Meinen Samen für die Welt, ja! Es war der Versuch, ein Gefühl auszustülpen, eine bestimmte Konfliktsituation aus ihrer literarischen Gebundenheit herauszulösen.
Sie stehen im Krieg mit der Literatur. Sie haben kein Vertrauen in Poesie. Die Chöre des Herzens qualmen wie Lunte, sagt Majakowski.
Der angeblich subversiven Kraft von Poesie misstraue ich gründlich. Zu vieles in der Literatur gaukelt ein Modell der Erkennbarkeit und der Beherrschbarkeit von Welt vor. Es liegt für mich inzwischen etwas Lächerliches im Erklären der Dinge. Übersichtlichkeit ist niederschmetternd. Weil es Lüge ist. Deshalb bin ich misstrauisch gegenüber tradierten narrativen Strukturen, gegenüber den Klarheiten in einer Geschichte. Deshalb nehme ich sehr rasch Schraubenzieher und Trennsäge. Aber wir bleiben ja beim Zertrümmern nicht stehen. Da wird doch immer auch wieder etwas zusammengesetzt, etwas aufgebaut, in Beziehung und in neue Konstruktion gebracht. Es entsteht dann plötzlich ein völlig anderer, negierender, irritierender Zustand. Und die Leute fragen sich vielleicht: Warum machen die denn das jetzt? Man ist im Publikum erschrocken, will so was nicht sehen. Einige sagen sogar: Die dürfen das nicht! Also: Mich interessieren die überraschenden Richtungen, die eine Sache einschlagen kann, ich bewege mich gern von Erwartungen weg.
Aber wohin, fragt sich mancher, der in Ihren Inszenierungen das Blut sieht, alles Zerfetzte, alles Zerschlagene, allen seziererischen Slapstick. Und Leute, die verstört werden sollen, die erreichen Sie wahrscheinlich kaum.
Mag sein, mag nicht sein. Vor Verblödung ist keiner gefeit; aber vor der Verführung, vielleicht doch mal anders über bestimmte Dinge nachzudenken, ist zum Glück auch keiner gefeit.
Sie sind froh, dass die Volksbühne nicht sehr stark frequentiert ist von Herr- und Damenschaft in gutem Tuch?
Wer Obdachlose vor der Tür campieren und diese Menschen sich im Theater aufwärmen lässt wie wir, wer also auf Glanz provokativ verzichtet, hat anderes Publikum. Darüber bin ich froh, ja.
Wenn sich Menschen mit übergroßen Anstrengungen, die ihren individuellen Energiehaushalt eigentlich überfordern, durchs Arbeitsleben bewegen – dann ist ihr Unwille erklärlich, die wirtschaftlichen, sozialen Ergebnisse ihrer Leistungen weiter mit jenen teilen zu sollen, die außerhalb der Grundhärte-Gemeinschaft stehen. Im Energiestress der Übermüdeten verflüchtigt sich die Barmherzigkeit zuerst. Die Unkosten des solidarisch aktiven Mitleids stehen auf den Sparplänen der Gefühlsökonomie ganz oben.
Nicht von Bosheit wird die neue soziale Kälte diktiert, sondern von jener Feigheit, die nach Shakespeare nur im Menschen, als einzigem Wesen, zu hohen Jahren kommt. Es ist die Feigheit vor einem Ich, das eigentlich ganz anders sein möchte. Dieses Ich, diese ureigene Intelligenz und Sensibilität würde doch manchen gern mahnen: Mensch, was machst du da nur aus dir? Aber solchen Fragen muss doch, wer bestehen will, mehr und mehr ausweichen, wie einer inneren Gefahrenquelle. Sonst wird nämlich nichts aus dir, du Strampelnder.
Für Aristoteles, der die Ethik als eigenständige philosophische Disziplin neben Logik und Physik etablierte, war die Frage nach Mitte und Maß das Kriterium für vernünftiges Handeln. Er erfand die »goldene Mitte«. Vielleicht die früheste, haltbarste Utopie, vor der noch jede Gesellschaftsordnung versagte.
Individualisierung wird fortwährend als Ausweitung des wahrhaft Menschlichen gefeiert – aber dabei experimentieren die Manager der Ausleerung längst über der Frage, mit wie wenig Menschen diese Welt auskommen könnte. Nun muss ich hinzufügen: Ja, wir arbeiten mit sozialen Randgruppen, aber ich möchte das auch nicht zu hoch hängen. Mein linkes Herz kann ja noch so heftig das Wort Solidarität im Takt schlagen – auch ich bleibe trotzdem der gut ausgehaltene Spaßmacher, der Wohlgenährte, das Helmut-Kohl-Abbild, das die Qualen dieser Welt mit aussitzt. Trotzdem hoffe ich, dass uns in der Volksbühne noch lange dieses Steglitzer Lachen erspart bleibt, das im Deutschen Theater längst zu Hause und auch schon ins Berliner Ensemble eingezogen ist. Sollen die Leute doch merken: Das sind merkwürdige Typen an der Volksbühne. Und wenn die Zuschauer nur erst mal Bier trinken kommen und Rockmusik hören und freundliche Leute an der Kasse erleben – das ist doch schon eine sehr günstige Einflugschneise für Theater.
Nun kann der Senat sagen: Der Kerl protzt mit seinem »Panzerkreuzer« Volksbühne mitten in Berlin, macht linksverdächtigen Rabatz, hat die große Klappe. Wie lange, Herr Castorf, geht das gut?
Ja, ich seh die schiefen Blicke: Der kriegt Geld von uns und macht das Haus, wie es in einer Kritik hieß, zur Wärmestube für verhärmte PDSler. Allein, dass wir betonen: Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, das ist noch immer wie ein Stich. Wer von den Damen und Herren aus dem Westen möchte schon abends zum Rosa-Luxemburg-Platz. Horst-Wessel-Platz klänge da ganz anders. In Marzahn, wo die nie hinkommen, wäre es ihnen wahrscheinlich egal, wenn da eine Straße selbst noch nach Mielke benannt bliebe. Aber hier im Zentrum? Diese Haltung empfinde ich als unverschämte Anmaßung. Aber mit mir ist kein stubenrein westdeutscher Stolz zu reproduzieren.
Sie leiten ein subventioniertes Theater. Hat man da nicht Rücksicht zu nehmen? Sie verbraten Steuergelder.
Diese Art geforderter Rücksicht verstehe ich nicht. Da steckt ein Individualverhalten dahinter, das mich ratlos macht: Wenn die Gesellschaft sich Theater hält, gewissermaßen als geistige Hygienestationen, dann muss man mutiger umgehen mit dieser mittelalterlichen Institution, mit diesem Luxusort. In diesem hochsubventionierten deutschen Nationaltheaterbetrieb, das ist unser Privileg, können wir uns in aller Ruhe den Abnormitäten widmen. Unsere Aufgabe ist es, übergenau hinzusehen, die Krankheitsherde dieses nationalen Körpers Deutschland so bösartig wie möglich zum Gegenstand der Theaterarbeit zu machen und Gefühle der Verunsicherung auszulösen. Je mehr Reichtum in Theatern vorhanden ist, desto mehr sinkt deren Interesse für Politik, für die Straße. Die Tugend des westdeutschen Theaters in den sechziger und siebziger Jahren ist durch Geld und sogenannte Werktreue kaputtgegangen. Das schuf eine Fettzone aus Wohlstand und Überbewertung. Da verwurschtelte man sich in Poesie. Es ist im Theaterbetrieb ein mafiotischer Umgang miteinander entstanden, der sich mancherorts vom Lobbyismus der Zahnärzte und Politiker wenig unterscheidet. Dieses Bewusstsein war zum Beispiel bei der Schließung des Berliner Schillertheaters ganz klar zu erkennen: Natürlich war dieses Theater schlecht, das wusste jeder Eingeweihte, aber die Übereinkunft war: Muss man so was gleich in aller Öffentlichkeit sagen? Das erinnerte mich an das Ende der DDR, wo man ja auch Wirklichkeit um keinen Preis wahrhaben wollte. Das deutsche Bildungsbürgertheater ist so ein sich selbst reflektierender, stinkender Sumpf, der keinen offenen Zufluss mehr hat. Theater ist ein handgemachter, bornierter, überlebter feudalistischer Betrieb, der sozusagen nicht mehr an der Börse gehandelt, sondern nur noch mühsam und ehrpusselig am Leben gehalten wird. Weil man etablierte Greise ebenso wenig totschlägt wie kleine Kinder.
Seit Ihrer Geburt, einige künstlerische Stationen mal weggelassen, leben Sie in Berlin. Gern?
Ja, gerade jetzt. Berlin trägt sehr selbstbewusst und ehrlich den deutschen Konflikt aus. Es wird dröhnend, knarrend, quietschend zusammengeschraubt, was so gar nicht zusammenpasst. Die Stadt ist ja ohnehin nie ein Ordnungsort gewesen, aber sie liefert momentan den wichtigen Beweis, dass sich nicht jeder soziale Raum in Deutschland willenlos von einer rheinischen Provinz aus organisieren lässt. Das ist das Spannende. Hier wuchs Kraft immer aus Chaos.
Und Chaos ermuntert Sie.
Wobei ich das vorwiegend in Ostberlin sehe, weniger im reichen Ghetto Westberlin. Meine Wurzeln im Prenzlauer Berg helfen mir: Ähnlich wie die Dadaisten in den zwanziger Jahren versuche ich, auf dem zynischen Höhepunkt der Zeit zu bleiben. Die Kampfverhältnisse der Zeit muss ich kennen, und ich will sie zeigen, zynischer als zynisch. Mit so einem Wissen kann ich dann rechtzeitig in Deckung gehen. Berlin hat was von Rio, unerbittlich, krass, mit Schmutzflecken. Wenn ich dagegen in Hamburg inszeniere, komme ich mir vor wie ein literarischer Tourist. Ich inszeniere da sozusagen bei Neckermann oder TUI. Wenn ich in Rio oder Moskau bin, wird mir klar, dass unsere poetischen Inseln hier den gleichen Wert haben wie Rilke-Gedichte im Tornister des Soldaten, der 1942 vor Stalingrad lag. Literatur ist eine schöne anachronistische Floskel – in einer Welt, in der jeder anders strukturiert ist, jeder gegen jeden steht, aber doch alle auf Gedeih und Verderb zusammengehören.
Was ist für Sie die deutsche Vereinigung?
Eine Form sublimer Kolonialisierung, gegen die ich mich wehren werde – den Teufel treibt man am besten mit dem Beelzebub aus. Ich mache Theater für Leute, die vielleicht aus einer ähnlichen Richtung kommen wie wir an der Volksbühne, für Leute mit der Mentalität eines zynisch veranlagten Steuerhinterziehers vom Prenzlauer Berg. Erst mal für die machen wir das. Hoffend, dass ein Stein, den man ins Wasser geworfen hat, Kreise zieht. Ich möchte einfach ein Fenster aufmachen, durch das ein klarer, kalter Wind weht, der das Miefige hier in Berlin ein bisschen durcheinanderwirbelt.
Welche Erinnerung haben Sie an Ihre Kindheit? Fast immer nur Prenzlauer Berg.
Das war so wie im DEFA-Film Berlin – Ecke Schönhauser. Wenn die Kamera durch die Straßen führte, war das eine Mischung aus Neorealismus und Terrarium. Langweiligkeit, aber auch angenehme Gleichheit. Ich war, als die Mauer gebaut wurde, zehn Jahre alt und ein infantiler Antikommunist: Der Staat verwehrte mir Kaugummis und Zündblättchencolts. In Westberlin kriegte ich beides und noch dazu Filme mit Freddy Quinn.
Waren Sie als Schüler Opponent?
In Maßen. Das hängt mit den Polen meines sozialen Lebensraumes zusammen. Auf der einen Seite war da, in einer Familie von Kleinstunternehmern und Händlern, die natürliche Opposition gegen den Kollektivstaat, andererseits weiß der Kleinbürger überallhin höflich zu grüßen, um seine Existenz nicht zu gefährden. Ich bin nie in dramatische Situationen geraten, obwohl ich als Schüler mitunter unangenehm auffiel, zum Beispiel bei Unterschriftensammlungen für die Anerkennung Israels. Aber ich konnte mein Abitur machen, war bei den Grenzern, ich akzeptierte also äußere Normen dieser Gesellschaft, opponierte nur innerhalb der Strukturen.
Erzählen Sie von Ihrer Familie. Welche Dinge kommen Ihnen spontan in den Sinn?
Der Vater mit abgebrochenem Abitur, Soldat, schwer verwundet, Deserteur – von der Großmutter wird er im Uhrenkasten versteckt wie im Märchen das Geißlein vorm Wolf, erst vor den Kettenhunden der Wehrmacht, dann vor den Russen. Er kommt nicht in Gefangenschaft, macht Geschäfte mit den Amerikanern, mit Fotoapparaten und Eisenwaren, hat später eine Buchhandlung, kehrt schließlich ins Leben der Firma zurück, die mein Großvater 1889 gegründet hatte. Er sprach gut englisch, war gut gekleidet, ein Mann mit Big-Band-Feeling. Der Großvater mütterlicherseits kam aus polnischböhmischen Gegenden, allerdings schon seit Generationen in Berlin. Großvater machte eine Lehre in den USA, war Schneidergeselle, kam wieder nach Deutschland, wurde Konfektionsmeister in einer jüdischen Firma, die sind dann emigriert. Die Großeltern mütterlicherseits waren im Gegensatz zu denen väterlicherseits immer projüdisch. Nach dem Krieg ging es beiden »Fraktionen« gut, sie waren gewieft im Überleben. Großvater wohnte nach dem Krieg in Wrocław; als er starb, schrieb Großmutter an Wilhelm Pieck. Sie hatte es schwer als Deutsche da drüben, wir bekamen sie raus aus Polen. Meine Mutter ist Modezeichnerin gewesen, das war ein Ansatz weg aus der kleinbürgerlichen Ordnung, die ja immer etwas Stumpf-Wehrhaftes hat. Alle Familienutopie wurde auf mich delegiert: Du musst Abitur machen, du musst studieren. Immer spürte ich irgendwie diesen Druck, aber an eine staatliche Benachteiligung, weil ich Händler- und Privatiersohn war, kann ich mich nicht erinnern. Mein Vater war nie SED, mein Großvater nie NSDAP.
In der Familie ging es immer solidarisch zu. Das half mir sehr: Weil ich ökonomisch unabhängig war, politisch keine Angst hatte, konnte ich relativ frei meinen ästhetischen Quark denken und praktizieren.
Sie haben vorhin gesagt, Sie machen Theater weg von Erwartungen. Theater ohne Sehnsucht?
Ich habe Sehnsucht nach menschlicher Welt. Aber diese Sehnsucht ist das eine, Realität das andere. Wie in der Realität Scheinwerte gehandelt und von vielen Leuten als Heilslehren angenommen werden, das macht mich wütend. Das eigentliche Leben wird aus der Gegenwart verdrängt: Später, wenn ich groß bin. Später, wenn ich alt bin. Später, wenn ich den Posten habe. Früher, als ich klein war. Früher, als es noch kein Fernsehen gab. Früher, als die DDR noch existierte. Eine Hoffnung ist solches Verhalten freilich, für Herrschende: Es macht duldsam und den Blick ziemlich unscharf. Beides wird gebraucht, wenn man als guter Bürger bestehen will.
Und die Wut darauf setzt zerstörerische Kräfte frei?
Wenn ich mir im Fernsehen das Publikum einer Gameshow betrachte, die Verzücktheit, wenn der Preis ganz heiß wird – diese Leute sind doch nur noch ihr eigenes Surrogat. An solch massenhaftem Verhalten, an solcher Lebensart kann man zerbrechen, wenn man im Zusammenhang mit diesen Leuten an Zukunft denkt. Aber man kann sich auch ins Lachen retten.
Theater als Therapie, um mit dem Unvereinbaren leben zu können?
Vielleicht. Ich möchte etwas von der Scharlatanerie mitteilen, in der wir leben. Nicht meine Kunst ist eklektizistisch, sondern das Leben. Bosnien und Boris Becker gehören zusammen, die Spuren zwischen beidem verwischen sich in uns. Diese Spurenverwischung interessiert mich. So viele Dinge geschehen derart irrational nebeneinander – dafür möchte ich einfach eine ästhetische Form finden. Es gibt eine Tagebucheintragung von Kafka: vormittags Ausbruch des Ersten Weltkrieges, nachmittags Schwimmschule.
Das ist das Prinzip Pension Schöller: Die Schlacht (1994) – ein deutscher Schwank mit Heiner Müller gekoppelt.
Das wollte ich schon vor Jahren in Anklam machen. Für mich war das Ufa-Lachen bei den Montagabendfilmen im DDR-Fernsehen immer ein ungezügelt natürliches, von Wirklichkeit ungetrübt. Aber zugleich fand, als diese Filme entstanden, anderes statt: alltäglicher Faschismus, Rassengesetze, die Abtransporte, die Bomben. Mich bewegt, was hinter deutscher Fröhlichkeit liegt. Ich siedle diese Montage im Jahr 1939 an. Während einer sagt: »Mir ist eine Fniege in den Hans gefnogen«, geht der Krieg in die Startlöcher. Das ist lustig. Weil es die bittere Wahrheit ist.
Machen Sie Theater aus Leidenschaft?
Ich habe nie derart gerne Theater gemacht, dass mich Leidenschaft hätte verführen können. Im Gegensatz zu Einar Schleef, der sich radikal in Kunst verlieren kann, geradezu rauschhaft. Mir war Kunst immer suspekt. Ich bin zum Theater gekommen, weil das in der DDR eine Möglichkeit war, sich einer bestimmten offiziellen Erwartungshaltung zu entziehen und das zu machen, was sich unterschieden hat vom abstrusen Selbstbestätigungsbedürfnis dieser sozialistischen Gesellschaft. Es war also ein querulatorischer, weniger ein künstlerischer Ansatz. Mir würde es keinen Spaß machen, den Faust zu inszenieren und damit auszudrücken: Ist das nicht toll, wie ich das kann?
Westdeutsche Theater luden Sie ein, wenn mal wieder ein Skandal den Spielplan schmücken sollte. Man leistet sich den Provokateur auf Bestellung. Ist Ihnen dieses Image leid?
Ja. Aber diese Gesellschaft hat nun mal die fatale Fähigkeit, alles zu assimilieren, auch diejenigen, die sich mit Widerstandsästhetik der Verkaufbarkeit entgegenstellen wollen.
Ihr Theater ist eine große bunte Bude, die an Brechts Traum vom rauchenden, biertrinkenden Zuschauer erinnert. Die Volksbühne als Boxring?
Warum nicht? Vielleicht ist das der wichtigste Optimismus, den man verbreiten kann: Der Mensch steht im Boxring, kriegt Hiebe, wird ausgezählt, steht wieder auf, beginnt von vorn.
Wie war das Anfangsgefühl, nachdem Sie das Haus übernommen hatten?
Die Zuschauer kamen zu uns wie ins Kino. Sie hätten Popcorn gefressen, wenn es das gegeben hätte, sie rannten während der Vorstellung aufs Klo, sie verhielten sich total so, als ob sie im Zoo-Palast säßen. Das freute uns – und es war zugleich ärgerlich. Aber für uns war wichtig, dass wir in der Konkurrenz standen, nämlich: ob sich die Zuschauer den Dracula von Herrn Coppola angucken oder zu uns ins Theater kommen.
Haben Sie einen gewissen Hang zu Stücken, die unangenehm ideologiegesättigt sind?
Ja, die voller Klischees stecken, bis zum Rand. Man kann sich sehr gut befreien von diesen Stücken, und zwar mit fremden Gedanken, Themen, Thesen, die man hinein- und dagegenmontiert. Ich wollte auf der Bühne immer die Eindeutigkeiten aufkündigen, den Bedeutungen den Boden entziehen. Schillers Räuber waren da programmatisch. Aber da wussten wir noch nicht, dass wir das Haus bald übernehmen würden. Wir entwickelten so eine Art Gegensprache, haben das Rotwelsch aufgenommen, die Sprache der Benachteiligten, das geheime Zeichensystem derer, die nicht schreiben und lesen konnten. Daraus entstand das Rad, das jetzt vor dem Haus steht. Eigentlich begann das Neue mit den Räubern [1990], die Volksbühne war führungslos, es gab keine feuerpolizeilichen Hemmnisse mehr – diese kurze Zeit der Anarchie hat allen viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht … vielleicht hätte man die Situation noch intensiver und konsequenter nutzen müssen.
Würden Sie dem zustimmen: Wer es an Regisseuren oder Schauspielern an der Volksbühne ausgehalten hat, der schafft es überall?
Oder er ist für alle andere Welt versaut.
Stahlbad.
Die Volksbühne als Institution ist natürlich auch etwas, das mit Mode zu tun hat. Und jede Mode produziert irgendwann einen Zustand des Bekannten, das dann erneut in eine Mode verwandelt werden muss. Wenn die einen nicht immer wieder ihr Produkt Coca-Cola wettbewerbsfähig halten und wir nicht ausdauernd unseren Ost-Rost wie falsches Gold verscherbeln, dann werden wir in dieser Gesellschaftsstruktur belächelt oder bestenfalls als Sekte wahrgenommen. Und ein Sektenführer war ich nie, wollte ich nie sein, auch im Osten nicht. Mich hat nicht interessiert, mit ein paar auserwählten Jüngern in Anklam oder Prenzlauer Berg im kuschligen Untergrund herumzubröseln. Die freundliche Übereinstimmung sensibler Menschen auf einer Bühne mit sensiblen Menschen im Zuschauerraum hat mich auch nie bewegt. Aber ich hatte gemerkt, wie dieses hochqualifizierte Theaterwesen DDR eigentlich auf die Erlösung wartete, und mit einer ganz einfachen Sache, nämlich Vertrauensbildung, konnte man in stalinistischen Hochburgen, gegen eine politisch teilweise ausgesprochen militante Umwelt, besondere künstlerische Sachen produzieren. Sachen, die die jeweils Einzelnen so einer Produktion tatsächlich glücklich machten. So ist das heute auch. Und es ist keine Altersfrage. Es geht darum, so zu leben, dass das Gefühl, man vergehe nur, keine Chance hat, das Gemüt zu besetzen. Mich interessiert am Stadt- oder Staatstheater der populistische Zug.
Sie behaupten, der Zuschauer sei Ihr Feind. Jeder?
Jeder! Sein Freizeitbedürfnis zielt oft darauf, nach einem Alltag der Austauschbarkeit am Abend ein verdientes Stück Individualität zu genießen. Er verlässt bewusst das verwirrende Theater der Straße – aber bei uns findet er es wieder. Das kann ihn unter Umständen nerven. Ich wünschte mir eine Aufgekratztheit im Theater, die auf beiden Seiten, auf der Bühne und im Publikum, zu ehrlichen Reaktionen führt. Es können da ruhig ein paar Sicherungen durchknallen. Kunst ist immer Trotz – und funktioniert nur über ein Selbstbewusstsein von Fronthaltung. Aber wenn Leute im Theater ab und zu scharf auf unsere Arbeit reagieren und rausgehen, dann sind sie doch wenigstens selbstbewusst. Konvention ist verdrängte Natur, und das macht mir keinen Spaß. Wenn ich pur konventionell sein müsste, würde ich sofort aufhören und wie Arthur Rimbaud Waffenhändler in Zentralafrika werden. Leider bin ich viel zu alt dazu, um zu sagen, ich kann eure ganze Schickeria-Poesie-Scheiße nicht mehr aushalten und gehe nach Afrika.
In der DDR wurde fast jede Inszenierung von Ihnen verboten. Was hielt einen wie Sie im Lande?
Die DDR hatte nur einen einzigen sauberen und freien Zufluss, die Phantasie des Menschen. Das ist ein gefährlicher Zufluss, denn auch das, was wir träumen, existiert ja. Ich wurde in der DDR eigentlich nie so richtig aggressiv, sondern eher traurig – weil ich nicht gewusst hätte, wohin. Es ist so, dass man von einem Ort wegwill, aber nie fortkommt. Man fährt im Traum als Steppenwolf auf dem Highway, aber man sitzt doch nur in Anklam. Aber die Bundesrepublik war keine Alternative. Vielleicht wäre ich abgehauen, wenn Holland unser Nachbar gewesen wäre.
War da so etwas wie Heimatgefühl?
Mein Heimatgefühl war, dass mir die kleinbürgerliche Grundlage des Staates verlachenswert erschien.
Sie haben mal gesagt, Sie seien in der DDR zu spät zur Korrumpierung freigegeben worden. Die Provinz als Lebensretter?
Ich bin vor allzu großer innerer Beschädigung bewahrt geblieben, weil ich weder Orden noch Pass zu einem Zeitpunkt bekam, da ich mich an so ein Leben hätte gewöhnen können. Während ein Regisseur aus der DDR mit einem Klassikerstück im Gepäck im Zug nach Hamburg oder Frankfurt am Main fuhr und sich, vorwärtsfahrend, nach rückwärts gesellschaftskritische Gedanken machte, wurde zur gleichen Zeit vielleicht jemand an der Grenze erschossen. Das war die Lage. Sich dazwischen zu befinden, nicht richtig hier, nicht richtig dort, ständig im Transitzustand – das ist angenehm, aber es macht schizophren. Es zerstört Persönlichkeit. Das erlebte ich so nicht, und so konnte ich mich ganz gut vor mir selber schützen.
Wie waren Ihre Empfindungen, als Sie dann Ende der achtziger Jahre doch im Westen arbeiteten?
Ich hatte meine Chance bekommen wie Rocky I, aber am Schluss steht man da wie Rocky IV: Der Kämpfer ist fett und satt, bekommt eins auf die Nase und muss den antreibenden Urgrund von Hass erst wieder finden. Er muss sich mit Hass abspecken. Das Theater und die Leute zwischen Hamburg und München – das fand ich durch die Bank dumm, hässlich, ältlich, schwächlich. Mit den Leuten, mit denen ich arbeitete, baute ich so kleine kämpferische Widerstandsnester, Strukturen der Freundlichkeit, an denen alles andere abprallte. Wie ein Trojanisches Pferd innerhalb einer ganz anderen Festung. Aber im Großen und Ganzen hat mir damals dieser Schnelldurchlauf Westdeutschland gereicht.
Was unterschied die DDR von der BRD?
Die DDR hasste Vorschläge, die Bundesrepublik hasst Fehler. Aber Vorschläge und Fehler sind das Natürlichste, was der Mensch machen kann.
Das Thema wird uns noch beschäftigen: Trauern Sie der DDR nach?
Nein, um Gottes willen! Die DDR ist sehr folgerichtig an ihrer sehr eigenen Dekadenz zugrunde gegangen. Wenn der Biochemiker keine Geräte mehr bekam, bastelte er eben Stullenbretter für die Großmutter. Unter Honecker hatten sich wichtige intellektuelle Gruppen in ihre Kleingärten zurückgezogen. Wenn sie mal herauskamen, spielten sie mit den anderen Des Kaisers neue Kleider: Alle sehen, was los ist, aber keiner sagt was. Doch irgendwie ging es immer weiter. Das war die Dekadenz des Staates: Er hat uns erstickt. Die DDR – das war in vielen Berufsgruppen Asozialität in ihrer luxuriösesten Form: kein Wind, kein Sauerstoff, nur Mief und Blutleere. Als nach den Anfängen des Staates eines sehr frühen Tages der Satz »Uns geht’s schon besser!« gedacht wurde, war das Ende des Systems eingeläutet. Da ging die Verelendung in den Köpfen los. Den Mühen der Ebene folgte die Tristesse der Ebenen.
Aber es war doch immer noch Leben.
Ja. Sehr, sehr viel arbeiten und sehr, sehr lange blaumachen. Mein Name ist noch immer Oblomow, DDR. Mich interessieren Leute, die unter enorm schlechten Bedingungen enorm schnell arbeiten und dann genussvoll abhängen. Arbeit als Abfolge kurzer, jäher, sehr gefährdeter Aktionen. Die Utopie auf der Fahne, aber die Augen tief im Augenblick. Die andere Frage ist allerdings die nach der Lebenszeit: Wann will ich die ganz anderen Sachen sehen, lesen, denken … Der schöne Selbstlauf dessen, was Spaß macht – es ist auch eine große Gefahr … Ganz am Schluss der DDR gab es diese seltsame Nähe zwischen dem Punk, der früher eins aufs Maul bekommen hatte, und dem Vopomann. Die haben einen historischen Moment lang zusammen gekämpft. Da hatte der Sozialismus eine Hoffnung, die wie New York aussah: ein Schmelztiegel friedfertigen Zusammenlebens aller Extreme. Aber für länger als eine Sekunde New York hatte der Sozialismus keinen Atem. Wenn ich mich allerdings jetzt umsehe, sind die Dinge nicht besser. Die Träume von Strategie sind eine vage Erinnerung, alles versumpfte in der Taktik der Machtsicherung. Sehen Sie, in den Garderoben der Volksbühne sitzt der Schwamm wie auf einem Thron. Aber dann sage ich mir, selbst das hat eine eigene Atmosphäre. Ist mir lieber, als ausgelagert zu werden und dann in eine unzeitgemäße Reinheit zurückzufallen. In der Volksbühne kommt das Einmalige aus dem »Trabant«: Man muss schrauben können und schrauben wollen. Wolldecke ausbreiten und Ersatzteile sortieren – und dann geht es los. Im Übrigen bleiben wir arbeitsscheue Ostler, und wir wünschen dieser Welt die Apokalypse, weil wir uns nicht damit abfinden können, dass nicht jeder von uns einen Mercedes fahren wird.
Es ist eine ganz bestimmte Widerständigkeit, die Sie an der Volksbühne trainiert haben?
Ja. Produzieren am Rande des Abgrunds. Organisation im Dunstkreis des Chaos. Warum soll ich nicht zugeben, wenn ich müde bin? Und nie mische ich mich zu sehr in die eigenen Angelegenheiten. Ich lass es loofen, auch wenn’s mal nicht läuft. Wir haben hier das Leben mit Feindbildern trainiert. Ich weiß, wer mein Feind ist, und ich falle nicht auf die angenehme Selbsttäuschung herein, dass alle Menschen möglicherweise gut seien. Ich will nicht, dass sich meine Antipathien auflösen. Das ist das Problem der Weintrinker. Da ist mir der gute alte Wodka-Alkoholismus von Hendrik Arnst näher. Wodka macht höchstens die Leber kaputt, aber aus der Welt der Witze wissen wir ja, dass auch die mit ihren Aufgaben wächst.
Weil Sie New York erwähnten – was erzählt uns Amerika, wenn man in diesen Zeiten der geistigen Umbrüche über Zukunft nachdenkt?
Ich habe keine Sehnsucht nach US-amerikanischen Verhältnissen. Ich glaube, Amerika lebt mit dem Bewusstsein, dass es keine Utopie gibt, keine Geschichte, keine Identität.
Dieser Gedanke ist auch Europäern nicht gerade fremd.
Ja. Aber dieses Bewusstsein wird in den USA nicht gespeist vom Bedauern über das Schwinden oder die Abwesenheit dieser Dinge im geistigen Leben der Gesellschaften. Der beschriebene Zustand setzt ja gerade unter europäischen Linken eine geradezu fieberhafte Suche nach neuer Orientierung in Gang. Amerika jedoch lebt von der selbstverständlichen Annahme, dass es all das Angesprochene längst materialisiert hat. Dort muss man nicht von Utopien träumen, dort wurden sie Realität. Diesen Eindruck macht Amerika.
Nietzsches Sehnsucht nach der Einheit von Denken und Leben, so sagt der französische Philosoph Jean Baudrillard, sei in Amerika verwirklicht.
Freilich nur unter dem Diktat von Werbung, Look und Bildschirm.
Das Leben als riesige Filmvorführung. Ist das aber nicht zu kurz gegriffen, zu modisch akzentuiert?
Die Protagonisten einer beliebigen nachmittäglichen TV-Serie sind drüben nicht weniger real als die Familie, die nebenan wohnt. Das ist verhängnisvoll für die Weitsicht und den Geist einer Gesellschaft. Dazu gehört übrigens, dass die Mode, der rasante Wechsel des ganz und gar Überflüssigen, zum Kernpunkt der Philosophie des Lebens wird: Ewiges Zirkulieren, ewiges Tempo, ewige Bewegung simulieren ewigen Fortschritt. Die US-amerikanische Revolution – das ist die Revolutionierung der Oberfläche. Europa weint zerborstenen Idealen nach, Amerika lacht: Es muss nichts mehr erreichen. Das ist die Askese des Übersättigten. Alles funktioniert, und wo Funktionstüchtigkeit signalisiert werden kann, tut man’s: Es beruhigt. Und man hat nur noch Angst, dass Funktionalität gestört wird. Deshalb gilt sie für Tag und Nacht, deshalb werden Tausende Büros in den Großstädten nachts beleuchtet gelassen.
Wenn Sie sagen, Amerika begreife sich selbst als verwirklichte Fiktion – wie wirkt sich das auf den Willen und die Fähigkeit zur Reflexion aus?
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.