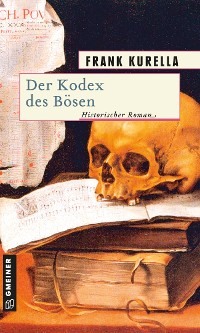Kitabı oku: «Der Kodex des Bösen», sayfa 3
»Dann möchte ich nicht in Eurer Haut stecken. Ihr glaubt nicht im Ernst, ich wäre dieses Wagnis eingegangen, um am Ende mit leeren Händen dazustehen und schuldbeladen vor den Herrgott zu treten! Ihr habt es mir versprochen und werdet Eure Zusage halten.« Die Ungeduld in seiner Stimme wurde eindringlicher. Einmal mehr bereute der andere, dass er sich in einem Anfall des Leichtsinns offenbart hatte. Zu drückend war die Erkenntnis des Entdeckten geworden, als dass er sie länger für sich hätte behalten können. Die Begehrlichkeit, die er dadurch geweckt hatte, saß ihm nun bleischwer im Nacken, wie ein Gewicht, das die Waagschale unausweichlich herunterdrückt. »Die unumgängliche Geisel der Menschheit, der Krieg, wird Euch eine Galgenfrist gewähren. So werden meine Helfer noch einige Zeit brauchen, die Vorbereitung zu vollenden. Nutzt die Zeit, die Euch verbleibt.« Mit diesen drohenden Worten wandte er sich ab und verließ das nächtliche Treffen. Eilig führte der Zurückgebliebene seine Arbeit fort.
*
Durch die kleine Maueröffnung des Blutturms fiel spärliches Mondlicht ins Innere und ließ die Spuren der ersten Befragung in Janssens Gesicht erkennen. Hatte er zu Beginn alles noch für ein Missverständnis gehalten, so hatten die Schläge, die seine Nase zertrümmerten, jeden Zweifel zerstreut. Ein Geistlicher hatte sie bereits erwartet, als man ihn am Abend in den Blutturm, in das städtische Gefängnis, geführt hatte. Man hatte ihn nach Marcus gefragt und den Worten mit einigen Stockschlägen Nachdruck verliehen. Der Priester hatte stumm in einem der dunklen Winkel gestanden und keine Miene verzogen, als das Verhör mit unerbittlicher Brutalität fortgesetzt wurde. Immer wieder hatte Hubertus Hohenfels unerbittlich zugeschlagen.
Jetzt, wo Berthold Janssen wieder allein war und über die Geschehnisse dieses furchtbaren Tages nachdachte, kamen ihm Bilder aus längst vergangenen Zeiten in den Sinn. Er sah den kleinen braunhaarigen Jungen vor sich, wie er ihn freundlich mit der breiten Zahnlücke eines Sechsjährigen angelächelt hatte. Dankbar hatte ihn Hubertus jedes Mal angestrahlt, wenn er ihm einen glänzenden Apfel zugesteckt hatte. Auch wenn es dem Jungen Mühe bereitet hatte, mit seinen verbliebenen Milchzähnen die kräftige Schale zu zerbeißen, so schien dieser rote Apfel ein Stück kindliche Glückseligkeit bedeutet zu haben. Und was war aus diesem kleinen freundlichen Jungen geworden? Ein eiskalter Scherge des Schultheißen, der brutal auf ihn eingeschlagen hatte, um zu erfahren, wo sich Marcus aufhielt. Selbst wenn er es gewusst hätte, hätte er es ihm trotz aller Schläge nicht gesagt. Was würde noch folgen? Berthold Janssen versuchte sich damit zu trösten, dass Marcus wohl in Sicherheit war. Sicherheit wovor? Was hatte der Junge nur so Schlimmes angestellt, dass man ihn, seinen Vormund, aus dem Haus geschleift und hierher gebracht hatte, um ihn so zu misshandeln? Gewiss würde sich die Lage schon morgen klären, und er könnte zu Annehild zurückkehren.
Der zweite Tag
Die Sonne war schon lange über dem Lager aufgegangen, als Marcus, vom morgendlichen Treiben geweckt, die Augen aufschlug. Er rieb seinen schmerzenden Rücken und versuchte sich zu orientieren. Hatte er wirklich die ganze Nacht hier eingezwängt zwischen diesen Säcken auf einer Holzstange gelegen? Langsam drehte er sich in der Enge des Zeltes, als ihm die Erinnerung an den gestrigen Abend und das sanfte Lächeln Patricias in den Sinn kamen. Gleichzeitig durchfuhr ihn ein Schreck: Wer war der Mann mit dem Dolch gewesen? Das fast schon vertraute Stöhnen hinter seinem Rücken riss ihn aus den Gedanken. Marcus wandte sich ruckartig um und blickte auf einen in Decken gehüllten Körper, der nicht weit von ihm zwischen einigen Kisten lag. Das Stöhnen klang keineswegs Angst einflößend, nein, eher flehend und schmerzverzerrt. Dennoch kroch Marcus nur zögerlich in die Richtung, aus der die Geräusche zu ihm drangen. Unvermittelt bewegte sich das Bündel, und die Decke gab den Oberkörper eines Ritters frei. Rot unterlaufen stachen seine Augen aus einem kreidebleichen Gesicht heraus, auf dem kleine Schweißtropfen im Sonnenlicht schimmerten. Die schwarzen Locken des Mannes lugten unter einer Art Verband hervor, der provisorisch um den Kopf geschlungen war. Seine schmalen Lippen wirkten trocken und rissig. Aus seinem halb geöffneten Mund drang nun wieder dieses Seufzen. Der rot-schwarze Wappenrock war über und über mit Blut verschmiert. Marcus verstand bei diesem Anblick, warum der Mann am Abend zuvor hinter ihm kraftlos zusammengesunken war. Warum lag dieser Schwerverletzte hier im Vorratszelt zwischen Säcken, Stangen und Kisten, statt auf einem ordentlichen Lager gepflegt zu werden? Marcus fuhr herum, als der Eingang seiner Zuflucht geöffnet und das Innere mit Licht erfüllt wurde.
»Guten Morgen, äh …, wie ist eigentlich dein Name?« Fröhlich wippend streckte sich die rote Lockenmähne Patricias durch den Spalt der Zeltwand, und ein freundliches Lächeln erstrahlte.
»Äh, … Marcus«, antwortete er schüchtern.
»Gut, Marcus. Mein Name, also mein richtiger Name, auf den ich getauft wurde, ist Hildegund, doch mittlerweile nennen mich alle Patty.«
»Du bist keine …?«
Sie lachte hell auf. »Nein, keine Irin, wenn du das fragen wolltest. Es ist nur eine Art Rolle. Die Männer mögen das Unbekannte, das andere. Und so kam Dobberstein eines Tages auf den Gedanken mit ›Patricia‹, der Irin. Wegen meines roten Haars, verstehst du?« Dabei griff sie in ihre zerzauste Mähne und ließ sich eine lockige Strähne verführerisch ins Gesicht fallen. Die Haarspitzen kitzelten sie an der Nase, und sie begann zu kichern.
Marcus kam sich mit einem Mal unendlich dumm vor, den Schwindel nicht direkt durchschaut zu haben. Hätte er sie überhaupt entlarven können? Gewiss! Marcus schlug sich gedanklich mit der flachen Innenhand vor die Stirn, wie jemand, dem urplötzlich ein Licht aufgegangen war. ›Auf einen mehr oder weniger kommt es nun auch nicht mehr an‹ – dies war zwar das Einzige gewesen, was sie gestern zu ihm gesagt hatte, doch war bei diesem Satz kein Akzent zu hören gewesen, der auf eine Irin hingewiesen hätte. Marcus blickte über die Schulter zu dem Verletzten und verstand nun auch, was sie damit gemeint hatte. Sie hatte den Mann genauso hier versteckt wie ihn. Doch warum musste man den Ritter überhaupt verstecken? Gehörte er denn nicht zum Lager? Patty schien seine Gedanken zu erahnen. »Komm erst einmal heraus. Wir sind unter uns, und du hast sicher Hunger.« Mit diesen Worten verschwand ihr Gesicht aus dem Zelteingang, und Marcus folgte ihr eilig hinaus ins Freie.
Gestern Abend war es bereits zu dunkel gewesen, und so hatte Marcus erst jetzt Gelegenheit, sich umzuschauen.
Die Zelte der Gaukler waren so angeordnet, dass sich in ihrer Mitte ein nahezu halbrunder Platz ergab. Dort saßen die Spielleute um eine Feuergrube und scherzten miteinander. Die abendliche Störung durch den Legaten des Erzbischofs hatte ihrer guten Stimmung offensichtlich keinen nachhaltigen Abbruch getan. Dies war anscheinend eine Situation gewesen, der sie, in der einen oder anderen Form, immer wieder begegneten. Die meisten Gaukler hatten sich damit abgefunden, dass sie am Rande der Gesellschaft standen, und so ertrugen sie Mal für Mal die übelsten Anfeindungen – besonders seitens des Klerus. In den Augen der Kirche waren sie Vaganten und somit entlaufenen Mönchen und streunenden Nonnen gleichzusetzen.
Marcus schaute sich weiter um. An der geraden Seite des Halbrundes entdeckte er das mit Abstand größte Zelt, hinter dem sich die improvisierte Bühne befinden musste. Direkt gegenüber stand ein großer Holzkarren. Ein Ochse oder gar ein Pferd, das ihn hätte ziehen können, war weit und breit nicht zu sehen. So ordentlich die Zelte auch angeordnet waren, so unordentlich wirkte das sonstige Lager. Überall standen Truhen und Kisten, lagen Leinensäcke und Stangen verstreut. Dort hinten schien das Nachtlager van der Keuls zu sein, denn vor dessen Eingang lagen unzählige Bälle und Keulen achtlos herum. Daneben war in etwa drei, vier Ellen Höhe ein Seil in der Art gespannt, wie Marcus es auf dem Neusser Jahrmarkt einmal gesehen hatte. Ein Mann mit verschiedenfarbigen Beinlingen war hinaufgestiegen und von der einen zur anderen Seite balanciert, während er mit drei brennenden Keulen jongliert hatte. Hier diente das Seil nur zum Trocknen der Wäschestücke – zumindest für den Moment. Einige Tücher und fadenscheinige Tuniken flatterten lustig im Wind. Nur der Platz vor einem kleinen Zelt fiel durch seine Aufgeräumtheit auf. Marcus war überzeugt, dass dies Pattys Schlafstätte sein musste.
Langsam ging er auf die Gruppe zu und spürte dabei unter seinen Füßen, dass der Boden morastig war. Ganz in der Nähe musste ein Flusslauf oder etwas Ähnliches sein. Sicherlich hatte man ihnen einen Platz flussabwärts zugewiesen, sodass der gesamte Unrat des Lagers an ihnen vorbeischwamm. Es war nicht das beste Fleckchen Erde, doch wahrscheinlich mussten die Gaukler froh sein, überhaupt hier lagern zu dürfen.
Marcus blieb stehen und schaute hinunter auf seine durchnässten Bundschuhe.
»Komm schon!« Patty stand bei den anderen und winkte ihn herüber. Etwas schüchtern folgte er ihrer Aufforderung.
»Das ist Marcus. Er hat ein wenig Schwierigkeiten mit der Obrigkeit, und so wird er eine Weile bei uns bleiben.« Lächelnd und gleichzeitig fragend schaute die junge Frau zu ihm herüber. »Dominikus, bitte sei so gut und stelle ihm die Truppe vor. Ich muss mich um unseren anderen Gast kümmern.« Sie zwinkerte Marcus aufmunternd zu, als sie an ihm vorbei zum Vorratszelt zurückging. Diesmal hatte er es sich keinesfalls eingebildet.
Dobberstein erhob sich aus seinem Scherenstuhl und machte eine einladende Handbewegung in Marcus’ Richtung. Erst jetzt fiel ihm auf, dass Dominikus der Einzige war, der nicht auf dem Boden hockte. Gewiss stand ihm dies als Kopf der Truppe zu. Die anderen Gaukler rutschten auf den Fellen, auf die sie sich zum Schutz vor der Feuchtigkeit gesetzt hatten, zusammen und gaben so eine Lücke für Marcus frei.
»Setz dich zu uns ans Feuer, Jungchen, der Morgen ist noch recht frisch.«
Jungchen? War ihm Dominikus gestern Nacht noch sehr sympathisch gewesen, so war er gerade im Begriff, es sich mit ihm zu verscherzen. Seine väterliche Art ließ Marcus jedoch ein Auge zudrücken.
»Jacobus, gebt ihm ein Stück Brot.« Mit einem freundlichen Lächeln reichte ihm der blasse Ballkünstler einen Kanten und nickte ihm ein Willkommen zu. »Jacobus hast du ja gestern schon auf der Bühne gesehen. Und dies sind Rudolf und Tilmann.«
Die beiden Spielleute, die Brüder zu sein schienen, waren ihm gestern Nacht durch ihre Dicklichkeit aufgefallen. Zu Rudolfs Trommel hatte der wohlgenährte Körper ja gepasst, aber die Schalmei in Tilmanns klobigen Händen hatte beinahe wie ein zerbrechliches Stöckchen gewirkt. Marcus biss in den harten Kanten Brot und fragte sich, wie man sich bei dieser Verpflegung nur eine solche Leibesfülle anfressen konnte.
»Ja, und unser Johann dreht die Leiher und singt beizeiten auch dazu«, fuhr Dominikus fort.
»Vor allem zu den Minnezeiten«, unterbrach ihn Jacobus in seinem flämischen Akzent, und die Runde lachte laut auf.
Der dunkelhaarige Schönling schaute mit gespielter Verärgerung trotzig auf sein Brot. »Es ist nur der Neid darüber, dass ich, im Gegensatz zu Euch, von der feinen Damenwelt geliebt werde. Ich kann nichts dafür. – Es ist nun einmal mein Schicksal.« Dabei zuckte Johann kurz mit den Achseln und stimmte dann in das Gelächter mit ein.
Ein unerwarteter Knall durchbrach das Lachen. Marcus blieben Brot und Freude abrupt im Halse stecken, und er schreckte unweigerlich auf. Der donnernde Krach war aus der Richtung des hinteren Zeltes gekommen. Nur allmählich ebbte auch das Lachen der anderen ab, die sich nicht hatten aus der Ruhe bringen lassen.
»Das war nur Niko«, erklärte Tilmann gelassen und schüttelte beinahe unmerklich den Kopf. »Der übt schon wieder dort hinten mit seinem besten Freund – dem Dolch.« Genüsslich schob er sich das letzte Stück Brot in den Mund, und Marcus meinte, seinen Kiefer knacken zu hören. »Magst du deins nicht?«, fragte der Spielmann.
»Doch, doch«, erwiderte Marcus und wollte gerade abbeißen, als, wie aus dem Nichts, eine kleine schwarze Gestalt fauchend vor seine Füße sprang. Abermals schrak er zusammen und ließ das Brot ins matschige Gras fallen. Das dunkle Geschöpf griff hastig danach und verschwand so urplötzlich, wie es aufgetaucht war. Marcus war immer noch zu Tode erschrocken und fragte sich, was ihm gerade widerfahren war, als eine unbekannte Stimme zu ihm sagte: »Verzeiht Girolamos Gier nach allem Essbaren.« Der Dudelsackspieler trat von hinten in die Runde. Auf seinem rechten Unterarm saß die seltsame Kreatur. Sie war am ganzen Körper mit schwarzem Fell bedeckt, und ihre überlangen Gliedmaßen baumelten schlackernd herunter. Die Augen des Geschöpfs blitzten Marcus gefährlich an, und spitze Zähnchen lugten aus seinem kleinen Mund hervor, um den sich ein langer Backenbart rankte. Mutter Gottes, war das ein Tier oder ein satanischer Zwerg?, durchfuhr es Marcus. Wenn es ein Tier war, dann keines, dem er jemals zuvor begegnet war. Die Feindseligkeit der Mimik verschwand unvermittelt aus dem behaarten Gesicht des Wesens, und Neugierde regte sich in seinen Zügen.
»Was ist das?« Zögerlich streckte Marcus seinen Finger aus und zeigte auf die Kreatur, die seine Geste erwiderte.
»Es ist eine Meerkatze. Besser gesagt, es ist ein ›Er‹. Sein Name ist Girolamo.«
»So etwas wie ein Affe?« Marcus hatte mal einen weit gereisten Seemann von einem solch merkwürdigen Tier erzählen hören und ihn für verrückt gehalten. Nun schien sich das vermeintliche Seemannsgarn von einem menschenartigen Tier zu bestätigen.
»Ja, Girolomo ist in der Tat ein Affe, und sogar ein ganz gelehriger. Ich habe ihn erst kürzlich von einem Händler aus Ascoli gekauft.«
»Und das ist auch der Grund, warum Gerald ihn Girolamo nennt!«, rief Jacobus wieder dazwischen, und die Runde lachte erneut auf. Marcus verstand kein Wort und blickte verunsichert drein.
»Du bist kein Mann der Kirche? Girolamo Masci d’Ascoli ist der weltliche Name unseres ›verehrten‹ Papstes Nikolaus IV.«, erklärte Rudolf. Begleitet von einer spöttischen Handbewegung, verneigte sich der Dicke langsam. Nachdem er den Kopf wieder gehoben hatte, fuhr er fort: »Du wunderst dich vielleicht über so viel Spott gegenüber dem Heiligen Vater und der Mutter Kirche. Ich will dir den Grund unserer Verbitterung nennen.« Seine Miene wurde mit einem Mal ernst und steinhart. »Dass wir unsere Klagen nicht vor einen Richter tragen können, ja, selbst nicht einmal als Zeuge zugelassen werden, ist nun einmal Justitias blinder Wille. Dass die weltlichen Herren uns Spielleute gering schätzen, können wir ertragen. Laden sie uns trotz alledem zu ihren hochherrschaftlichsten Festen ein und füllen dort unsere Mägen als Dank für unsere unterhaltenden Dienste. Ein Umstand, der nicht erst seit dem Konzil in Ravenna vor zwei Jahren seitens der kirchlichen Obrigkeit ausdrücklich gebilligt wird. Doch dieselbe Kirchenversammlung verbot auch jedem Priester aufs Schärfste, uns Herberge zu gewähren. Es gilt gar als Sünde, uns ein paar Münzen zuzustecken. So versucht der Klerus obendrein, den ohnehin spärlichen Geldfluss gänzlich zu unterbinden, auf dass wir verhungern mögen. Schließlich kann die Zeit von Bankett zu Bankett mit leerem Magen lang, ja, zu lang werden. Den Eifer, mit dem sie dieses Spiel betreiben, hast du ja gestern Nacht selbst beobachten dürfen!« Wut und Resignation blickten aus seinen müden Augen. Es war totenstill in der Runde geworden. Selbst Jacobus fiel hierauf kein treffender Scherz ein.
»Was ist denn mit euch los?«, fragte Patty verwundert, die soeben eilig an ihnen vorbei zu dem Zelt ging, von dem Marcus vermutet hatte, dass es ihres war.
»Wenn wir Patty nicht hätten«, seufzte Dominikus.
»Dann hätten wir Hildegund!« Jacobus hatte seinen Schalk wiedergefunden, und mit ihm kehrte ein erstes Anzeichen fröhlichen Lebens in die Runde zurück.
Im selben Augenblick trat die Genannte wieder aus ihrem Zelt. In der Rechten hielt sie einen kleinen Holzbottich. »Komm, Marcus. Du kannst mir helfen.«
Hastig sprang der Angesprochene auf und folgte ihr zwischen den Zelten hindurch. Er war froh, auf diese Weise der Trübsinnigkeit zu entkommen, die mit einem Mal in den Gedanken der Männer aufgezogen war wie eine plötzliche Regenwolke am Sommerhimmel. Noch mehr freute ihn, dass er so mit Patty zusammen sein konnte. Seine Wangen glühten, als er ihr nachlief.
Er hatte sie gerade eingeholt, als sie den nahe gelegenen Bachlauf erreicht hatte. Es musste wohl der Norfbach oder ein anderer kleiner Nebenarm der Erft sein, dachte Marcus. Die Böschung war an dieser Stelle steil und wild bewuchert. Patty trat so dicht es ging ans Wasser heran und hielt ihm seitlich ihren linken Arm entgegen. »Halt mich fest, damit ich nicht schon wieder im Bach lande. Erst gestern habe ich so für großes Gelächter unter den Männern gesorgt.«
Marcus griff nach ihrer schmalen Hand. Sie streckte sich, um den Bottich ins Wasser zu tauchen. Der grüne Stoff ihres Leinenkleids spannte sich um ihren schlanken Körper und zeichnete eine Silhouette, die Marcus’ Blick nicht mehr losließ. Fließend umschloss das Gewebe ihren Busen, der noch straffer und fester wirkte als sonst. Marcus genoss diesen zufälligen Anblick. Er bemerkte die Zartheit ihrer Hand, die sich Hilfe suchend um die seine schloss. Als einzige Frau unter diesen skurrilen Gesellen wurde sie sicherlich nicht von harter Arbeit verschont. Und dennoch …
Pattys grobe Holzschuhe verloren den Halt auf dem Morast, und sie drohte zu stürzen. Geistesgegenwärtig packte Marcus energisch zu. Dabei schlang er den freien Arm um ihre Taille und zog sie die Böschung herauf. Unweigerlich pressten sich ihre Körper aneinander. Als sie nun so eng umschlungen dastanden, spürte er deutlich, dass sie vor Schreck am ganzen Leib zitterte. Vor Schreck? Ihre Brust hob und senkte sich im Takt ihres schweren Atems. Mit einem sanften Lächeln blickte sie ihm tief in die Augen, und in Marcus erwachte ein Gefühl, das er noch nie gespürt hatte. Unvermittelt riss sie sich von ihm los.
»Entschuldige, Marcus, aber ich muss mich nun wirklich um den Verletzten kümmern. Du weißt selbst, wie schlecht es ihm geht. Ich danke dir.« Mit hochroten Wangen hob sie den Bottich auf, in dem ein ausreichender Rest Wasser zurückgeblieben war, und lief zu den Zelten.
*
Hatte die frühe Sonne eben noch ihren Tanz durch das zarte Grün der Buchen vollführt, so war der Wald nun dichter geworden und damit das anmutige Muster des Lichts vom vor ihnen liegenden Weg verschwunden. Laut knirschend rollte der kleine Pferdewagen über den Kies dahin.
»Ich wünschte, unsere Eminenz der Erzbischof hätte uns einige seiner Bewaffneten mit auf diesen langen Weg gegeben.« Ängstlich sprangen die Pupillen des jungen Geistlichen im Weiß der Augen hin und her. Die Fingerspitzen seiner Hände, die die Zügel verkrampft umklammerten, waren schneeweiß und blutleer.
»Ihr wisst genauso gut wie ich, Bruder Mattäus, dass der ehrwürdige Vater jeden Mann für die bevorstehende Schlacht benötigt.« Bei dem Wort ›ehrwürdig‹ klang die Stimme des Alten spöttischer denn je. »Und wer sollte es schon auf uns zwei Kirchendiener abgesehen haben? Gott, der Herr, wird uns beistehen. Doch wenn seine Obhut Euch nicht Zuversicht genug ist: Die Abtei zu Brauweiler ist nicht mehr weit. Aber beendet nun endlich Euer kindliches Gejammer. Erfreut Euch lieber an dem Gedanken, dass Ihr schon bald das hohe Amt des Priors bekleiden werdet.«
»Dafür danke ich Gott und Erzbischof Siegfried aus tiefstem Herzen. Auch Euch danke ich, Bruder Lucius, dass Ihr mich bei der neuen Aufgabe unterstützen wollt.«
Wollen? Davon konnte nun wirklich keine Rede sein. Der Greis umklammerte seinen Gehstock mit zornigem Griff, als wolle er ihn zerquetschen.
»Ich war ehrlich gesagt ein wenig überrascht. Dachte ich doch bisher, Ihr würdet mich in keiner Weise schätzen, ja, beinahe verachten. Ihr wart stets so abweisend und barsch, Bruder Lucius.«
»Ja, so kann der Schein unser Auge und unser Empfinden täuschen.«
»Aber nun ist mir schon viel leichter ums Herz. Bei Euren Worten ist meine Furcht verflogen. Gewiss habt Ihr recht und niemand hier in diesem Wald, ein wahres Meisterwerk unseres Herrgotts, ist auf unseren Schaden bedacht.«
»Seht, und schon wieder trügt Euch der Schein.«
Erstaunt und mit fragendem Blick schaute der junge Geistliche seinen Glaubensbruder an, als sich der Bolzen einer Armbrust mit einem Knirschen in seine Stirn bohrte. Mit einem Mal gefror jede noch so kleine Bewegung, und sein lebloser Körper fiel nach hinten auf die Ladefläche der Kutsche. Dabei zogen die verkrampften Hände die Zügel an, und das Pferd stoppte seinen ruhigen Lauf. Lediglich ein schmales rotes Rinnsal bahnte sich seinen Weg über die Stirn des Toten, der mit weit aufgerissenen Augen dalag.
Unter lautem Knacken des Gehölzes kam ein Mann die Böschung hinuntergerutscht. Auf seiner linken Schulter ruhte die Armbrust, in welcher sich Sekunden zuvor noch der tödliche Bolzen befunden hatte. In seiner Rechten hielt der Mann ein Kurzschwert, dessen Spitze er von Weitem auf den greisen Alten richtete. Der hockte ruhig auf dem Kutschbock und schaute den Bewaffneten ohne jede Regung an. »Das wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, wir kämen in der Abtei Brauweiler an, ohne dass Ihr Gelegenheit hattet, uns Eure Aufwartung zu machen.«
»Eure Freude über mein Erscheinen wird Euch noch im Halse stecken, wenn man Euren Leichnam neben dem anderen Toten hier auf dem Weg findet.«
»Und Euer Lohn?«
»Macht Euch meinetwegen keine Umstände. Ich werde die Geldstücke auch ohne Euer freundliches Mittun in einer Eurer Truhen finden.«
»Wie Ihr meint. Aber wollt Ihr denn diese Quelle, die Euren Geldbeutel stetig füllt, ein für alle Mal versiegen lassen? – Seid kein Narr und verdient Euch meine Münzen auch weiterhin mit ›ehrlicher Arbeit‹.«
Der Alte hatte recht. Zerschlug man einen Bienenstock, nachdem man den Honig geerntet hatte? Der Mann ließ die Schwertspitze sinken.
»Helft mir herunter, damit ich Euch – nun doch mit meinem freundlichen Mittun – den versprochenen Lohn aus der Truhe holen kann.«
Der Angesprochene trat dicht an den Wagen heran, sodass sich der Geistliche auf seiner Schulter abstützen konnte. Mühsam kletterte der alte Mann vom Kutschbock und humpelte auf seinen Gehstock gestützt zum hinteren Ende des Wagens. Der Armbrustschütze folgte ihm. Kraftlos zerrte der Greis an einer der Truhen, doch gelang es ihm nicht, dieselbe vom Fleck zu bewegen. Mit missmutiger Miene drehte er sich um. »Ich bitte Euch nur ungern, aber ich benötige erneut Eure Hilfe.« Angesichts seiner Gebrechlichkeit, die ihm einmal mehr bewusst wurde, schaute er zornig drein, aber ein ironisches Lächeln huschte über seine Züge. »Ich hoffe nur, Ihr verlangt keinen weiteren Heller dafür, dass Ihr mir diese Truhe vom Wagen heben sollt.« Dabei trat er einen Schritt zurück und gab die Ladefläche der Kutsche frei. Der andere Mann legte das Kurzschwert ab und erfasste die Griffe der Truhe. Schon beim ersten Anheben merkte er, dass der Greis dieses Gewicht beim besten Willen nicht hatte herunterheben können. Im selben Moment spürte er einen stechenden Schmerz im Rücken. Hatte er sich nun selbst an dem schweren Packstück verhoben? Langsam schaute er an sich herunter. Aus seinem Bauch ragte die Spitze seines Kurzschwertes, und ein sich rasch vergrößernder Blutfleck bildete sich auf seinem schmierigen Wams. Er hörte noch das heisere Lachen des Alten, bevor er tot zusammensackte.
*
Patty kniete neben dem Verletzten, der zu schlafen schien, als Marcus gebückt das Zelt betreten hatte. Sie hatte den Kopfverband entfernt und betupfte seine Stirn mit einem feuchten Tuch.
»Es tut ihm leid, dass er dich heute Nacht bedroht hat«, erklärte Patty und schaute dabei nur kurz zu Marcus herüber.
»Schon gut, ich habe es ja überlebt. Wer hat ihn so zugerichtet?« Sein Blick fiel auf die klaffende Platzwunde, der Pattys Pflege galt. Die Ränder der Wunde wirkten eitrig, und ringsherum schillerte die Stirn in einem dunklen Blaurot. Auch der linke Oberarm war nicht unversehrt geblieben. Zumindest deutete ein weiterer Verband darauf hin, den Patty wohl bereits erneuert hatte.
»Das waren Dietrich von Keppel und seine versoffenen Männer. Ich möchte nicht wissen, was sie mit dem armen Kerl angestellt hätten, wenn sie gewusst hätten, wer er ist.« Ihre Stimme klang ärgerlich und fürsorglich zugleich.
»Wer ist er denn?«, fragte Marcus und reichte ihr den Verbandsstoff, nach dem sie sich streckte.
Sie sah den Verletzten mit einem Blick an, als wolle sie ihn um Erlaubnis bitten, seine Identität preiszugeben. Dann fuhr sie zögerlich fort: »Er ist Walter von Bisdomme, der Knappe des Herzog Johann von Brabant.« Wie auf Kommando erwachte der Fremde und richtete sich beunruhigt auf. Wenige Atemzüge später sank er kraftlos zurück auf den dünnen Strohsack. Mit ihrem Lächeln beruhigte Patty den Mann. Dann wandte sie sich wieder ihrem zweiten Schützling zu und erklärte: »Ich glaube, es ist besser, wenn ich dir draußen mehr über die Sache erzähle.«
Vorsichtig half sie dem Brabanter, sich ein wenig aufzusetzen, und schob ihm einen weiteren Strohsack unter den Rücken. Dann griff sie nach einer Schale und flößte dem Mann etwas Warmes, Dickflüssiges ein, das nach Haferbrei duftete. Nach ein paar Löffeln setzte sie die Schale langsam wieder ab und führte die Spitze ihres Zeigefingers an seinen Mund. Behutsam wischte sie ihm mit einer fast zärtlichen Bewegung einen Rest Brei von der Unterlippe. Marcus spürte, wie seine Wangen plötzlich zu brennen begannen und ein merkwürdiges Gefühl in ihm aufloderte, wie die züngelnden Flammen einer Feuerstelle. Was ist nur mit mir los?, wunderte er sich. Ist das etwa Eifersucht? Wie in Trance griff er nach ihrer Hand, mit der sie den Holzlöffel hielt. Zum zweiten Mal an diesem Tage spürte er ihre zarte Haut und war erneut überrascht, wie sanft sie sich anfühlte. »Lass mich das machen. Du hast bestimmt noch genug andere Dinge zu tun«, hörte er sich sagen.
Erstaunt reichte sie ihm Schale und Löffel und überließ ihm den Platz am Krankenlager. »Das ist sehr lieb von dir, Marcus. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir ein Mann jemals Arbeit abgenommen hätte, statt mir zusätzliche zu verschaffen.« Sie hauchte ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange und verließ mit einem fröhlichen Summen das Zelt.
Die beiden Männer waren wieder allein. Allein wie in der gestrigen Nacht. Doch nun war die Situation eine ganz andere. Das Beisammensein hatte nichts Ungewisses mehr, nichts Beängstigendes. Mit jedem Löffel Haferbrei schien Leben in Walters Gesicht zurückzukehren. Auch wenn es noch gar nicht lange her war, seit Marcus ihn dort in die Decke gehüllt hatte liegen sehen, so erschien er ihm schon deutlich kräftiger. Seine Augen, die nun gar nicht mehr so blutunterlaufen wirkten, blickten ihn mit einem Ausdruck der Dankbarkeit an. Fast unmerklich nickte Marcus ihm aufmunternd zu. Er wusste immer noch nicht, warum der Knappe hier in das Lager gekommen war und warum man ihn so zugerichtet hatte. Er war überzeugt: Dieser Dietrich von Keppel, von dem Patty gesprochen hatte, war bestimmt einer der Männer, für die er die Felle hatte zum Zelt tragen müssen und die bei der abendlichen Vorstellung immer wieder auf ihre widerliche Art nach Patty verlangt hatten. Womöglich war es sogar genau der Kerl, der ihm die Ohrfeige beigebracht hatte.
Nachdem die Schale geleert war, half er dem Knappen, sich wieder hinzulegen, und verließ das Zelt. Im Gauklerlager war der Alltag eingekehrt. Einige der Schausteller hatten zu üben begonnen, andere hatten sich aus dem Staub gemacht und waren weit und breit nicht zu sehen. Nur einer war einsam an der Feuerstelle zurückgeblieben – Niko, der Kroate. Die Beine verschränkt, saß er dort und hielt eine Schale in der Hand, wie die, aus der Marcus gerade noch dem Brabanter den Haferbrei gereicht hatte.
Da Dominikus vorhin noch keine Gelegenheit gehabt hatte, ihn vorzustellen, ging Marcus auf den Messerwerfer zu und begrüßte ihn freundlich. »Hallo, mein Name ist Marcus.«
Der Mann blieb stumm und schaute unbeirrt auf seinen Haferbrei.
»Du musst Niko sein. Ich habe dich gestern auf der Bühne gesehen.«
Erst jetzt schien der andere ihn wahrzunehmen. Langsam hob er den Kopf und schaute Marcus von unter herauf aus dunklen Augen an. Er wirkte nun sogar noch finsterer als gestern Nacht. Selbst ohne seine Dolche. Stumm und kurz nickend erwiderte der Kroate den Gruß und wandte sich wieder seinem Brei zu.
»He, Marcus!« Dobbersteins Stimme erklang hinter dem jungen Mann. »Du kannst mir helfen, die Pferde vom Bach herüberzuholen.«
Marcus lief hinter Dominikus her, und sie verließen das Halbrund des Lagers. »Was ist mit ihm?«
»Ach, mach dir nichts draus und nimm es nicht persönlich. Niko ist nun mal so, wie er ist. Auch mit uns spricht er nur das Nötigste. Aber die Leute sehen seine Auftritte gern, und wenn es hart auf hart kommt, können wir einen Mann, der mit seinen Dolchen umgehen kann, gut gebrauchen. Ich glaube, er hat Schlimmes durchgemacht und vertraut sich seither niemandem an. – Schau, da drüben, das sind unsere.« Dobberstein wies auf die beiden Tiere, die am Bachrand ruhig grasten. Dass diese zur Gauklertruppe gehörten, hätte er nicht sonderlich betonen brauchen. Gewiss wäre keiner der Ritter mit diesen klapprigen Gäulen in die bevorstehende Schlacht gezogen. Und wenn es dennoch einer versucht hätte, so wäre er dort nicht angekommen.
*
Mit immer noch rot verweinten Augen bog die Frau in die Gasse ein, die den Hauptstraßenzug mit dem Freithoff verband. Hier wurden stets die Gerichtstage abgehalten, und so hatten die Gassen, die von diesem Platz fort führten, ihren Namen erhalten: ›Friedhofslöcher‹. Nach Süden führte der Weg zum Galgenberg an der Ober Pfortz, nach Norden ging’s hingegen zum Schafott am Rheintor. Daran mochte Annehild zu dieser Stunde nun gar nicht erst denken.