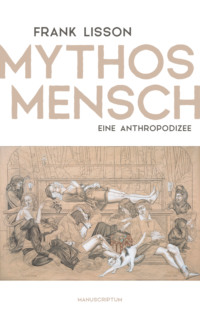Kitabı oku: «Mythos Mensch», sayfa 2
I.
Man muß inne werden, daß die Welt nur als eine Erkenntniß da ist und somit abhängig vom Erkennenden welches man selbst ist. Das Seyn der Dinge ist identisch mit ihrem Erkanntwerden.
Arthur Schopenhauer,
Vorlesung über die gesamte Philosophie, 1820.
Wesen, Wille, Werden
Von neuen Nöten. – Jede echte und ernsthafte Philosophie, die heute, nach mehr als zweitausendfünfhundert Jahren des ernsthaften Weltbedenkens, mit dem Anspruch auftritt, nicht überflüssig zu sein, kann nur in dem Versuch einer Totaldurchdringung aller Lebensverhältnisse, in der buchstäblichen Haltlosigkeit eines exorbitanten Standpunktes bestehen; also in der Position des radikalen Außerhalb, die von sich selber verlangen muss, in allen Fragen immer noch einen Schritt weiter zu gehen, als vor ihr gegangen worden ist. Eine psychologisch untermauerte Überschreitungsphilosophie, die alles hinter sich zurücklässt, was bisher daran hinderte, den Menschen und das Leben in seiner ganzen, erst heute sichtbaren Ungeheuerlichkeit begreifen zu wollen. Und obwohl wir wissen, einer solchen Aufgabe nicht gewachsen zu sein, weil das, was an Rätsellösungsnöten jetzt noch kommen kann und kommen muss, weit über das allgemein Fassbare und Verträgliche menschlicher Selbstbetrachtungsweisen hinausgehen wird, dürfen wir vor der Größe dieser Aufgabe dennoch nicht erschrecken, sondern sollten uns den neuen Problemen wenigstens stellen und tapfer daran zu arbeiten beginnen! Ja, selbst auf die Gefahr hin, dass wir es hier mit einer Not zu tun haben, die vielleicht keines Anderen Not ist, und wir fürchten müssen, dass einer solchen, gleichsam nachgeborenen Philosophie niemand zuhören wird, weil die nötigen Organe dazu fehlen, da sie entweder bereits abgestorben oder noch nicht gewachsen sind, dürfen wir vor dieser Not, und sei sie, wie letztlich alle echte Philosophie, aus einer bloßen Idiosynkrasie heraus geboren, dennoch nicht kapitulieren. Wer das Naturprinzip Mensch in der übersteigerten Welt des postkulturellen Zeitalters verstehen will, muss noch geduldiger wühlen und noch tiefer graben als alle Wühler und Archäologen des Geistes zuvor. Folglich wird die Einsamkeit derjenigen, die ihr Leben einer solchen Aufgabe opfern, noch viel erdrückender und vollständiger sein als die der Einsamsten des 19. und 20. Jahrhunderts. Und eben das macht die Sache so schwierig und so wenig verlockend, weil das, was heute noch aus den Tiefen des – wie die allgemeine Ansicht lautet – doch bereits bis auf den Grund ausgeschöpften erfahrbaren Menschseins zutage gefördert werden könnte, bedeutungslos sein müsse, da es sonst längst schon gesagt worden wäre. Damit, so heißt es, erübrige sich alles weitere philosophische Forschen über diesen anscheinend allbekannten Gegenstand; und deshalb habe man sich an die ewige Wiederholung derjenigen ethischen Kenntnisse zu gewöhnen, über die wir in der Beurteilung unserer Art einig geworden sind: so lasse man also endlich davon ab, Fragen zu stellen, auf die es keine für uns als Gattung befriedigenden Antworten geben könne… Vielmehr glaubt jeder tatsächlich bereits für sich zu wissen, was der Mensch sei – oder hat gar kein tieferes Interesse an dieser Thematik.
Das große Erzählen. – Der Mensch will und muss sich in seinen eigenen Geschichten beheimaten, weil ihm außerhalb seiner Geschichten innerhalb der Natur keine Heimat zur Verfügung steht. Er muss sich das Haus selber bauen, in das er einziehen will, denn kein Instinkt verschafft ihm eine solche Unterkunft. – Deshalb wurden Menschen Mythologen und die Geschichten ihrer kulturellen Einrichtungen zu Mythologien. Denn die Welt war für den Menschen nie etwas anderes als die Bühne seiner Selbstdarstellungen: jeder erzählt seine Geschichte, und diejenigen Geschichten, welche die meisten Anhänger finden, weil sie die menschlichsten Geschichten sind, setzen sich durch. In allem, was irgendwo gesprochen wird oder geschrieben steht, erzählt der Mensch also seine ganz persönliche Geschichte – und ist sich zugleich der einzige Zuhörer. Über den Mythos erfand er sich lauter Formen eines Alter ego, um sich selber für seinesgleichen interessanter zu machen, also um eine auch metaphysische Balz aufführen zu können, und ferner, um sich mit unerreichbar »höherer« Gesellschaft zu umgeben, der man freudig dienen könne, ohne sich dabei als Knecht fühlen zu müssen. Gott war immer Ausdruck mangelnder Selbstgenügsamkeit sowie der Freude am Fabulieren und Phantasieren eines dichtenden Tieres. So besteht die Geschichte des Menschen buchstäblich aus den Geschichten der Menschen. Schöne und große Worte machen gehört bis heute zu den prominentesten Qualitäten des Menschseins. Und nachdem die großen Erzählungen als kanonisierte Orientierungsangebote ihr Verbindliches verloren haben, erzählt wieder jeder jedem seine eigene Geschichte. Das poetologische Vakuum, das nach den Kulturen entstanden ist, bietet allerhand Raum dazu. Die alten Autoritäten, von Homer bis zur Bibel, entfalten nach einer über zweitausend Jahre zählenden Herrschaftsgeschichte in Europa endlich nur noch museale Kräfte. Von nun an ist jeder aufgefordert, sich die Welt erneut selber zu erzählen, und sei es, dass er die Exegese des bereits Gesagten ins Unendliche vermehrt. Wo sich die strukturbildenden Versuche, allgemeingültige Mythen zu erschaffen, auf Dauer als unzureichend erwiesen haben, fällt der Mensch ins Beliebige seiner ganz persönlichen Erzählweisen und Bedürfnismitteilungen zurück. Die Welt scheint wieder offen zu liegen für die Deutungsvorschläge jedes einzelnen, der phantasiebegabt genug ist, sich daran zu beteiligen. Es beginnt ein neues Rennen um die menschlichsten Geschichten: wer weiß sich selber am wirksamsten und überzeugendsten zu erzählen, so dass ihm viele oder sogar die meisten zuhören…? Wer weiß am genauesten, was die Generationen freigesetzter Ich-Erzähler hören wollen…? Wer liefert die besten Schlüsselwörter, Zustandsbeschreibungen, Modemetaphern, um sich als großer Gegenwartsmythologe zu profilieren…? Lauter Fragen, deren Beantwortung erklären würde, warum die Flut des bereits Erzählten längst über die Ufer des Fassbaren und Sinnvollen getreten ist, ohne dass im Geistesland der Überschwemmten je der Katastrophennotstand ausgerufen worden wäre. »One day baby, we’ll be old / Oh baby, we’ll be old /And think of all the stories that we could have told.«2 – Also lautet der Wunsch des letzten Perfektionisten: die eine Geschichte erzählen, die alles enthält!
Isoliert. – Jeder Mensch ist sich selber ein einziger in sich geschlossener Mythos. Und folglich ist er es auch allen anderen. Die Welt stellt sich ihm dar als eine große, alles Mögliche umfassende Erzählung, worin seine Individualität gar nicht vorkommt, weshalb er sich in das große Weltgedicht erst selber hineinerzählen muss – und die Fabeln seiner Schöpfung gleich mit. Aus diesem Grunde gelingt es kaum, jemals wieder hinter das Erzählte, das die Welt für uns abbildet, zurückzusteigen. Durch die Fähigkeit, ja durch den Willen zur Mythologie wurde der Mensch zugleich das Produkt seiner Mythen; eine Verbindung, die sich immer fester knüpfte, je mehr der Mensch in seinen Geschichten vom Menschen aufging. Denn das Erzählen der Welt fängt die Welt nicht ein, sondern bildet sie nur ab – und sieht ihr hinterher.
Wiederkehr im Unterschied. – Gibt es mit jeder neuen Generation auch wirklich neue Menschen? Oder verändert sich nicht bloß das Verhalten aufgrund veränderter Anforderungen? Der frühe Zweifel an der tatsächlichen Verschiedenheit menschlicher Einzelwesen hat vermutlich zum Glauben an Seelenwanderung geführt. Denn zu allen Zeiten reagierte das menschliche Verhalten auf die Erwartungen seiner Umgebung, spiegelte diese quasi in sich wider, um seiner Zeit ein guter Zeuge zu sein. Somit birgt die Wiederkehr des Gleichen im Unterschied vielleicht das Geheimnis der Vorstellung menschlicher Vielfalt. Was lebt oder stirbt mit einem Menschen, wenn nicht die Wiederholung in Variationen desjenigen evolutionären Musters, das die Gattung kennzeichnet und charakterisiert? Was sind die Vorgänger den Nachfahren? Was also unterscheidet im Wesentlichen die sogenannten Individuen einer Generation von denen einer anderen? – Das sogenannte Individuum ist eine Regung, Empfindung, Seins-Form, die das Vergängliche ihres Trägers begreift, ohne nach dem Tod des einzelnen Mediums als solche aus der Welt zu sein. Die Äußerung findet auch anderswo noch statt, doch das Stoffliche betrauert sein eigenes Vergehen, weil es sich im Menschen nicht als bloßes Medium versteht, sondern seine Lage in der Welt erkennt, wodurch es »mehr« wird als das, was es rein natürlich darstellt. Folglich gibt es keine Individualität, sondern nur Ausdrucksformen bestimmter Typen; jeder gehört einem dieser menschlich möglichen Modelle an, als dessen Vertreter und Darsteller er am Leben ist. Innerhalb dieses Typus mag zwar jeder bis zu einem gewissen Grad individuelle Züge ausbilden, doch reichen diese niemals so weit, dass man als Angehöriger seines Typus nicht mehr zu erkennen wäre. Man selber verkörpert einen einzelnen Menschen, nämlich sich selbst – alle anderen aber verkörpern die Menschheit. So lebt der Mensch im Schatten seiner Beginnlosigkeit, ohne Anfang, denn alles war, bei genauerer Betrachtung, immer schon da, weshalb er sich so gerne Ursprünge setzt, grundlegend »verändern« will, was doch nur abgewandelt werden kann. Jede Geburt ist ein Betrugsversuch am Leben, den erst der Tod wieder bereinigt.
Kulturelle Vortäuschung von Individualität. – Gäbe es ein rein persönliches Ich, müsste dieses mit seinem Inhaber vollkommen identisch sein. Doch wandeln sich die Urteile über unser Verhalten in uns, und stimmen unsere Handlungen mit unserem Denken oft nicht überein. – Daraus erwächst der Zweifel an der Möglichkeit individuellen Seins und entsteht die bedeutendste aller Fragen: wo wäre ich, wenn es mich nicht gäbe? Wie kann ich das Produkt nur einer einzig möglichen Verbindung sein? Wer wäre statt meiner als ein anderes Ich entstanden, wenn die Umstände meiner Zeugung andere gewesen wären? Lebt der Mensch, oder »menscht« das Leben? Was also macht mich zum Ich, das es unter Milliarden anderer Iche nur ein einziges Mal in Zeit und Raum zu geben scheint? Was passiert in mir, sobald sich die Fähigkeit in mir entwickelt, mich für ein Ich zu halten? Eine Fähigkeit, die aus der Begabung zum Denken entspringt, mithin also eine Qualität des Lebens darstellt, die gar nicht hätte entstehen müssen, da alle anderen Lebewesen auch ohne ein Ich-Bewusstsein auskommen. – Die Frage, welche Stellung das Ich innerhalb aller Lebensformen einnimmt, lässt daher sämtliche anderen Fragen nichtig erscheinen. Die Menschheitsgeschichte als Ganzes gibt Aufschluss über die vielen, aber allesamt zu kurz greifenden Versuche, diese Frage innerhalb des eigenen Programms zu verarbeiten – nicht jedoch darüber, sie wahrhaftig und umfassend zu beantworten. Kulturgeschichte ist Willensgeschichte, insofern sie den Grad der Durchsetzungsbereischaft von Überlebenseinheiten aufzeigt.
Wohin trägst du dein Ich? – In der entgrenzten Welt bildet jeder sein eigenes Ordnungssystem. Deshalb macht sie insofern asozial, als jeder in sich verschlossen bleibt, je mehr sich die Wertmaßstäbe um ihn herum relativieren. Die Welt wird dein »Eigentum«, wo es keine klaren Besitzverhältnisse mehr gibt: jedem gehört alles, wo sich die Welt zum bloßen Lebensraum und Wirtschaftsstandort aller erklärt. Das allgemeine Ich und die allgemeine Welt bilden dann die einzige verbliebene Beziehung und sinngebende Verbindung. – Denn kein Wille, kein Gefühl, kein Gedanke gehört je einem einzigen Exemplar alleine oder ist von diesem aus eigener Kraft und Freiheit erzeugt worden. Sogar der scharfsinnigste Gedanke ist der Ausdruck einer menschlich-physischen Regung, kaum anders als ein Schmerz oder Schrei, und gehört demnach niemals dem Einzelnen, der ihn hervorbrachte, sondern der gesamten Gattung, sogar den Toten. Denn woher hätte er ihn genommen haben oder gewinnen können, wenn nicht aus dem Reservoir des überhaupt Denkbaren, das alle bisherigen Menschen unsortiert zusammentrugen, und woraus jeder auf seine Weise schöpft, der denkt, fühlt und will. – Daraus ergibt sich, dass kein Mensch einen vollen Anspruch auf sich selber hat, da er stets nur mit-will, mit-fühlt, mit-denkt.
Körperwechsel. – Alles Leben enthält den Auftrag, die Welt zu verarbeiten. Daraus ergeben sich die verschiedenen Formen und der Anschein von Individualität. Dennoch haben wir es überall mit Äußerungen des Lebens selber zu tun, das über die Verarbeitung der Welt seinen eigenen Ausdruck erhält. Allein die Konstitution eines Organismus entscheidet darüber, wie die Welt wahrgenommen wird. Denn der Aufbau der Welt bleibt für alle Wahrnehmungsformen im Wesentlichen gleich, weshalb das Reagieren darauf bloß die Körper wechselt. Und doch setzt jeder spezifische Akzente, worin sich seine Eigenart verrät.
Nahrhaft. – Am Leben sein heißt, die Welt in sich aufzunehmen, ihre jeweiligen Ausdrucksformen zu registrieren, um darüber zu erfahren, was das Leben von mir verlangt. Die Welt ist das, was zur Nachahmung bereitliegt, um von uns zu Lebensmaterial verarbeitet zu werden. Der große Nahrungslieferant, der uns nicht nach unserem Geschmack fragt, sondern voraussetzt, dass wir mögen, was er bietet. – Und siehe: tatsächlich entspricht unser Geschmack dem Geschmack der Welt. Denn allein Homo sapiens hat Geschmack am Essen gefunden; alle anderen Lebewesen betreiben bloß Nährstoffverwertung, denn die Welt ist ihrem Aufbau nach ein großer Stoffwechselvorgang, ein Verschlingen und Verarbeiten des jeweils anderen, wodurch aber alles im anderen zu dessen Nährwertigkeit beiträgt, so dass nichts Stoffliches je gänzlich verlorengeht. – Diese Beobachtung hat bereits die Alten fasziniert und zum Trost verholfen, indem sie ihr ἓν ϰαὶ πᾶν vor sich her sprachen, so als würde die Welt dadurch genießbarer werden.
Re-Aktion. – Besteht doch alles Lebendige aus lauter Stoff-Wechsel-Erzeugnissen: die Stoffe der Welt (das Seiende) sind dadurch, dass sie aufeinander reagieren, einem ständigen Stoff-Wechsel unterworfen. Auch der sogenannte Geist, das Denken, ist Ausdruck eines solchen Stoff-Wechsels: etwas (ein Ereignis) wird in etwas anderes (ein Erlebnis) umgewandelt, indem eine Reaktion darauf erfolgt. Denn das, was in der Welt ist, setzt sich seiner Art und Zugehörigkeit nach stets neu zusammen, solange die jeweiligen Spezies bestehen, die dazu in der Lage sind.
Geschmacksurteil. – Wo uns etwas gefällt oder überzeugt, werden bestimmte Erfahrungen beziehungsweise Erlebnisse in uns angesprochen, deren positive Wirkung vor allem daher rührt, dass sie mit unserem präfigurierten Erkenntnismuster übereinstimmen. Dieses hat sich in unserer persönlichen Historie gebildet, welche in Analogie zur äußeren Geschichte entsteht: aus der Wechselwirkung zwischen Naturtrieb und Ereignis, woraus alles Werden seine Kraft bezieht. Wenn jemand sagt: das gefällt mir, ist damit jene Übereinstimmung zwischen Naturbedürfnis und Naturereignis ausgesprochen, die allem Leben zugrunde liegt. Was uns gefällt, das haben wir schon einmal als angenehm erlebt, es wohnt als Erinnerung oder Präexistenz in uns und verlangt danach, wiederholt zu werden. So kommt es, dass wir Bekanntem und Verwandtem zustimmen, Fremdes aber ablehnen, selbst dann, wenn Letzteres objektiv wahrhaftiger sein sollte. Wohlfühlen gehorcht keiner Logik, sondern allein dem uns Vertrauten durch Erfahrung. Dadurch, dass wir uns von etwas angezogen fühlen, helfen wir zu dessen Verbreitung. Es vermehrt sich das, was am meisten Anziehung auslöst – und sorgt wiederum für die Reproduktion desselben: so schafft sich der Mensch die »menschlichste« Welt. Deshalb also gleichen sich die Philosophien und Meinungen und Geschmäcker eines Zeitalters oder Kulturkreises so sehr und haben andere keine Chance, anerkannt, ja nicht einmal angehört zu werden. Wir verstehen und loben, was uns gefällt, weil es in unserer Weise zu uns spricht. Hier verlaufen die Grenzen unserer Freiheit zum objektiven Urteilen. Was wir sind, werden wir durch andere, die uns in uns selber bestätigen. Deshalb kann nicht jeder zu allen Zeiten alles werden, sondern nur darin reüssieren, was in ihm mit den herrschenden Strömungen seiner Zeit konform geht. – Und tatsächlich richtet sich unser Gefallen zumeist genau darauf, weil es sich bereits aus den frühesten Erfahrungen gebildet hat. Unsere Geschmäcker basieren also keineswegs auf objektiver Urteilskraft, sondern sind das Ergebnis unserer persönlichen Historie.
Geschmacksorientiert. – Ist doch der Mensch seinem allgemeinen Wesen nach ein Oberflächenbegeher, den es immer wieder an den Saum der Dinge zurückzieht; nicht hinauf und nicht herab zu den Tatsachen, die den Dingen zugrunde liegen, sondern stets hinein in den engen Zirkel des unmittelbaren Geschehens. Von hier aus blickt er auf die Welt, kriecht über sie hinweg, wie ein Kurzsichtiger, ganz nah am Boden, wo die vielen Meinungen wachsen, nahrhaften Pilzen gleich, von denen er jene zu sich nimmt, nach denen die eigene Biologie verlangt. Denn aus dieser natürlichen Verwandtschaft bilden sich seine Geschmäcker, und es war ein feinsinniger Akt sicherster Instinkte, die Gattung durch das Attribut sapiens zu charakterisieren. Der Mensch erkennt, was ihm schmeckt! Und vielleicht ist es gar nicht einmal zu weit gegriffen, den gesamten Vorgang des Denkens, Fühlens und Wollens als einen großen Verdauungsprozess jener Nahrung zu bezeichnen, welche die Natur des Menschen ihm zuführt. Doch von welcher Natur jemand ist, hat sich niemand je aussuchen können. Darin liegt das Schicksal eines jeden begründet. Und es hat sich in den ungeheuer langen Zeiträumen ziellosen Experimentierens für den Menschen als vorteilhaft erwiesen, schmeckend an der Oberfläche zu bleiben.
Schaffenseitelkeit. – Die meisten »großen Geister« und noch größeren Geschichtenerzähler, besonders die des späten 20. Jahrhunderts, waren vor allem und stets damit beschäftigt, ihre Gelehrsamkeit in Form zu bringen. Das heißt freilich schon viel und bleibt beeindrukkend. – Was aber hatten und haben sie uns darüber hinaus noch zu sagen? Es scheint, als arbeiteten sie allein um ihrer selbst willen, weil sie Vergnügen daran fanden, die Welt zu bedenken und dieser ihre Gedanken mitzuteilen. Sucht man in der deutschen Geistesgeschichte der letzten siebzig Jahre dagegen nach dem wirklich Besonderen, das unerlässlich erscheint, wird man nur sehr wenige Autoren finden, deren Werk einer solchen Forderung standhält. Alle anderen aber hinterließen uns bloß Zeugnisse ihrer Schaffenseitelkeit, die durchaus interessant und unterhaltsam zu lesen sein mögen, der Notwendigkeit ihres Entstehens jedoch entbehren.
Die Summe ihrer Teile. – Wenn das Evolutionsprodukt Menschheit das Abbild der Entwicklung von Anlagen ist, die unter verschiedenen Bedingungen verschiedene Formen hervorbrachten, erklärt dies die Entstehung ähnlicher oder sogar gleicher Seinsund Verhaltensweisen und menschlicher Erfindungen wie »Seele«, »Gott«, »Unsterblichkeitsglaube« etc. unabhängig voneinander und verweist zugleich auf das natürliche Zusammenfließen all dieser Phänomene aus verschiedenen Quellen zu einem sich als Ganzes erkennenden Organismus, dem wiederum das Schicksal seiner biologischen Programme beschieden ist. Der Einzelne fungiert dabei als Zellkörper dieses Gesamten, das sich nur über seine Gattungseigenschaften begreifen lässt, als mankind oder humankind. Diese Entwicklung trägt ihre Erbinformationen und Ausrichtungen bereits in sich wie das Genom der einzelnen Exemplare, durch die sie verkörpert wird.
Technische Verhältnisse. – In der geistesgeschichtlichen Situation postkultureller Zustände kommt es nur noch darauf an, den Menschen seiner biologischen Art nach verstehen zu lernen, um in Begleitung solcher Erkenntnisse auf das soziotypische Verhalten Einzelner und ganzer Gesellschaften schließen zu können. Wem es nicht genügt, sich bloß in Beschreibungen des Vergangenen und Gegenwärtigen zu ergehen, muss den Menschen als Abstraktionsobjekt mit dem gebührenden Abstand zu sich selber ins Zentrum all seiner Beobachtungen und Überlegungen rücken. Anders ist es gar nicht möglich, wirklich zu begreifen, wie und warum sich geschichtliche Wandlungen vollziehen und welche Rolle der spezifischen Natur des Allgemeinmenschlichen dabei zufällt. Denn die Natur der Dinge kann nichts hervorbringen, was nicht in ihr selber angelegt wäre. Alle menschlichen Handlungen sind Ausdruck von Reaktionen auf Erfahrungen innerhalb dieser Natur: sie generieren dasjenige Programm, das sich durch Reproduktions- und Kopiervorgänge stofflich in uns ergeben hat. Natur bringt sich über die Dinge, die sie erzeugt, immer nur selber zum Ausdruck. Das nennen wir Technik: die Verfahrensweise, wie etwas auf etwas anderes reagiert und dadurch weiteres erzeugt. Die »technischen Verhältnisse«, über die alle Exemplare seit jeher miteinander in Verbindung stehen, zeigen sich heute besonders deutlich im Gebrauch jener Technologien, die ohne eine solche Anlage dazu gar nicht hätten hergestellt werden oder Verwendung finden können.
Evolutionsbiologie. – Die heute erreichte Dynamik einer sich von nun an potenzierenden Zukunft ist etwas, womit der Mensch bislang noch keine Erfahrungen machen konnte, weshalb wir so schwer begreifen, was derzeit mit der Welt geschieht. Diese Dynamik hat den Menschen um seine historischen Visionen gebracht, doch die Qualität der Entwicklung verhindert, diesen Verlust überhaupt zu bemerken, weil an die Stelle der alten Visionen tausend Innovationen getreten sind, die jeden in Bewegung halten. Diese neue Form der Zukunft, die uns alle erfasst, ist erstmals eine in sich geschlossene, weil sie in noch nie dagewesener Weise auf den bereits erreichten Zustand folgt. Denn von jetzt an gestaltet sich das schon Vorhandene selber, ohne dass der Mensch noch die Möglichkeit zum Richtungswechsel, geschweige denn zur Umkehr hätte: es geschieht einfach mit uns, während wir meinen, das Geschehen zu steuern oder wir uns wenigstens das Recht auf Unvorhersehbarkeit in der Geschichte vorbehalten. Wir meinen, uns den Ereignissen gegenüber selbständig zu verhalten, obwohl unser Verhalten zumeist längst Teil des Geschehens geworden ist, das mit uns passiert, weil sich beides gar nicht mehr voneinander trennen lässt. Nur bemerken wir vor lauter Veränderungseuphorie unsere Situation nicht, zum ersten Mal in der Weltgeschichte als Mensch kein historisches Subjekt mehr zu sein, das sich noch entscheiden könnte, wohin es wolle. – Aber gerade darin erkennen nicht wenige das große Glück, worauf der gesamtmenschliche Wille doch immer hinauslief: endlich nicht mehr selber vor die Wahl gestellt zu sein, was der Mensch sein solle, sondern wieder ganz Ding der Natur zu werden, um endlich in der Illusion moderner Pseudo-Freiheit unbegrenzter Entfaltungsmöglichkeiten digitaler Vernetzung heimzukehren wie einst in die bergenden Arme der Allmacht Gottes. Deshalb ist es unmöglich und geschieht es auch nicht, dass ganze Verbände sich gegen die Triebkräfte jener Dynamik, gegen die technischen Innovationen entscheiden und sagen: wir wollen die Digitalisierung des Lebens nicht! – Und eben daran, an dieser Unfreiheit, als Gattung fundamentale Entscheidungen auch gegen die Dynamik der eigenen Natur zu treffen, kann man ablesen, was Evolution ist. Hüten wir uns also mit allen Mitteln vor dem Erwachen aus der großen, bunten Truman-Show, deren Spielleiter keine bösen Mächte sind, sondern die Funktionen unserer Evolutionsbiologie!
Echo der Gattungseigenschaften. – Der sogenannte menschliche Geist ist wegen seiner Besonderheit, seiner Fähigkeiten, die in ihm selber liegen und als Grundlage fast aller anderen, praktischen Fähigkeiten des Menschen erkannt wurden, seit jeher deutlich überschätzt worden. Deshalb hat man ihn nie zum Organischen gerechnet, nie mit den Funktionen anderer Organe verglichen, ihn aus Faszination vor sich selber gleichsam heiliggesprochen. Dabei ist das menschliche Verhalten viel mehr Ausdruck seiner Biologie, seines Überlebensinstinktes, als seiner Fähigkeit zum »reinen Denken«. Mag der Mensch als organischer Apparat auch noch so kompliziert aufgebaut sein, als Gattungsexemplar, das seiner Natur untersteht, ist er ebenso leicht zu »berechnen« wie jedes andere Tier. – Dies verinnerlicht, ließe sich beobachten, wie man vom Funktionsträger biologischer Befehle zum »reinen Bewusstsein« gelangen kann durch Verlust der Gattungseigenschaften! Also kein Bedürfnis mehr zu haben nach dem bloß Menschlichen, das aber als schöne Erinnerung immer noch nachwirkt.
Sexus sive Kultus. – Frauen sind zumeist ganz von sich aus weiblich; Männer hingegen müssen ihre Männlichkeit stets erst unter Beweis stellen: allein ihr männliches Verhalten macht sie zu Männern. Dieser Druck, einer Erwartung zu genügen, dem Männer ganz anders ausgesetzt sind als Frauen, begann bereits bei den Naturvölkern und hat sich seitdem über alle Generationen und Weltgegenden vererbt. Daraus erwuchsen schwerwiegende Folgen für die unterschiedlichen Selbstausrichtungen der Geschlechter, die bis in die Tiefenschichten sexueller Veranlagung reichen. Wo ein Mädchen schlechte Erfahrungen mit Männern macht, vielleicht misshandelt oder gar missbraucht wird, kann ein solches Erleiden in die Homosexualität treiben, sofern eine Disposition dafür besteht. Fortan sucht es sein Bedürfnis nach Liebe in den eigenen Reihen zu stillen, weil es sich vom anderen Geschlecht abgestoßen fühlt. Wird dagegen ein Junge von Frauen seelisch oder körperlich misshandelt, tritt ein solcher Effekt kaum ein. Der Betroffene wird sich daraufhin nicht von Frauen abwenden und sein Verlangen nach Zuneigung bei Männern zu befriedigen suchen. Denn seine Männlichkeit ist durch die böse Erfahrung mit Frauen nicht verletzt worden. Wird dagegen ein schwacher, eher unmännlicher Junge von einem starken, dominanten Vater dahingegen gekränkt, dass dieser ihm seine fehlende Männlichkeit vorwirft, kann das zu einer Verachtung des Weiblichen im Jungen führen, die ihn wiederum auch sinnlich oder gar sexuell zu Männern hingezogen sein lässt, da er dort findet, was ihm selber ermangelt. Wer gerne ein »echter Mann« wäre, aber zu wenig Männliches in sich vorfindet, neigt zur Verherrlichung des Männlichen und verachtet im Gegenzug alles Weibliche, weil es ihn permanent an seine »Schande« erinnert, selber viel mehr Weib als Mann zu sein. – Hier haben wir es mit dem Phänomen einer Verachtung des Eigenen zu tun, das geeignet wäre, seine Spuren im kollektiven Bewusstsein ganzer Kulturen zu hinterlassen.
Kultus sive Sexus. – Als der Physiker Albert Einstein 1914 auf die hohe Bereitschaft, ja Begeisterung blickte, mit der die meisten jungen Männer Europas in den Krieg zogen, sah er darin das Verlangen, sich gegenseitig seine Potenz zu beweisen. Eine These, die bekanntlich auch der Psychologe Sigmund Freud vertrat. Tatsächlich sind die Ursachen für den sogenannten Militarismus Europas und vielleicht besonders der des jungen Deutschen Reiches auch in diesem Bedürfnis nach demonstrativer Männlichkeit zu suchen: eine Nation, die sich zu lange von ihrem mächtigen Nachbarn hatte demütigen lassen müssen, und die nur deshalb gedemütigt werden konnte, weil sie zu schwach, zu wenig männlich gewesen war, beginnt nun das »Weiche« und »Weibliche«, das Geistig-Lyrische in sich zu verachten; also gerade diejenige Eigenschaft, worin bisher ihre einzige Stärke zu liegen schien. Man will von einer Dichternation zu einer Kriegernation werden. Hier lässt sich tatsächlich eine Linie verfolgen, die vom Preußenkönig Friedrich II. bis hin zum Nationalsozialismus führt: der weiche, musische, philosophische König, der die blutigsten Kriege entfachte, während sich sein Vater, der Soldatenkönig, mit der bloßen Präsenz des Militärs und der Freude an Paraden begnügte, bis hin zu der Partei demonstrativer Härte und Geistesverachtung, die mit dem Versprechen antrat, die Dinge wieder ins »Biologisch-Natürliche« zurechtzurücken, Jungen wieder zu echten Männern und Mädchen wieder zu echten Frauen zu machen, nachdem im Zuge der Kultur-Moderne die vermeintliche Ordnung der Dinge samt der damit verknüpften alten Erwartungen durcheinander geraten war.
Frauen, männlich betrachtet. – Das Denken, Fühlen und Wollen der meisten Frauen bleibt viel zu oft in der kleinsten geistigen Problemeinheit hängen: der zwischen Ich und Du. Infolgedessen fehlt ihnen bald jeder tiefere Sinn für das Ungeheuerliche der Welt. Warum aber reicht die Wahrnehmung von Frauen, bei allem Gefühl, das sie für die Dinge aufzubringen fähig sind, zumeist kaum über sich selber hinaus? Warum interessiert sie alles Persönliche in höherem Maße, nicht aber das Darüberhinausgehende? Wie Flechten kleben Frauen an der Erde ihrer Empfindungen, die alles Verwandte in sich schließt, alles Nahe und Direkte, aber für Großes und Gewaltiges, für Überpersönliches nur wenig Bereitschaft parat hält, weshalb das Leben so vieler Frauen ein einziges und nie enden wollendes Beziehungsproblem darstellt. Jeder Mensch bewohnt ganz eigene, verschiedenartige Räume, doch erweisen sich die weiblichen als besonders eng und dunkel, worin sich die Frau immer wieder auf die eigenen Füße tritt – und daraus ihre erhöhte Empathie und Schmerzempfindlichkeit zu schöpfen scheint, ohne jedoch jemals die Weiten männlicher Welten auch nur zu erahnen. Wer solche Beobachtungen für das Resultat maskuliner Voreingenommenheit hält, vergleiche nur die geistigen Erzeugnisse beider Geschlechter miteinander. Und je offenkundiger jene mentale Verschiedenheit im 20. Jahrhundert zutage trat, nachdem sich niemand mehr hinter der Behauptung patriarchalischer Unterdrückung verstecken konnte, desto vehementer bestritten die Weiblein beiderlei Geschlechts das Faktum natürlicher Diversität und führten umso radikaler ihren Feldzug gegen die eigene Art. Seitdem gönnt niemand mehr dem anderen dessen häufig hormonell oder geschlechtlich bedingte Qualitäten, sondern will nur noch sein, was er nicht ist und erzwingt mit aller Gewalt das zu praktizierende Recht auf Unterschiedslosigkeit. – Die Schäden dieser Verblendung haben die extra zu diesem Zweck herbeigezüchteten Heerscharen von Therapeuten in Dauerbehandlung ihrer Ich-weiß-nicht-was-ich-will-Patienten aller möglichen Geschlechter zu beheben.