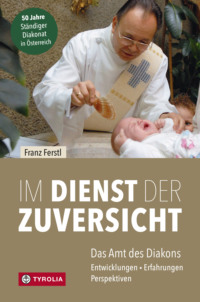Kitabı oku: «Im Dienst der Zuversicht», sayfa 3
Stephan II. und Paul I.
Zwei Diakone aus dem frühen Mittelalter sind eher durch ihr Wirken als Päpste bekannt. „Einer der bedeutendsten Päpste, der als Diakon in das höchste Kirchenamt gewählt wurde, war Stephan II. (752–757). Wie sein Bruder und Nachfolger Paul I. (757–767) stammte er aus einer stadtrömischen Adelsfamilie. Beide wurden früh Waisen, daher im Lateran erzogen und erhielten die Diakonenweihe von Papst Zacharias (741–752). Das Pontifikat Stephans II. erlangte weltgeschichtliche Bedeutung infolge des päpstlichen Hilferufes an den fränkischen König Pippin III. gegen die Langobarden: In der ‚Pippinischen Schenkung‘ wurden Rom und weitere Gebiete dem hl. Petrus übertragen, was letztlich die Grundlage für den Kirchenstaat bildete.“19
1.5 Franz von Assisi – gelebtes Armutsideal
Auf Franziskus als Diakon finden sich Hinweise in künstlerischen Darstellungen. So wird Franziskus in der Sakristei von Sant’Angelo, einer der franziskanischen Klosterkirchen in Mailand, in einem in der Zeit des Barock geschaffenen Deckenfresko bereits mit Albe, Zingulum und Diakonenstola gewandet dargestellt, ein Engel überreicht ihm eine Dalmatik.
Franziskus lebte bewusst ein Armutsideal. Es ging ihm nicht um ein Amt, er war in seinem Herzen Diakon. Die Priesterweihe, für die er sich nicht würdig hielt, lehnte er ab, um sich so auf besondere Weise mit Christus, dem dienenden Gottesknecht, zu vereinen. „Er hatte eine tiefe Reflexion des Diakonats, die ihn dazu führte, eben diesen Weihegrad – und keinen anderen – anzustreben und in ihm zu bleiben.“ Den Diakonat verstand er nicht bloß als liturgischen Dienst, sondern umfassender: Er wollte als Diakon Gottes und der Menschen sakramentaler Repräsentant des dienenden Herrn sein.20 „Gerade weil Franziskus in seinen Briefen und Regeln immer wieder das Dienen betont, die Karriere nach unten statt nach oben, das Verweilen bei den Armen und Bettlern am Weg, steht bei ihm nicht das Amt im Vordergrund, sondern der Dienst, nicht das Diakonat, sondern die Diakonie. Sein ganzes Leben ist ein Beispiel ‚pro Diakonia Christi‘.“21 Das Leben und Wirken des Diakons Franziskus zeigt, wie in der Berufung zur Nachfolge und zur liebenden Sorge um die Armen eine versiegte Quelle wieder neu fruchtbar werden kann.
1.6 Von Franz von Assisi bis zum Zweiten Vatikanum
In der Zeit zwischen dem frühen 13. Jahrhundert und der Mitte des 20. Jahrhunderts, zwischen der herausragenden diakonischen Gestalt des Franz von Assisi und der Wiederentdeckung und Neuentfaltung des Diakonats durch das Zweite Vatikanum, scheint der Diakonat zu einer Vorstufe zum Priestertum verkümmert zu sein. Fast hat die Kirche einen jahrhundertelangen Weg ohne ein eigenes Diakonenamt zurückgelegt. Jedoch hat die Diakonie der Kirche niemals zu existieren aufgehört. In der Zeit des Niederganges des Diakonats traten immer wieder neue Gruppen von Hilfsbedürftigen und auch neue Formen der Diakonie auf. So wurden die Dienste an den Armen von Laien, Priestern und den entstehenden Ordensgemeinschaften wahrgenommen. Die neuen Orden und Klöster nahmen die Armen in ihre Gemeinschaft auf und gaben so eine Antwort auf die Not der Zeit. Für die Zeit bis zum 20. Jahrhundert kann festgestellt werden: Schon das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert unternahm einen ersten Versuch, den Diakonat zu erneuern und ihm seine ursprüngliche Gestalt zurückzugeben, aber leider blieb es bei diesem Versuch. Die angedachte Reform konnte in den politischen und kirchlichen Auseinandersetzungen der Reformationszeit nicht verwirklicht werden. „Noch einmal 300 Jahre mussten überbrückt werden, bis die Wiedererweckung des frühkirchlichen Amtes des Diakons als eigene Stufe im 19. Jahrhundert wieder aufkeimte.“22
1.7 Neuentfaltung des Diakonats durch das Zweite Vatikanum
Einer der Gründe für die Einführung des Ständigen Diakonats als sakramentales Amt war sicher die Tatsache, dass Diakonie in der Kirche faktisch schon immer präsent war, wenn sie auch ohne Weihe durch Laien ausgeübt wurde. Karl Rahner und Herbert Vorgrimler betonen diesbezüglich: „Es soll also nicht ein nicht bestehendes Amt eingeführt werden, sondern es soll die sakramentale Amtsverleihung dieses im Grunde schon anonym bestehenden Amtes erneuert werden.“23
Die beim Konzil versammelte Gemeinschaft der Bischöfe erkannte ihren Auftrag, als Kirche in die Welt zu gehen und dort die Heilstaten Gottes neu zu verkünden. Die Sicherheit der „Festung Kirche“ sollte zugunsten der Sendung zu den Menschen hintangestellt werden. Die Menschen sollten in ihrer Lebenswelt aufgesucht und mit der Botschaft von der Liebe Gottes neu konfrontiert werden. Nicht mehr einzelne Missionare sollten in „Heidenländer“ aufbrechen und sie missionieren, jeder Christ sollte seine Sendung ernst nehmen und zu einem Gesandten Gottes werden. Als „Welt-Kirche“ im doppelten Sinn – einerseits, weil die Botschaft bereits bis an die Enden der Welt verkündet wurde, und andererseits als Kirche, die bewusst in der Welt ihren Dienst sieht – erkannte sie ihre Sendung neu. Getrieben durch den Heiligen Geist sollte die Herausforderung der Zeit aufgegriffen werden. Die Kirche wollte sich als Heilszeichen der Erlösung in der Gegenwart, mitten in der Welt, verstehen.
Im Konzil wurde das Kirchen- und Amtsverständnis erneuert, der „alten Institution des Diakonats Inhalt und Leben zurückgegeben“. Es ging also um eine schöpferische Neukonzeption des Diakonats der Zukunft, die mehr war als eine Wiederherstellung des alten Diakonats.24
Eine von Papst Johannes XXIII. am 5. Juni 1960 einberufene Vorbereitungskommission über die Verwaltung der Sakramente erarbeitete Vorschläge zur Erneuerung des Ständigen Diakonates. Eine Zentralkommission unter der Leitung des Papstes sollte dann über die endgültige Vorlage an das Konzil entscheiden.
In der dritten Sitzungsperiode im Herbst 1964 wurde die grundsätzliche Erneuerung des Diakonats angenommen. Stärkere Differenzen zeigten sich noch in der anschließenden Diskussion über die Frage der Zuständigkeit für die Erneuerung des Diakonates und über die Frage, ob man den Diakonat nur verheirateten Männern „reiferen Alters“ anvertrauen dürfte. Als Zugeständnis an die Konzilspartei, die um den Priesterzölibat fürchtete, wurde für Männer, die Diakone werden wollen, das „reifere Alter“ als Aufnahmebedingung festgelegt.
Die Erneuerung des Dienstes des Ständigen Diakonats wurde somit als Artikel 29 im Rahmen der Kirchenkonstitution „Lumen gentium“ in der Plenarsitzung des Konzils am 21. November 1964 beschlossen und vom Papst promulgiert. In der Folgezeit kam es dank der Förderung durch Papst Paul VI. zur Bildung einer kleinen Kommission, die allgemeine Normen als Rahmengesetz für den Ständigen Diakonat entwerfen sollte.
In der Kirchenkonstitution „Lumen gentium“ und im Dekret „Ad gentes“ wird der Diakonat als Dienst beschrieben, der dem inneren Aufbau des Volkes Gottes dient.
„In der Hierarchie eine Stufe tiefer stehen die Diakone, welche die Handauflegung ‚nicht zum Priestertum, sondern zur Dienstleistung empfangen‘. Mit sakramentaler Gnade gestärkt, dienen sie dem Volke Gottes in der Diakonie der Liturgie, des Wortes und der Liebestätigkeit in Gemeinschaft mit dem Bischof und seinem Presbyterium. Sache des Diakons ist es, je nach Weisung der zuständigen Autorität, feierlich die Taufe zu spenden, die Eucharistie zu verwahren und auszuteilen, der Eheschließung im Namen der Kirche zu assistieren und sie zu segnen, die Wegzehrung den Sterbenden zu überbringen, vor den Gläubigen die Heilige Schrift zu lesen, das Volk zu lehren und zu ermahnen, dem Gottesdienst und dem Gebet der Gläubigen vorzustehen, Sakramentalien zu spenden und den Beerdigungsritus zu leiten. (…) Weil diese für die Kirche in höchstem Maße lebensnotwendigen Ämter bei der gegenwärtig geltenden Disziplin der lateinischen Kirche in zahlreichen Gebieten nur schwer ausgeübt werden können, kann in Zukunft der Diakonat als eigene und beständige hierarchische Stufe wiederhergestellt werden. Den zuständigen verschiedenartigen territorialen Bischofskonferenzen kommt mit Billigung des Papstes die Entscheidung zu, ob und wo es für die Seelsorge angebracht ist, derartige Diakone zu bestellen. Mit Zustimmung des Bischofs von Rom wird dieser Diakonat auch verheirateten Männern reiferen Alters erteilt werden können, ferner geeigneten jungen Männern, für die jedoch das Gesetz des Zölibats in Kraft bleiben muss.“25
Hiermit werden die spezifischen Aufgaben des Diakons in Abgrenzung zum Priester festgelegt. Die Entscheidung über die Zulassung liegt beim Ortsbischof. Der Diakonat wird für „verheiratete Männer reiferen Alters“ geöffnet, für die „geeigneten jungen Männer“ gilt jedoch weiterhin die Zölibatsverpflichtung.
„Wo die Bischofskonferenzen es für gut halten, soll der Diakonat als fester Lebensstand wieder eingeführt werden, entsprechend den Normen der Konstitution über die Kirche; denn es ist angebracht, dass Männer, die tatsächlich einen diakonalen Dienst ausüben, sei es als Katechisten in der Verkündigung des Gotteswortes, sei es in der Leitung abgelegener christlicher Gemeinden im Namen des Pfarrers und des Bischofs, sei es in der Ausübung sozialer oder caritativer Werke, durch die von den Aposteln her überlieferte Handauflegung gestärkt und dem Altare enger verbunden werden, damit sie ihren Dienst mit Hilfe der sakramentalen Diakonatsgnade wirksamer erfüllen können.“26
Wer also bereits als Katechist im Dienst der Verkündigung, als Leiter einer christlichen Gemeinde oder in sozialen oder karitativen Werken tätig ist, also einen tatsächlich diakonalen Dienst ausübt, soll durch die Weihegnade gestärkt werden und seinen Dienst in enger Verbindung mit dem Altar wirksamer ausüben können.
Der Anstoß zur Wiedereinführung des Ständigen Diakonats kam vor und während des Konzils aus ganz verschiedenen Richtungen: Zahlreiche Bischöfe aus den Missionsgebieten erblickten darin eine Chance, dem Priestermangel in ihren Ortskirchen durch die Weihe bewährter verheirateter Katechisten zu begegnen und diesen – und auch darüber wurde schon vor und während des Konzils häufig diskutiert – später den Weg zur Priesterweihe zu ebnen. Auch in Europa hatte sich in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ein starker Priestermangel bemerkbar gemacht. In der französischen Kirche wollte man der Säkularisierung und Entfremdung weiter Kreise der Bevölkerung durch die Einführung eines Amtes, dessen Träger näher bei den Menschen waren, begegnen und manchen Bischöfen war der Aufbau einer Kirche der Armen ein Herzensanliegen. Manche Theologen vermissten in der Kirche schon damals eine stärkere Betonung der Diakonie, die durch ein eigenes Amt wieder neu zur Geltung gebracht werden sollte.27
Unter den Streitfragen, die in der zweiten Sitzungsperiode den Konzilsvätern zur Klärung vorgelegt wurden, war auch die Einrichtung des „Diakonats als eigenen und ständigen Grad des heiligen Dienstes“. In der Abstimmung sprachen sich erstaunlicherweise 1588 Bischöfe dafür, aber immerhin auch 525 dagegen aus. Der Text über den Diakonat, den das Konzil schließlich approbierte, weist gegenüber der vorangehenden Fassung eine deutliche Verlagerung in Richtung auf eine stärkere diakonale Ausrichtung dieses Amtes auf. Während der Diakon zunächst noch primär von seiner Assistenz am Altar und bei der Eucharistie gesehen wurde, wird im Konzilstext festgehalten, dass die Diakone die Handauflegung „nicht zum Priestertum, sondern zur Dienstleistung empfangen. Mit sakramentaler Gnade gestärkt dienen sie dem Volk Gottes in der Diakonie der Liturgie, des Wortes und der Liebestätigkeit.“ (LG 29)
Mit der Wiedereinführung des Diakonats verbanden die Konzilsväter damals je nach Region sehr verschiedene Erwartungen und Hoffnungen, die sich im Missionsdekret noch erkennen lassen. Den Bischöfen ging es wohl auch um ein differenziertes und auf die Zukunft offenes Verständnis des Diakonats, das sich deutlich vom Amt des Priesters unterscheidet. Manche Konzilsväter hielten es vor allem für angemessen und notwendig, „dass jene, die faktisch diakonale Dienste ausüben, wie die Katechisten in der Verkündigung und in der Leitung kleiner Gemeinden bzw. in der Leitung karitativer und sozialer Institutionen, auch die kirchliche Handauflegung zu diesem Dienst erlangen.“28 Im Missionsdekret wurde als Antwort auf den Wunsch der Missionsbischöfe die Möglichkeit eröffnet, verheiratete Katechisten als Verkünder des Wortes Gottes zu Diakonen zu weihen, eine Chance, die leider in vielen Kirchen des Südens zu wenig wahrgenommen wurde. Es war wohl die Angst vor einer sich daraus ergebenden Infragestellung des Zölibats oder die Befürchtung, den Katechisten durch die Diakonatsweihe zu viel Macht zu geben und sie zu Konkurrenten der Priester zu machen, was dazu führte, dass eine große pastorale Chance über Jahrzehnte nicht genutzt wurde.29 Wo aber nationale oder regionale Bischofskonferenzen den Raum dafür eröffneten, wurde dieses wiederentdeckte Amt zum Segen für die Ortskirchen und ihre Sozial- und Gemeindepastoral.
1.8 Nach dem Konzil – ausführende Bestimmungen durch päpstliche Schreiben
Das Konzil hatte den Weg zur Einführung des Ständigen Diakonats geöffnet, aber erst in der Folge wurden kirchenrechtliche Ausführungsbestimmungen zur Verwirklichung der Konzilsbeschlüsse erlassen. Papst Paul VI. veröffentlichte am 18. Juni 1967 das Apostolische Schreiben „Sacrum Diaconatus ordinem“, in dem der rechtliche Rahmen zur Weiterentwicklung des Diakonats in der Weltkirche abgesteckt wird.30 Am 15. August 1972 wurden zwei weitere Erlässe von Paul VI. veröffentlicht: das Motu Proprio „Ministeria quaedam“ sowie das Motu Proprio „Ad pascendum“31, die die kirchenrechtlichen Bestimmungen bezüglich der Weihestufe des Diakonats ergänzen. Diese sind ebenso wie die vorhergehenden Dokumente in die am 22. Februar 1998 veröffentlichten Grundnormen für die Ausbildung der Ständigen Diakone und das Direktorium für den Dienst und das Leben der Ständigen Diakone eingeflossen.32
1Algirdas Jurevičius, Zur Theologie des Diakonats. Der Ständige Diakonat auf der Suche nach eigenem Profil (= Schriften zur Praktischen Theologie, Bd. 3), Hamburg 2004, 20
2Gerhard Ludwig Müller, zitiert bei Wolfgang Allhorn, Der Diakonat in der frühen Kirche. In: Günter Riße et. al., Boten einer neuen Zeit. 50 Jahre Ständige Diakone im Erzbistum Köln, Paderborn 2018, 75
3Jurevičius, Zur Theologie des Diakonats, 27
4Hippolyt, Traditio Apostolica 8, zitiert bei Riße, Boten einer neuen Zeit, 81–82
5Riße, Boten einer neuen Zeit, 82
6Vgl. ebd., 78–79
7Ebd., 79–81
8Vgl. dazu: Georg Predel, Veränderte soziale Wirklichkeit – verändertes Amt. Zum Niedergang des Diakonates als eigenständigem Amt am Beispiel der Kirche Galliens im 4.–7. Jahrhundert. In: Klemens Armbruster, Matthias Mühl (Hg.), Bereit wozu? Geweiht für was? Zur Diskussion um den Ständigen Diakonat, Freiburg 2009, 63–94
9Vgl. Stefan Sander, Das Amt des Diakons. Eine Handreichung, Freiburg 2013, 81–87
10Günter M. Lux, Selige und heilige Diakone, Wien 2008
11Christoph Schönborn, Geleitwort. In: Lux, Selige und heilige Diakone, 5–6
12Lux, Selige und heilige Diakone, 29
13Ebd., 31
14Ebd.,
15Gebet zum hl. Cyriakus. Basilika Vierzehnheiligen. In: Riße, Boten einer neuen Zeit, 74
16Ebd., 44–45
17Hymnus De Nativitate 11,6–8. Zitiert nach: Riße, Boten einer neuen Zeit, 84
18Vgl. ebd., 119–121
19Joachim Oepen, Der Diakonat vom Frühmittelalter bis zum 18. Jahrhundert. In: Riße, Boten einer neuen Zeit, 93
20Vgl. Jurevičius, Zur Theologie des Diakonats, 61–62
21Vgl. Leonhard Lehmann, Franziskus – ein Aussteiger seiner Zeit. In: Diaconia Christi 51/ 2016, 100
22Riße, Boten einer neuen Zeit, 168
23Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, Diaconia in Christo. Über die Erneuerung des Diakonats (Questiones disputatae, Band 15/16), Freiburg 1962, 299
24Vgl. Jurevičius, Zur Theologie des Diakonats, 86
25Zweites Vatikanisches Konzil, Lumen gentium. Dogmatische Konstitution über die Kirche, Kapitel III, Nr. 29
26Zweites Vatikanisches Konzil, Ad gentes. Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche, Kapitel II, Nr. 16. Vgl. Peter Hünermann, Hans-Joachim Sander, Guido Bausenhart, Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bände 1 u. 2, Freiburg 2004
27Vgl. Bernd Lunglmayr, Der Diakonat. Kirchliches Amt zweiter Klasse?, Innsbruck-Wien 2002, 16–17
28Peter Hünermann, Theologischer Kommentar zum Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche Ad gentes. In: Herders Theologischer Kommentar, Bd. 4, Freiburg-Basel-Wien 2005, 286
29Vgl. Lunglmayr, Der Diakonat, 18
30Papst Paul VI., Sacrum Diaconatus ordinem. Allgemeine Normen für die Einrichtung des Ständigen Diakonats in der Lateinischen Kirche, Apostolisches Schreiben, gegeben als Motu Proprio, 18. Juni 1967. Vgl. Jurevičius, Zur Theologie des Diakonats, 88–90
31Papst Paul VI., Ministeria quaedam / Ad pascendum, Apostolische Schreiben, gegeben als Motu Proprio, 15. August 1972
32Vgl. Kongregation für das Katholische Bildungswesen, Kongregation für den Klerus, Grundnormen für die Ausbildung der Ständigen Diakone. Direktorium für den Dienst und das Leben der Ständigen Diakone, Rom 1998
2. EINFÜHRUNG UND WEITERENTWICKLUNG DES STÄNDIGEN DIAKONATS IN DER WELTKIRCHE UND IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM
2.1 Der Ständige Diakonat in der Weltkirche
Nach der von der Agenzia Fides zum Sonntag der Weltkirche 2018 veröffentlichte Statistik hat sich die Zahl der Ständigen Diakone weltweit um 1057 auf insgesamt 46.312 erhöht. In Europa hat ihre Zahl innerhalb eines Jahres um 145 zugenommen, während die Zahl der Priester im selben Jahr in Europa um 2583 zurückgegangen ist. Die meisten neuen Diakone gab es in Amerika (+ 842).33 Die ersten Ständigen Diakone sind nicht in Europa geweiht worden. Die Kirche hat hier eine weltweite Entwicklung angestoßen. Diese Entwicklung einer weltkirchlichen Berufung ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit.
Anfang des letzten Jahrhunderts wuchsen die Missionsorden, die ihre Sendung als Botschafter des Glaubens in die Welt hinaustrugen. In seinem Beitrag in Diaconia Christi, der Zeitschrift des Internationalen Diakonatszentrums (IDZ), stellt Klaus Kießling – viele Jahre der Präsident des IDZ – die Frage, welche Aufgabe die Diakone als Botschafter in der Weltkirche heute haben:
„Als Diakon verstehe ich mich als Botschafter unseres menschgewordenen Gottes, der Solidarität zeigt bis in den Tod und darüber hinaus. Ich glaube, dass mit Gottes Menschwerdung unsere Menschwerdung einsetzt. Als Botschafter Jesu Christi sind wir dazu berufen, anderen Menschen auf ihrem Weg der Menschwerdung solidarisch beizustehen, den Nächsten in der alltäglichen Seelsorge, den Fernsten überall auf der Welt. Wenn einer des Anderen Last trägt (Gal 6,2), so kann es auch geschehen, dass die wenigen Versammelten für die vielen beten, die derzeit nicht da sind. Und umgekehrt mögen die in der Welt Aktiven auch diejenigen vertreten, die kontemplativ leben. Auch Gemeinden sind miteinander verbunden, Ortskirchen und weltkirchliche Gemeinschaften – in gegenseitiger Stellvertretung. Und mir selbst bedeutet es viel zu spüren, dass irgendwo auf der Welt ein Mensch für mich betet – und ich für ihn. Eine Mission, die über den eigenen Kirchturm hinausreicht, eine weltkirchliche Mission erweist sich so nicht als zusätzliche Last, sondern als Ressource, als spirituelle und inspirierende Ressource“.34
Schon vor den Beschlüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils wird von der Vorbereitung von möglichen Weihekandidaten in den verschiedensten Ländern der Weltkirche berichtet. Schon im Jahr 1966 berichten auf einer internationalen Tagung in Rottenburg Teilnehmer aus 35 Ländern über den Stand und die Entwicklung des Diakonates in ihrem Bereich. Während sich der deutsche und der französische Episkopat zuerst nur für die Einführung des Diakonates ausgesprochen haben, war man in anderen Ländern schon weiter.35
Die ersten Schritte zur Einführung des Ständigen Diakonats nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in verschiedenen Ländern der Weltkirche lassen sich anhand kirchlicher Medienberichte exemplarisch dokumentieren:
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.