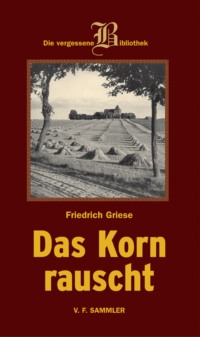Kitabı oku: «Das Korn rauscht»
Friedrich Griese
Das Korn rauscht

Bildnachweis: Das Titelbild und die Bilder auf den Seiten 7, 10, 55, 72, 81, 86, 100, 129, 149, 169 stammen von Karl Eschenburg und sind dem Band Friedrich Griese, Das Ebene Land. Mecklenburg, entnommen. Die Bilder auf den Seiten 35, 88, 116 stammen von Erna Lendvai-Dircksen aus dem Band Das deutsche Volksgesicht. Mecklenburg und Pommern. Die restlichen Abbildungen entstammen dem Verlagsarchiv.
Das Glossar wurde von Meike Bohn erstellt.
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Hinweis:
Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
ISBN 3-85365-195-X
eISBN 9783-85365-308-1
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright by V. F. SAMMLER, Graz 2003
Printed in Austria
Layout: Klaudia Aschbacher, A-8101 Gratkorn
Gesamtherstellung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. Stefan
INHALT
Vorwort
Zwang
Besuch am Abend
Die Hofgängerin
Kreuzbergstationen
Das Haus der Herren
Herring
Im Beektal singt es
Ees
Drei Jahre Lachen
Der Irrgang
Der Ruf des Schicksals
Trina Langs Junge
Johannisnacht
Das Korn rauscht
Glossar
VORWORT
Siehe, der Winter ist vergangen, und abermals wächst Gras und wird Kraut auf den Bergen gesammelt.
Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, daß sie wieder daselbst aufgehe.
Der Wind geht gen Mittag und kommt herum zur Mitternacht und wieder herum an den Ort, da er anfing.
Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt ewiglich.
(Sprüche Salomos)
Dieser Leitspruch zu Friedrich Grieses Roman „Das letzte Gesicht“ ist kennzeichnend für seinen Blick auf Mensch und Erdenlauf. Es ist ein tröstliches Bild, und es gefiel dem Dichter so gut, daß er den Spruch, in jeweils abgewandelter Form, in allen Epochen seines Schaffens – 1923, 1934 und 1960 – verwendet hat. Zum ersten Mal gebraucht er ihn in der Erzählung „Das Haus der Herren“ in seinem Band „Das Korn rauscht“, von dem hier erstmals seit über fünfzig Jahren eine Neuausgabe vorliegt.
Heute sind seine Bücher beinahe in Vergessenheit geraten. Dabei war Friedrich Griese in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der bedeutendste Schriftsteller Mecklenburgs. Weit über fünfzig Titel umfaßt sein Werk: allein 14 Romane, 10 Bände mit Erzählungen und 7 separat erschienene, 6 Dramen, 4 autobiographische Schriften, 4 Bücher über Mecklenburg sowie 2 Biographien – neben Reden, Aufsätzen, Hörspielen, Märchen und einigen Gedichten. Seine Bücher erreichten eine Gesamtauflage von vielen Hunderttausend; sie wurden ins Englische, Holländische, Norwegische, Schwedische, Finnische, Tschechische und Rumänische übersetzt, weitere Übersetzungen sollten folgen – doch der Beginn des Zweiten Weltkriegs setzte diesen Plänen ein Ende.
Die heutige Sekundärliteratur wertet Griese zumeist recht undifferenziert als wichtigen Vertreter der „Blut-und-Boden-Literatur“; nur allzugern wird sein Werk auf die zwölf Jahre im Nationalsozialismus reduziert. Griese selbst wehrte sich gegen eine solche Etikettierung. In seinen Lebenserinnerungen von 1970 schreibt er über den nationalsozialistischen Propagandabegriff: „Die Formulierung, die jetzt aufgekommen war, bedeutete nicht mehr als eine Phrase; sie verfälschte die beiden Begriffe und wurde gerade von denen nicht verstanden, die sie für sich in Anspruch nahmen. Für meine eigene Arbeit hatte ich die Verfälschung mit dem Satz abgelehnt: ‚Ich habe mich in meinen Büchern immer nur darum bemüht, von der Zusammengehörigkeit zwischen dem Boden und all seinem Lebendigen zu handeln.’“ Was im Nationalsozialismus bei vielen nur sentimentale Sehnsucht oder konjunkturbedingte Mode war, entspringt bei ihm dem ursprünglichen Erleben von Land, Mensch und Tier seiner mecklenburgischen Heimat, und er fand zu seinem Stil, so Marcel Reich-Ranicki, „als man vom Nationalsozialismus in Deutschland noch kaum etwas wußte“.
Die von ihm von der Zeit der Weimarer Republik an bis zur Nachkriegszeit favorisierten Motive und Stoffe lassen sich bereits an vielen seiner Buchtitel ablesen: „Die letzte Garbe“ (1927), „Der ewige Acker“ (1930), „Der Saatgang“ (1932), „Der Ruf der Erde“ (1933), „Das Kind des Torfmachers“ (1937), „Der Zug der großen Vögel“ (1951). Einflußreiche Vorbilder waren für ihn Selma Lagerlöf und Jens Peter Jacobsen – vor allem aber: der Autor von „Segen der Erde“ (1917) und spätere Nobelpreisträger Knut Hamsun.


„Und damit ist zugleich angedeutet, daß diese Bücher, was immer gegen sie einzuwenden ist, sich durch Vorzüge auszeichnen, die man nicht ganz vergessen sollte – durch atmosphärische Dichte, durch intensive Stimmungen und eine einfache und sehr anschauliche Sprache“, urteilt Reich-Ranicki am 1. Juni 1975 in seinem Nachruf auf Friedrich Griese über dessen Werk.
Als Sohn eines Kleinbauern, der infolge der Übernahme einer Bürgschaft verarmt und später als Tagelöhner arbeiten muß, wird Friedrich Griese am 2. Oktober 1890 in einem Dorf bei Waren, im östlichen Mecklenburg, geboren. Hier, in Lehsten, zwischen den beiden Straßen im Westen und Osten, dem „Hohen Ende“ und dem „Brink“, verbringt er die ersten fünfzehn Lebensjahre. „Ich habe sehr früh schwer arbeiten müssen“, bemerkt Griese im Rückblick, „aber ich habe doch auch erfahren dürfen, welcher Segen auf körperlicher Arbeit ruht.“
1906 geht er für fünf Jahre an das Lehrerseminar nach Lübtheen. Er beginnt zu schreiben. Die Vorbilder, an die er sich scheu wendet, verweisen ihn nur an Bücher. Doch „einer“, erinnert sich Griese 1931, „Peter Rosegger, gab mehr; ein paar herrliche Briefe von ihm, die er mir als damals achtzehnjährigem Menschen schrieb, waren lange Zeit der einzige Hinweis auf das, was es einmal für mich zu tun geben würde.“ Als er das erste Mal mit etwas Selbstgeschriebenem an die Öffentlichkeit tritt, ist sein Schreibimpuls ein sozialkritischer: In der „Rostocker Zeitung“ erscheint 1914 eine Artikelserie, in der Griese die Mißstände der „ritterschaftlichen Schulen“ angreift – der Titel: „Wir klagen an“. Weil er sich für seine Schüler engagiert hatte, die während der Erntezeit nach Gutdünken vom Gutsbesitzer aus dem Unterricht genommen werden konnten, war er aus seiner ersten Stelle entlassen worden.
Seit 1913 ist Friedrich Griese als „Lehrer mit echtem Pestalozzigeist“ in Stralendorf bei Parchim tätig, im südwestlichen Mecklenburg. Hier wird er im September 1916 heiraten, seine drei Kinder kommen hier zur Welt. Und hierher kehrt er im Sommer 1916, für Monate fast gänzlich ertaubt, aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Bereits im Vorschulalter ist er, der zeitlebens schwerhörig bleiben soll, an einem Gehörleiden erkrankt; es mag sein, daß dies seinen Rückzug in die Innenwelt noch verstärkt. Nun, mitten im Krieg, fühlt er sich dazu bestimmt, „festzuhalten, was so an äußeren und inneren Erfahrungen überliefert wurde“: Von 1916 bis 1919 entstehen die 14 Geschichten aus „Das Korn rauscht“. Seine „Erzählungen aus Mecklenburg“ erleben mehrere Auflagen. Sie erscheinen 1923 im Trierer Verlag Lintz, 1929 und 1934 im Carl Schünemann Verlag, Bremen, und zuletzt 1947 im Thomas-Verlag in Kempen am Niederrhein.
Seine Erzählungen sind vorzüglich geeignet, um ein Stück Alltagsgeschichte des ländlichen Mecklenburg im 19. Jahrhundert kennenzulernen – einer Zeit, in der die Bauern ihre Stiefel noch mit Stroh ausstopften, um warme Füße zu haben –, und sie sind auch heute noch gut lesbar. An ihnen zeigt sich bereits Grieses Interesse für Regionalgeschichte und seine Vorliebe für die den Mecklenburgern eigene Wesensart, ihre Sitten und Bräuche. Eine kleine bäuerliche Porträtgalerie ist hier entstanden – angefangen bei den drei „Adebars“, die bei ihren bedächtigen Zusammenkünften nur alle halbe Stunde einmal den Mund auftun, über Doris und Anna Schweder, die hartherzige Mutter und ihre rebellische Tochter, bis zu dem „düsigen“ und doch so kinderlieben Knecht Hans Harm.
Inspiration erfährt der Schwerhörige stark „durch das Auge“: Alle Menschen, über die er schreibt, haben auch gelebt. Es liegt ihm fern, die Dorfwelt zu verklären. In seinem Werk dominieren die sozial Schwachen – das Gesinde, die Tagelöhner und einfachen Bauern. Sein Augenmerk, bekennt der Dichter 1946 in seinem Aufsatz „Von der inneren Beständigkeit“, habe „immer dem sogenannten kleinen Mann gegolten, der Not und Sorge seines Alltags, wie seinem Mut und seiner Rastlosigkeit, dieser Not zu begegnen.“ Auch von den sexuellen Nöten erzählt er, davon, wie einzelne Dorfbewohner von ihrem „Inwendigen“, den verborgenen Trieben oder der Last eines Geheimnisses in ihrem Inneren, bedrückt werden. Seine ruhig dahinfließenden Geschichten sind volkstümlich-realistisch, oft auch liebevoll-humorvoll erzählt – etwa, wenn in „Der Ruf des Schicksals“ in den zwei Brüdern gesetzteren Alters eines Tages die Kinderseele wieder erwacht, oder wenn Griese im „Irrgang“ schildert, wie ein ortsfremder Pfarrer es manchmal nicht ganz leicht hat. Eingängigstes Beispiel für die Verbundenheit des Bauern mit seiner Scholle ist die Titelgeschichte: Gelassen läßt der Sterbende Haus, Hof und Familie hinter sich, denn das Sterben gehört in den Lauf der Natur; doch seine Seele findet keine Ruhe, ehe sie nicht von seinem liebsten Acker hat Abschied nehmen können.


Grieses Kriegserlebnis fließt ein in seinen ersten Roman: „Feuer“ (1921), der im November 1918 entsteht. Er schildert die Heimkehr eines Soldaten, der sich in die Nachkriegswelt nicht mehr eingliedern kann – ein beliebtes literarisches Thema in den Zwanzigern, das Griese womöglich als erster überhaupt verarbeitet hat.
Eine Reihe von Grieses Werken basiert auf Sagen und mündlich überlieferten Geschichten, die ihm zum Teil von dem eifrigen Sammler Richard Wossidlo (1859–1939) vermittelt werden. Ihm widmet Griese 1925 sein Buch „Alte Glocken“. Umgekehrt gehen die mecklenburgischen Dialogeinschübe seiner Prosa ein in das von dem Volkskundler begründete „Mecklenburgische Wörterbuch“, in dem auch Wendungen aus „Das Korn rauscht“ zu finden sind.
In Kiel, wohin der Dichter 1926 gezogen ist, schreibt er den Roman, der ihn weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt macht und 1928 mehrfach preisgekrönt wird. 1957 wird er in der zehnten Auflage erscheinen. „Winter“ (1927) ist eine düstere Vision vom Untergang eines überalterten Dorfes, dessen Bevölkerung einem unheimlichen, lebenszerstörerischen Winter zum Opfer fällt – nur ein junges Paar überlebt.
Auch das Thema der Leibeigenschaft, die in Mecklenburg erst 1820 aufgehoben wurde, beschäftigt Griese. Sein Roman „Der Herzog“ (1931) schildert den vergeblichen Kampf Karl Leopolds von Mecklenburg (1713–1747) für die Bauernbefreiung; „Das Dorf der Mädchen“ (1932), das auf Geschehnissen von 1848 beruht, führt die sexuelle Verfügbarkeit des ius primae noctis und das Züchtigungsrecht eines Gutsherrengeschlechts über seine Hörigen vor Augen bis zu deren blutiger Rebellion.
Tags Volksschullehrer, später -direktor – nachts Dichter: Lange hat Griese mit dieser Doppelbelastung gelebt. Wegen der Aussicht auf Beurlaubung, die ihm ab 1931 dann auch gewährt wird, war er nach Preußen gegangen. Seit 1935 lebt er nun als freischaffender Schriftsteller wieder bei Parchim in Mecklenburg, in seinem „Rethus“, wie er wegen des rohrgedeckten Daches die Markower Mühle nennt.
Nachdem die Vertreter der Heimatdichtung in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gegenüber denen der Moderne, jenen der Neuen Sachlichkeit und des Großstadtromans einen schweren Stand hatten, erleben sie im Dritten Reich, das die „bäuerliche Mythendichtung“ als „heilsames“ Gegengewicht zur rationalen „Verstädterung“ der Literatur propagiert, eine starke Förderung. Nicht ohne Witz entgegnet Griese 1936 in dem programmatischen Vortrag „Landschaft und Dichtung“ auf Alfred Döblins bekanntes Diktum vom „schlechthin platten Land“, man habe Döblin damals erwidern können, „daß es in der dörflichen Welt kein plattes Land gebe, selbst der ebenste Weg sei noch nicht platt, ganz zu schweigen von dem herbstlichen Pflugacker, platt sei nur der Asphalt der Großstadt, der sei es dafür allerdings auch vollständig und schlechthin“. Acht Literaturpreise hat Friedrich Griese in der Zeit des Nationalsozialismus erhalten – so viele wie keiner sonst. Doch Griese, im Grunde ein unpolitischer Mensch, wird nie Parteidichter, und bis 1942 lehnt er einen Eintritt in die NSDAP ab. Als die literarischen „Monats-Hefte Mecklenburg-Lübeck“ 1936 eine politische Ausrichtung bekommen sollen, legt er sein Amt als Herausgeber nieder. Und als er nach der dritten Auswechslung seines Verlegers bei Langen-Müller durch Robert Ley, den Chef der „Deutschen Arbeitsfront“, ein Rundschreiben erhält, das den hauseigenen Autoren ihre künftige Arbeit im Sinne der Partei vorschreibt, kündigt Griese seine Verträge mit jenem Verlag, in dem der Großteil seiner Bücher erschienen ist. Immer hat er darauf beharrt, in seinem Werk „den Nationalsozialisten gegenüber keine Zugeständnisse gemacht zu haben“. Mehrfach macht er Erfahrungen mit der Zensur: „Winter“ wird von Goebbels und dem „Amt Rosenberg“ angegriffen, weil ein „ostischer Mensch“ Träger der Handlung ist, ferner – wegen „kommunistischer Tendenzen“ – Grieses Roman „Die Weißköpfe“ (1939). Seine Bauerntragödie „Mensch, aus Erde gemacht“ mit Heinrich George in der Hauptrolle, die 1932 den Preis des Bühnenvolksbunds gewonnen hat, wird – auf Weisung des Landwirtschaftsministers Darré – kurz nach der Premiere verboten, „weil es solche deutschen Bauern nicht gibt“. Dennoch läßt Griese sich vom NS-System einspannen, indem er Werke schreibt, die für Propagandazwecke genutzt werden können.
Ab 1945 folgt eine Zeit des Leidens – Griese hat sie in „Der Wind weht nicht, wohin er will“ (1960), einem sehr aufrichtig und ohne Ressentiments verfaßten Erlebnisbericht, auf bewegende Weise mitgeteilt. Der zunächst beabsichtigten Ausplünderung durch die Russen entgeht er; beeindruckt von dem Bestand an russischer Literatur in seiner Bibliothek stellen sie Griese einen „Schutzbrief“ aus. Doch unmittelbar nach ihrem Abzug muß Griese mit ansehen, wie sein gesamtes Archiv – einer der Hauptgründe, weshalb er geblieben war – von den eigenen Landsleuten verbrannt wird: Manuskripte, Briefwechsel und Erinnerungsstücke. Seine Bücher werden abtransportiert, sein Haus enteignet und geplündert, sein Konto konfisziert. Ein Anklagepunkt des selbsternannten „Kulturdezernenten“, der all dies veranlaßt hat, lautet, Griese besitze unter all seinen Büchern „nur drei Bände Gorki“ – ein geradezu grotesker Vorwurf. Doch seine Denunziation ist folgenreich: Der Dichter wird zum Straßenkehren gezwungen, er kommt – ohne das Wissen seiner Angehörigen – ins Zuchthaus Alt-Strelitz, dann in das berüchtigte Lager Fünfeichen. Die mehr als neun Monate Haft übersteht Griese mehr tot als lebendig. Durch unermüdliche Suche und Fürbitte erreicht seine Frau im März 1946 seine Freilassung; Johannes R. Becher, vor allem aber ein russischer Oberst haben sich für ihn eingesetzt. Trotz der erduldeten Qualen ist er zur Zusammenarbeit mit dem neugegründeten sozialistischen „Kulturbund“ bereit: Mit Offenheit äußert er sich zu den Vorwürfen seiner Kooperation mit den Nationalsozialisten; er gibt zu, sich angepaßt zu haben. Wiedergutmachung will er leisten „im Wort“ – doch die Gelegenheit dazu gibt man ihm nicht. Nur ein Jahr später beginnen die Schikanen der Behörden aufs Neue. Von der Parchimer Polizei bekommt er „den schriftlichen Befehl: drei Tage Besenbinden bei der GPU [= die polit. Polizei der SU, 1954 in KGB umbenannt].“ Griese und seiner Frau bleibt gerade noch genug Zeit zur Flucht. Sie gehen zu ihren Kindern in den Westen – nur vorübergehend, wie sie glauben.
Auch jetzt noch besitzt Griese dort eine treue Leserschaft; Ehrungen erfährt er als Preisträger des Hebbel-Preises (1955, 1958) und durch die Mecklenburgische Landsmannschaft (1960, 1964). Doch allmählich sinkt sein Bekanntheitsgrad, mit der Überarbeitung der Lesebücher Ende der 60er verschwinden seine Texte weitgehend aus den Schulen, und in der DDR ist er geradezu tabuisiert.
Am 1. Juni 1975 stirbt Friedrich Griese. Begraben wird er vor dem zur mecklenburgischen Kirche gehörigen Dom des Grenzortes Ratzeburg – in mecklenburgischer Erde. „Tief beeindruckend“, befindet der Theologe Karlmann Beyschlag in der Trauerrede an Grieses Sarg, sei in seinem Werk „die Nähe der von Gott gekennzeichneten Menschen zum Tode, ja der Tod selbst, und schließlich das Kainsschicksal dieser Welt: ‚Unstet und flüchtig sollst du sein.’ Eine ganz erstaunliche Anzahl von Grieses Gestalten befindet sich immer wieder auf unruhiger, zuweilen verzweifelter Wanderschaft.“ Auch in „Das Korn rauscht“ begegnen sie uns – in der heimatlosen „Hofgängerin“, in Anna Behm in „Kreuzbergstationen“ und in der lebenslustigen Rheinländerin Hilda Blanck in „Drei Jahre Lachen“.
Im Laufe seines wechselvollen Lebens hat Friedrich Griese an vielen Orten gelebt. Gefragt, ob ein Mensch, welcher eine neue Heimat wählen mußte, wieder ein Zusammengehörigkeitsgefühl mit der ihm fremden Landschaft gewinnen kann, antwortete er: „Ich meine nicht, daß man eine andere Heimat bekommen kann als die, in der man geboren wurde. Wenn wir uns prüfen, merken wir, daß ‚Heimat’ uns vor allem das Elternhaus mit der nächsten Umgebung bedeutet. Hier machen wir auch unsere ersten grundlegenden Erfahrungen – Liebe, Dankbarkeit, Enttäuschungen, Vertrauen –, alles spätere dreht sich nur auf einer anderen Windung um den Hügel unseres Lebens zu: wenn wir hinunterschauen, sehen wir immer dieselben Erscheinungen. Die Zusammengehörigkeit mit der Landschaft und dem ganzen Land gewinnen wir später, meistens auf dem geschichtlichen Weg, sie ist weniger tief. Man kann wohl in einem anderen Lande für eine spätere Lebenszeit heimisch werden, aber doch nur behelfsweise und unter inneren Opfern. Das Ursprüngliche liegt, wie ich schon sagte, im Elternhaus und seiner Umgebung.“ – Aus diesem Ursprünglichen heraus, aus dem unmittelbaren Erleben von Land und Leuten seiner Kindheit, sind die in „Das Korn rauscht“ gesammelten Geschichten entstanden.
Meike Bohn
ZWANG
O liebe Vernunft, du gehest wohl- weislich auf dieser Welt Straßen, was den äußern Leib anlanget, wo aber bleibet die arme Seele?
(Jakob Böhme)
Vom Neßberg hinter dem Brink nach Norden und Osten voraus ist das Land weit und eben, eine ruhige Fläche. Hier und da nur ist ein Hügel, ein Stückchen Wald, ein buschumsäumtes, schilfdurchwachsenes Wasser, ein Kartoffelacker, ein Kornfeld. Aber das Gesicht dieses Landes als einer Fläche stört das nicht. Und dazwischen liegen die Höfe in der Sommersonne, im Frühlingswind, im Nordweststurmwetter, im schneeverwehten Wintertag: halb verträumt, halb wachsichtig.
In diesem nur selten gestörten Einsam geht der eine Zeiger an der Lebensuhr der Menschen, von denen hier berichtet werden soll, oft in seltsamem Hin und Her, während der andere seinen steten und gewissen Gang beibehält – dieser weiß um alles, was auf der Erde ist, was sie nötig hat, was sie gibt und was sie versagen muß; jener wird von ihrem Inwendigen getrieben und ist oft in Angst und Not und wilder Dumpfheit.
Nichts ist, was heilsam ablenkt von all den ewigen Dingen, denen diese Menschen näher gerückt sind als ihre Brüder und Schwestern in der großen oder kleinen Stadt. Ihre Tage sind eng verbunden mit Tod und Auferstehen, Geborensein und Sterbensvorbestimmtheit, Werdensfrohheit und Entwerdungssehnsucht. Und unter all diesen einfachen Dingen gehen die Menschen oft wie Trunkene, wie Kinder, wie still Besessene, wie geistesgehaltene Nachtgänger.
Man sagt hierzulande von einem solchen Menschen: „Er hat den Zwang.“
Seht: So sprechen sie von einem Bruder oder einer Schwester und geben damit eine ganze Wissenschaft des Kopfes und des Herzens: „Sie hat den Zwang.“
Und von solchen Menschen soll auf diesen Blättern geredet werden.
Wie ging es Hans Schneider?
Es war etwas in ihm, was nicht frei war. Es war etwas geschehen, irgend einmal vor Jahren geschehen, wovon keiner etwas wußte. Marie Schneider erzählte es zuweilen in ihrer Not, daß ihr Mann sich bei Weststurm des Nachts plötzlich im Bette aufsetze, im Schlafe anfange zu reden mit solchen Worten, die sie nicht verstehe und die wohl auch keiner verstehen könne; schlimme Worte seien es aber nicht, und es stecke auch gewiß nichts Schlimmes dahinter.
Nun, die Menschen blieben dabei, es müsse einmal etwas geschehen oder gesprochen sein, ein rasches Tun, ein schweres, unheilvolles Wort, das die Seele Hans Schneiders drücke, daß sie nicht ruhig werden könne; und es müsse das geschehen oder gesprochen sein in einer wilden Stunde, einem Sturmtag oder einer Wetternacht.
Denn wenn ein Wetter, ein Gewitter, über den Hof ging, kam es wie der böse Feind über Hans Schneider. Er stand dann wie ein Besprochener, ein Behexter, vor der großen Hoftür, wenn die ersten raschen Schläge kamen; er stand so dreißig oder sechzig Atemzüge lang. Und plötzlich drehte er dann herum und ging geduckten Kopfes in das Haus, ging ins Bett.
Ja, der Bauer Hans Schneider ging, wenn das Wetter für seinen Hof gefahrbringend heraufkam, ins Bett. Angst? Nein, es war keine Angst; die äußert sich bei einem Bauern nicht in dieser Art.
Wie ein Schrei gellte der Donner um das Haus. Marie Schneider saß in der Stube am Leutetisch und las in dem großen Erbgesangbuch, die Mädchen und die Kinder saßen um sie herum. Die Knechte waren im Stall bei dem Vieh. Sie lösten den Pferden die Halskoppel; sie machten den Kühen die Ketten von den Hälsen los, damit, wenn ein Blitz die Ställe treffen würde, sie schnell das Vieh nach draußen jagen könnten. Der Bauer aber lag im Bett, hielt die Pfeife zwischen den Zähnen und rauchte kalt.
Auf seinem Gesicht stand nichts von Angst oder nur von Furcht. Langsam gingen seine Augen in der Stube herum; über seine Lippen kam kein Wort. Und wenn alle anderen mit Sorgen und Unruhen um Hof und Vieh bis an den Hals gefüllt waren, blieb das Gesicht des Bauern stets gleichmäßig ruhig; und die Lippen, mit denen er die Luft durch das Pfeifenrohr einsog, machten keinen einzigen hastigen Zug.
Die Leute sagten: „Er hat etwas auf dem Gewissen.“
Sie sagten: „Die Angst vor der Stimme des zornigen Gottes treibt ihn ins Bett.“
Und sie sagten: „Es wird ihm einmal schlecht gehen dabei; Gott läßt sich nicht spotten.“
Und es kam die Stunde, die jeder erwartete. Aber sie kam anders, als alle gedacht hatten. Sie zeigte, daß das Gewissen Hans Schneiders rein und gut war. Und sie befreite ihn von dem sonderbaren Müssen.
Es war eine jener Stunden, in denen Gott über eines seiner Geschöpfe, die sich Menschen nennen, wieder einmal lächeln mußte.
Es stand ein Wetter über dem Hof; eins von jener Sorte, die wie eingeklemmt stehen und immer lauter heulen und immer schneller das Feuer vom Himmel werfen.
Marie Schneider las laut und langsam den „Gesang in besonderen Nöten“; den, der um Hilfe im Gewitter fleht, hatte sie schon zweimal und mit gefalteten Händen gelesen. Die Mädchen sahen mit angstvollen Gesichtern nach draußen, wo eben der Regen hernieder zu prasseln begann, und atmeten hörbarer; denn wenn der Regen kommt, ist das schlimmste Wetter vorüber. Der Bauer lag im Bett und rauchte kalt.
Da fuhr noch einmal ein Blitz herab. Er fuhr durch den Schornstein in den Kamin, von ihm in die Stube. Er schlug die Pfeife Hans Schneiders, die der schon an den Bettpfosten gestellt hatte, weil er aufstehen wollte, in Stücke. Und er fuhr darauf durch die Tür nach draußen.
War das nun etwas Großes?
Oder ging daraufhin etwas Gewaltiges vor sich?
Hatte Gott gesprochen, und wußten die Menschen nun, was er an Hans Schneider gestraft hatte?
Alles, außer der Pfeife Hans Schneiders, war, wie es vorher auch gewesen war. Marie Schneider und den Mädchen saß zwar das heiße Entsetzen in der Kehle. Der Bauer aber lag noch einen Atemzug oder zwei; dann stand er langsam aus dem Bett auf, suchte die zerscherbte Pfeife zusammen und ging damit nach draußen. Das war alles. Und es wurde nichts gesprochen.
Seit der Zeit ging Hans Schneider nicht wieder ins Bett, wenn am Tag ein Wetter da war. Und wenn in der Nacht eins aufkam, stand er auf, wie alle anderen auch. Er sah nach den Tieren im Stalle, koppelte die Pferde los, kettete die Kühe ab, sah nach Türen und Fenstern und hatte bei alledem eine leichte und heilsame Sorgenangst um seinen Hof. Aber er kannte nicht mehr das besondere Müssen, das ihn früher im Wetter ins Bett und dort die Pfeife kalt zwischen die Zähne zwang.
Allmählich sprach es sich im Dorfe herum.
Die Leute sahen sich an und fragten einander, wie die Leute fragten, die zur Zeit Zachariäs lebten und von dem Wunder hörten, das an ihm geschehen war: „Was dünket dich um Hans Schneider?“
Die Frage ging nicht lang herum, bis die Antwort kam. Und die lautete: „Hans Schneider hatte den Zwang.“
Gott aber lächelte.

Und wie war es mit Johann Reimer?
Oh, es gibt Geschichten von diesen Menschen, die von Gott mit einem solchen unfreien Inwendigen geschlagen waren, Geschichten, die heute selten noch der oder dieser kennt; und der sie kennt, müht sich, sie zu vergessen, weil sie seinen inwendigen Menschen als tagfremdes Gut belasten.
Johann Reimer gehörte zu den Stillen, denen eine Erkenntnis ewiger Dinge geworden ist und die unter dieser Erkenntnis wie unter einem schweren Joch schreiten, weil sie sie nicht weitergeben können. Denn wer von diesen Menschen sprach je von den Geheimnissen, die ihm gegeben wurden? Sie schwiegen, schwiegen bis in den Tod, ohne ein kleines Wort preisgegeben zu haben. Ihnen war gegeben zu wissen; aber ihnen war nicht gegeben, ihre Gotteswissenschaft den Menschen ausdeuten zu können.
Jede Johannisnacht trieb es Johann Reimer an den Kreuzweg, der mitten im Wald unter Haselgebüsch, Birken und hohen Fuhren stand. Um Dunkelwerden ging er aus dem Haus und ging seinen Weg still und unverdrossen. „Es ist wieder soweit“, mit diesen Worten ging er über die Schwelle. Er wäre lieber geblieben, aber er mußte gehen. Man fragte ihn nicht nach seinem Willen; er hatte seine Sendung. Was trieb ihn? Wer sandte ihn? Nun, Johann Reimer liegt schon lange auf dem kleinen Friedhof gleich linker Hand hinter der Pforte, er kann auch heute noch nicht davon sprechen. Vielleicht wird ein späteres Geschlecht alles von ihm erfahren.
Er saß unter dem Kreuzweg, bis die Mitternacht langsam von den hohen Wipfeln herabglitt. Dann war die Waldstille in einem Atemzug verwandelt. Die Luft war voll von Schreien, Fluchen, Weinen, Bitten, Singen, Lallen. Er sah nichts; aber er hörte den Zug eines Heeres, das vom Osten kam und gen Westen ging, das an ihm vorüberflog, lief, keuchte, trabte, schritt, schleifte, tanzte.
Bis dann in einem Atemzug wieder Stille ward. Dann mußte Johann Reimer seine Augen heben, und dann sah er auch. Dann ging an ihm vorüber, wer in diesem Jahr bis zur nächsten Johannisnacht sterben sollte. Es waren stets ein paar von denen, die in dieser Nacht in ihren Häusern zwischen dem Hohen Ende und dem Brink ruhig schliefen und nichts von dem Gang wußten, den sie an Johann Reimer vorüber tun mußten. Sie gingen, als ob sie vom Walde kämen und ins Dorf wollten, und grüßten ihn nicht.
So hatte er Jahr für Jahr am Kreuzweg gesessen und war auch von Jahr zu Jahr stiller geworden. Die Leute im Dorf wußten, was ihn stille machte, und sprachen so von ihm, wie sie auch von Hans Schneider sprachen.
Zuletzt kam aber auch für ihn die Stunde, die ihn löste. In der letzten Johannisnacht, in der es ihn an seinen alten Platz zwang, war es ihm plötzlich, als werde er auf beiden Augen blind. Er sah noch den alten Daniel Behm mit langsamem, leisem, erdentrücktem Schritt an sich vorübergleiten. Dem Pastor hat er es auf dem Totenbett gesagt – Mina Reimer hat es hinter der Tür gehört –, mit ganz klaren und gewissen Worten hat er es gesagt, daß er Daniel Behm plötzlich habe im Schreiten innehalten sehn, daß der sich zu ihm umgedreht und mit einer ganz hellen Stimme diese deutliche Rede zu ihm gesprochen habe: „Nun hast du genug gesehn, Johann Reimer, nun sollst du schauen.“ Und da ist ein plötzliches Dunkel und darauf eine lichte Helle geworden. Und dann hat Johann Reimer sich selber gesehen, wie er in seinem Gottestischrock, das Gesangbuch in der Hand, einen Blumenstrauß in der Linken, den Weg vom Wald ins Dorf gegangen ist. Da wußte er, daß er der letzte von denen sein würde, die in diesem Jahr sterben müßten. Und das war die schönste Stunde seines Lebens. Nun war er frei. Am Morgen erzählte man es sich im Dorf, daß Daniel Behm in der Johannisnacht gestorben sei.
Seine Tochter, Wilhelmine Laartz, geborene Behm, habe an seinem Bette gesessen. Wie die Uhr halb eins gewesen sei, habe er noch einmal die Augen geöffnet und einige Worte gesprochen. Seine Stimme sei ganz hell, aber doch so gewesen, daß sie die Worte nicht habe verstehen können.