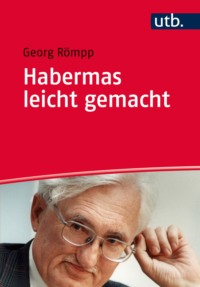Kitabı oku: «Habermas leicht gemacht», sayfa 5
2.1.4 Soziologie als Wissenschaft vom Handeln
Nach dieser kurzen Skizze der radikalen Gegenposition zu den Themen Handeln und Kommunikation kommen wir wieder auf die soziologische Ausgangsposition zurück, die für Habermas wie für die meisten theoretischen Soziologen im Zusammenhang mit dem Begriff des Handelns leitend geworden ist. Es dürfte deutlich geworden sein, dass und warum Habermas sich ausführlich mit der Luhmann’schen Systemtheorie auseinandersetzen musste. Die Darstellung dieser Auseinandersetzung wäre geradezu eine alternative Möglichkeit für eine Darstellung der Habermas’schen Grundgedanken.
Auch für eine an Max Weber anschließende Soziologie kann aber die bisher gegebene Charakterisierung von Handeln noch nicht ausreichen. Es fehlen noch zwei Auszeichnungen, um von einer Wissenschaft vom Handeln sprechen zu können. Zum einen ist ihr Thema traditionell nicht das Handeln als solches, sondern eine spezielle Form von Handeln bzw. eine besondere Art von Handlungen. Soziales Handeln und soziale Handlungen unterscheiden sich – wieder nach Max Weber – von anderen Handlungen durch den sinnhaften Bezug auf das Verhalten anderer Menschen:
„,Soziales‘ Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.“9
Soweit wird allerdings nur ein Kriterium hinzugefügt, um soziales Handeln als eine besondere Klasse des Handelns auszuzeichnen.
Aber auch damit kommen wir mit der bis jetzt dargestellten Unterscheidung von Handeln und Verhalten noch lange nicht zu einer Wissenschaft, die wir als Soziologie bezeichnen können. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir dann von einer Wissenschaft sprechen, obwohl wir bisher nur von dem Vorgang gesprochen haben, in dem wir Handlungen von Verhalten bzw. von Ereignissen in der Welt unterscheiden. Eine solche Wissenschaft muss offenbar davon ausgehen können, dass wir in der Lage sind, [<<45] fremden Sinn zu verstehen. Das muss aber natürlich nicht heißen, dass sich eine soziologische Wissenschaft damit begnügen müsste, solche Verstehensleistungen zu erbringen. Natürlich ist die Soziologie wie andere Wissenschaften auch mit dem Beobachten, dem Klassifizieren, dem Messen, dem Aufstellen von statistischen Korrelationen und Regressionen und auf dieser Grundlage mit der Ausarbeitung von Theorien beschäftigt.
Solche Theorien erklären uns die Welt dadurch, dass sich einzelne Ereignisse aus diesen Theorien ableiten und vorhersagen lassen. Sie folgen also dem allgemeinen Schema wissenschaftlichen Erklärens (dem sog. Hempel-Oppenheim-Schema). Ein Ereignis gilt als erklärt, wenn und indem wir es als Fall einer allgemeinen Regel aus dieser Regel ableiten können. Das kann im einfachsten Fall so funktionieren: (a) Alle Katzen jagen Mäuse, (b) Lucy ist eine Katze, woraus sich folgerichtig das Ereignis ableiten lässt: (c) Lucy jagt Mäuse, womit uns (c) als erklärt gilt; oder, noch einfacher formuliert: Lucy jagt Mäuse, weil sie eine Katze ist und für diese Tiere jene generelle Verhaltensweise gilt. Natürlich kann das auch wesentlich kompliziertere Formen annehmen. Das Ereignis, dass der Meteor M mit der Beschleunigung a1 zur Erde gestürzt ist, kann so erklärt werden: Weil (a) die Gravitationskraft nach Newton bestimmt wird durch
F = G × [(m1 × m2 ) ÷ r2 ] und (b) a1 = F ÷ m1
(zweites Newton’sches Axiom) und (c) die Erde die Masse m1 besitzt. Natürlich gilt das nur dann, wenn man die Gravitation durch die Masse des Meteors m1 vernachlässigt und außerdem vernachlässigt, dass das Newton’sche Gravitationsgesetz nur annähernd gilt.
Aber auch wenn es der Soziologie gelingt (oder gelänge), solche gesetzesförmigen (nomologischen) Erklärungen zu liefern, kommt (oder käme) sie doch nicht darum herum, zunächst ihren Gegenstand – das Handeln und davon ausgehend die spezielle Form des sozialen Handelns – zu bestimmen. Das aber bedeutet, Handeln von Verhalten als von physikalisch beschreibbaren Ereignissen in der Welt durch den subjektiv gemeinten Sinn zu unterscheiden und damit die Leistung des Fremdverstehens einzusetzen. Die Alternative bestünde nur darin, den Begriff der Handlung aufzugeben und Soziologie als Verhaltenswissenschaft zu betreiben, so dass Verhaltensweisen miteinander korreliert werden und auf diese Weise allgemeine Gesetze über das Verhalten aufgestellt werden, mit deren Hilfe sich einzelnes Verhalten erklären lässt. Das alles ist nicht prinzipiell unmöglich, aber es würde einen Paradigmenwechsel darstellen, in dem das aufgegeben wird, was Soziologie bisher bedeutet hat. Man könnte auch sagen, dass damit Soziologie zur empirischen Psychologie würde und deshalb ihren eigenen Gegenstand verlieren müsste. [<<46]
Es gehört zu den zentralen Gedankengängen von Jürgen Habermas, dass dies keine Option darstellt. Der Begriff des Handelns lässt sich nicht von seinen ‚traditionellen‘ Kriterien lösen. Diese Behauptung entnimmt Habermas einer Theorie über das Handeln, die gerade auf die Bedingungen der wissenschaftlichen Untersuchung des Handelns reflektiert. Soll eine Wissenschaft vom Handeln möglich sein, so muss jenes ‚deutende Verstehen‘, von dem Max Weber sprach, seinen sprachlichen Ausdruck finden können. Das formuliert eigentlich nur die triviale Einsicht, dass wir es in der Wissenschaft mit sprachlichen Ausdrücken allgemeiner Zusammenhänge zu tun haben. Aber es gibt eine noch fundamentalere Bedingung für eine solche wissenschaftliche Untersuchung von Handlungen: Einen ‚subjektiven Sinn‘ (wiederum nach Max Weber) kann die Soziologie nur auffinden, wenn die Handelnden diesen Sinn selbst sprachlich ausdrücken können. Anders können sie nicht als Subjekte aufgefasst werden, die einen ‚subjektiven Sinn‘ demonstrieren können.
Das bedeutet aber keineswegs, dass sich die Soziologie auf ein ‚verstehendes‘ Vorgehen konzentrieren müsste und etwa soziales Handeln durch ‚Nachempfinden‘ oder ‚Empathie‘ beschreiben sollte. Ihre Aufgabe besteht durchaus darin, zu Erklärungen zu kommen, d. h. zum Aufstellen von allgemeinen Gesetzen, aus denen einzelne soziale Phänomene abgeleitet werden können, so dass wir sie dann als ‚erklärt‘ bezeichnen. Nichtsdestoweniger hat sie einen Gegenstand, der sich von denjenigen der Naturwissenschaften dadurch unterscheidet, dass er sich durch das Verbinden von subjektivem Sinn mit Verhalten – das dadurch zu einer Handlung wird – auf sich selbst beziehen können muss. Er unterscheidet sich aber auch von dem Gegenstand der sog. ‚Humanwissenschaften‘ oder auch der sog. ‚Geisteswissenschaften‘, weil die Soziologie es nicht mit ‚Menschen‘ oder ‚Individuen‘ und deren geistigen Produktionen wie Literatur oder Kunst zu tun hat, sondern mit Akteuren, also handelnden Subjekten.
Versuchen wir, die wichtigen Besonderheiten von Handlungen, die diese von Verhalten unterscheiden, durch einige Kriterien zusammenzufassen. Dabei geht es immer darum, dass der wissenschaftliche Beobachter einem handelnden Individuum das Vorliegen solcher Auszeichnungen zuschreibt, und zwar zunächst so, dass dieses Individuum sich selbst darin zu sich selbst verhält:
• Ein beobachtbares Verhalten ist mit einer Absicht verbunden;
• der Handelnde verbindet damit das Bewusstsein, er hätte dieses Verhalten auch lassen können, er fasst sich also als frei auf, dazu gehört auch, dass er eine Kontrolle über die mit diesem Verhalten verbundenen Bewegungen hat;
• er kann sein Verhalten in einer Wahl zwischen verschiedenen Optionen begründen, ohne dass damit große intellektuelle Bemühungen verbunden sein müssten. [<<47]
So weit ist die Bedingung des Sich-zu-sich-Verhaltens erfüllt. Das wird etwa schwieriger, wenn wir für eine wissenschaftliche Thematisierung von Handlungen noch verlangen, dass Handlungen identifizierbar sein müssen, d. h., der Beobachter muss jeweils entscheiden, dass es sich gerade um eine solche und nicht um eine andere Handlung handelt. Das ist gleichbedeutend damit, dass es Regeln geben muss, um sie als bestimmte Handlungen identifizieren zu können.10
Einige Schwierigkeiten mit einer solchen Auffassung von Handlungen waren schon lange vor Niklas Luhmann bei Max Weber selbst deutlich geworden. Wer in einer ‚Soziologie‘ den Logos des Sozialen geben will, der muss offenbar Aussagen über den in einer Handlung implizierten subjektiven Sinn des Handelnden treffen können. Damit wird der subjektive Sinn aber zumindest so weit objektiv, dass ‚wir‘ – d. h. hier: die Soziologen – ihn in Gruppen einteilen und näher bestimmen können. Wir können dann sagen, wie der subjektive Sinn einer bestimmten Handlung näher zu verstehen ist. Solche Handlungsbeschreibungen sind dann in dem Sinn ‚objektiv‘, dass sie intersubjektiv nachvollziehbar sein müssen. Etwa versuchte Max Weber, verschiedene ‚Handlungstypen‘ zu unterscheiden, und kam dabei auf vier verschiedene Typen: zweckrationale (d. h. an einem Nutzen orientierte), wertrationale (an inneren Überzeugungen orientierte), traditionale (durch Gewohnheiten und überlieferte Normen bestimmte) und affektuelle (an emotionalen Bindungen orientierte) Handlungen, wobei ‚zweckrational‘ in einem weiteren Sinne allerdings jedes Handeln ist.
Über solche Einteilungen wurde natürlich heftig gestritten, etwa wäre es auch möglich, zwischen automatisch-spontanem und reflektiert-kalkulierendem Handeln zu unterscheiden. Man könnte auch darauf verweisen, dass Handlungen nie isoliert vorkommen, sondern stets in ‚Praktiken‘ eingebettet, d. h. in typisierte, routinisierte und deshalb im sozialen Zusammenhang auch verstehbare ‚Aktivitätsbündel‘. Schließlich kann man Handlungen auch in erster Linie unter ökonomischen Perspektiven untersuchen, wie dies etwa in der Rational-Choice-Theorie oder in spieltheoretischen oder auch tauschtheoretischen Ansätzen geschieht, von denen sich wiederum die soziologischen Theorien etwa aus den Gebieten der phänomenologischen Soziologie, des symbolischen Interaktionismus oder auch der strukturell-funktionalen Theorie [<<48] unterscheiden lassen. Glücklicherweise müssen wir uns mit diesen Details der soziologischen Handlungstheorie nicht näher beschäftigen.
Aber mit der Besonderheit von Handlungen aus der Tradition des philosophischen Denkens müssen wir uns beschäftigen, wenn wir verstehen wollen, wie Habermas seine Theorie eines Handelns ausarbeitet und begründet, das kommunikativ und d. h. verständigungsorientiert ist. Dieses Handeln ist zentral für sein ganzes Denken, sei es unter philosophischer, soziologischer oder politiktheoretischer Perspektive. Aus der vorstehenden Erinnerung an einige soziologische Gedanken über die Besonderheit von Handlungen ist bereits deutlich geworden, dass es naheliegt, sich hier mit philosophischen Gedankengängen zu beschäftigen, etwa in Zusammenhang mit dem ‚Sinn‘ von Handlungen, aus der Zuschreibung von Motiven und/oder Gründen, in Bezug auf die Subjektivität oder/und Intersubjektivität von Handlungen sowie durch die Struktur eines – sprachlichen – Bewusstseins von sich selbst, das einem Handelnden zugeschrieben werden muss, wenn er von jemandem unterschieden werden soll, der sich nur verhält, wie wir dies auch von Tieren sagen können. Und am besten beginnen wir mit Aristoteles, den wir als maßgebenden Begründer einer Philosophie der ‚Praxis‘ auffassen können.
2.2 Die Besonderheit von ‚Handlungen‘
2.2.1 Aristoteles: praxis und poiesis
Den Begriff der ‚Praxis‘ verwenden wir im Alltag heute meist nicht so, wie es in der Philosophie seit ihren Anfängen der Fall war. Wir pflegen ihn der ‚Theorie‘ entgegenzusetzen, wenn wir etwa sagen, was man in der Theorie gelernt habe, müsse man schließlich in die Praxis umsetzen können, wie der Arzt, der im Medizinstudium die Theorie kennen gelernt hat, schließlich eine Praxis eröffnet, um sein Wissen in der Behandlung von Patienten bzw. deren Leiden praktisch zu verwenden. Am Anfang der Philosophie wurde die Bedeutung von praxis jedoch durch die Entgegensetzung zu poiesis bestimmt. Poiesis hieß bei Aristoteles generell dasjenige menschliche Tun, das einem bestimmten Zweck dient. Dabei stellen sich in erster Linie Fragen nach dem ‚richtigen‘ Einsatz von Mitteln für gegebene Zwecke. Es handelt sich also um die Frage nach der richtigen Technik.
Wenn man jedoch den optimalen Einsatz gegebener Mittel hinzunimmt, der erfolgt, um möglichst viel zu erreichen, dann könnte man die entscheidende Frage in Bezug auf die poiesis auch als eine ökonomische auffassen. Was bedeutet ‚richtig‘ in diesem [<<49] Zusammenhang? ‚Richtig‘ ist ein ‚poietisches‘ Tun offenbar dann, wenn es rational in dem Sinne ist, den wir in der Technik oder der Ökonomie verwenden. Es ist technisch-rational, wenn wir die für einen gegebenen Zweck geeigneten Mittel einsetzen und nicht versuchen, Schrauben mit einem Hammer einzusetzen. Es ist ökonomisch-rational, wenn wir die kostengünstigsten Mittel für ein gegebenes Ziel einsetzen oder mit den gegebenen Mitteln den höchstmöglichen Ertrag erzielen.
Mit dem Begriff der praxis dagegen nahm Aristoteles eine ganz andere Perspektive auf das menschliche Tun ein, und er behauptete, dass diese Perspektive gerade für das Besondere des Menschen entscheidend sei. Hier folgt ihm Habermas ganz und gar, auch wenn dieser schließlich andere und weit kompliziertere Mittel einsetzt, um diese Behauptung zu begründen und auszuarbeiten. Unter dieser Perspektive wird generell nach einem inhärenten Sinn eines menschlichen Tuns gefragt, also nicht danach, welchen Sinn es hat in Bezug auf damit zu erreichende Zwecke, sondern ‚in sich selbst‘ und ‚aus sich selbst‘. Eine Lüge kann technisch und ökonomisch das adäquate Mittel darstellen, um einen bestimmten Vorteil zu erreichen, und insofern ‚richtig‘ sein. Aber kann man auch sagen, sie sei ‚richtig‘, weil sie in ihrem eigenen Sinn ‚richtig‘ ist?
Ein solcher Sinn hat bei Aristoteles stets mit einem Ziel zu tun, d. h., ein menschliches Tun gewinnt einen inhärenten Sinn, weil es auf ein Ziel bezogen ist – was von einem Zweck zu unterscheiden ist. Die praxis im aristotelischen Sinn ist finalisiert. Von einer Orientierung an Zwecken unterscheidet das Tun sich nun deshalb, weil die verschiedenen Zwecke, für die wir technisch oder ökonomisch geeignete Mittel einsetzen und uns in diesem Sinne ‚rational‘ verhalten, selbst kein Ziel in sich selbst darstellen. Den Hammer verwenden wir, um einen Nagel einzuschlagen, der Nagel aber ist selbst kein Ziel in sich selbst, sondern soll ein Bild tragen, das aufgehängt zu haben wiederum nicht in sich selbst ein Ziel ist, sondern wieder ein Mittel für etwas anderes darstellt – sei es die Verschönerung der Wand, die Selbstdarstellung des Wandbesitzers als eines Kulturmenschen oder was auch immer. In der poiesis gelangen wir deshalb an kein Ende, weil Zwecke immer wieder selbst zu Mitteln werden.
Die praxis im aristotelischen Sinn dagegen hat es mit dem Ziel zu tun, man könnte auch sagen: mit dem Ziel. Damit schließt sich die aristotelische Auffassung von praxis zusammen mit der Vorstellung von einem letzten Ziel alles Tuns im menschlichen Leben, also mit einem Zweck, der selbst nicht mehr zum Mittel wird, weil er sich in sich selbst erfüllt. Hier schließt sich Aristoteles an den zentralen Begriff der platonischen Philosophie an, obwohl er ihn auch charakteristisch verändert. Dieses Ziel ist das gute Leben. Anders als Platon sucht Aristoteles aber nicht, dieses Ziel aus einer Idee des Guten abzuleiten, die unveränderlich und als ewige Wahrheit feststehen würde. [<<50] ‚Gut‘ ist das Leben deshalb, weil es in einer polis gelebt wird, d. h. im sozialen Zusammenhang und in der Interaktion mit anderen Menschen, womit wir wieder bei einem zentralen Gedankengang von Habermas angelangt sind. Auch hier wird dieser aber ganz andere Mittel einsetzen, um diesen Gedanken näher auszuarbeiten.
Es ist deutlich, dass die Perspektive auf die praxis des menschlichen Tuns bei Aristoteles den Anfang dessen darstellt, was wir bis heute als Ethik oder eben auch als praktische Philosophie bezeichnen. Der Begriff der Handlung als eines speziellen Tuns des Menschen, das ihn eben speziell als Menschen auszeichnet, ist damit als Teil der Ethik ausgezeichnet. Nach Aristoteles können wir also die Frage, was Handeln heißt, nicht von der Frage trennen, was gutes Handeln heißt. Handlungsphilosophie ist damit praktische Philosophie.
Die praktische Philosophie benötigt einen solchen Begriff des menschlichen Tuns, weil sie ohne ihn ihren Gegenstand verlieren würde, d. h. kein Thema hätte, würde sie sich mit der technischen und/oder ökonomischen Eignung von Mitteln für Zwecke beschäftigen. Aber nach dieser Weichenstellung kann ein Begriff des Handelns auch nur innerhalb der Ethik diskutiert werden, weil ohne die Frage nach der ethischen Richtigkeit des Handelns überhaupt kein solches Konzept ausgearbeitet werden kann und menschliches Tun dann nur unter der Perspektive der poiesis verstanden werden müsste, d. h., ohne dass wir uns über die Suche nach geeigneten Mittel-Zweck-Beziehungen hinaus noch mit der Frage beschäftigen könnten, welche Ziele mit solchen Beziehungen überhaupt verfolgt werden.
Die praxis ist bei Aristoteles darüber hinaus der Bereich, in dem keine Notwendigkeit bzw. Unveränderlichkeit herrscht, sondern von ihr ist nur dann die Rede, wenn etwas auch anders sein könnte. Diese Charakterisierung hat die praxis allerdings mit der poiesis gemeinsam, schließlich könnte man nicht planen, einen Tisch herzustellen, wenn der Tisch notwendig existieren würde oder wenn er notwendig nicht existieren könnte. Aber das Ziel der Tätigkeit unterscheidet praxis und poiesis voneinander. Die poiesis ist dadurch bestimmt, dass in ihr ein Ziel außerhalb der Tätigkeit selbst angestrebt wird: Die Tätigkeit der Herstellung eines Tisches wird unternommen, damit der Tisch schließlich dasteht und verwendet werden kann. In der praxis dagegen ist das Ziel bereits in der Tätigkeit selbst vorhanden. Deshalb ist der Beurteilungsmaßstab für die Güte der Handlung in der poiesis die Qualität des Hergestellten, d. h. seine Eignung für den angestrebten Zweck. Die praxis zu beurteilen ist dagegen weit schwieriger. Hier muss man allerdings beachten, dass Aristoteles es bisweilen mit seiner Terminologie nicht so genau nimmt. Bisweilen kommt man bei der Lektüre nicht darum herum, den Begriff der praxis ganz allgemein im Sinne eines Handelns aufzufassen, an anderen Stellen dagegen wird deutlich, dass dieser [<<51] Begriff nicht von dem der ‚Tugend‘ und damit von dem, was wir ‚gut‘ nennen können, abgetrennt verwendet wird.
Eine tugendhafte – ‚gute‘ – praxis ist nicht durch ihr Ergebnis charakterisiert, sondern durch die Art des Handelns selbst. Aristoteles drückt das so aus, dass dann ‚gut‘ gehandelt wird, wenn der Handelnde in einer bestimmten Verfassung handelt, und diese Verfassung wird näher so sein müssen: (a) Es muss ‚wissend‘ (bewusst) gehandelt werden; (b) es muss vorsätzlich, und zwar um der Handlung selbst willen, gehandelt werden, d. h., der Handelnde muss sich entschieden haben (Aristoteles spricht hier von prohairesis, was man mit Vorsatz, Entscheidung oder Wahl übersetzen kann); (c) es muss aus einer festen Disposition heraus gehandelt werden (Nikomachische Ethik 1105a28–1105b9). Wer so handelt, kann also nicht ‚Unwissen‘ als Entschuldigung geltend machen, er hat aber auch nicht Zwang und Gewalt als Grund dafür anzugeben, dass die Handlung eigentlich nicht von ihm stammt und ihm nicht zuzuschreiben ist.
Für die philosophische Theorie des Handelns wurde dabei besonders der Aspekt der Entscheidung bzw. der Wahl oder auch des Vorsatzes (prohairesis) wichtig. Ein solches Entscheiden liegt dann vor, wenn wir mit ‚Überlegung‘ nach solchen Dingen ‚streben‘, die auch tatsächlich in unserer Macht stehen (Nikomachische Ethik 1113a9ff.). Es geht um ein ‚Streben‘ bzw. ‚Erstreben‘ in der Wirklichkeit des Lebens, nicht um Phantasien und nicht um bloßes Wünschen, das nicht zu der Bemühung um Realisierung in der wirklichen Welt führt. Deshalb wird auch das ‚realistische‘ Streben in die Definition aufgenommen – würden wir nach etwas streben, das nicht in unserer Macht steht, so bliebe es bei einem bloßen Wünschen. Auch hier gewinnt das Wissen seine Bedeutung für das Vorliegen einer Handlung, die als ‚gut‘ oder ‚schlecht‘ (richtig oder falsch) bezeichnet werden kann. Darüber hinaus ist offenbar die Motivation entscheidend für die Frage, ob wir es mit praxis oder mit poiesis zu tun haben. Tun wir etwas um externer Güter willen, so kann eine Handlung, die ‚gut‘ oder ‚schlecht‘ sein kann, nicht vorliegen, sie muss also aus intrinsischen Gründen vorgenommen werden. Die Bedingung (c) verlangt, dass eine stabile Handlungstendenz in einem Menschen vorliegen muss, um sagen zu können, dass er tugendhaft handelt.
Die Schwierigkeit des aristotelischen Begriffes der praxis liegt darin, dass er nicht sehr präzis ist. Er ist weitgehend durch die Abgrenzung von der theoria einerseits und von der poiesis andererseits charakterisiert und lässt schon deshalb viele Fragen offen, die für die spätere philosophische Fragestellung bezüglich des Handelns und seiner Bedeutung für das menschliche Selbstverständnis wichtig geworden sind. Nichtsdestoweniger hat dieser Begriff doch entscheidende Weichen für die Auffassung eines besonderen Bereichs im menschlichen Verhalten gestellt, der sich vom einfachen Verhalten dadurch unterscheidet, dass er sich auf einen Raum des Möglichen und [<<52] Veränderlichen bezieht und dass er nicht – oder zumindest nicht vollständig – durch den damit unmittelbar angestrebten Zweck bestimmt wird, sondern das Ziel hier in der Tätigkeit selbst enthalten ist, so dass das Handeln dem Freiheitsbereich des Menschen zugeordnet werden kann. Ein solches Handeln ist also nicht – zumindest nicht vollständig – von seinem Ziel her bestimmt, und es genügt nicht, wenn wir das Ziel kennen und im Verhalten die Anwendung geeigneter Mittel entdeckt haben, um von praxis sprechen zu können.
Nach der aristotelischen Bestimmung der Handlung verbinden sich in einer Handlung, die der praxis angehört, die menschliche Freiheit, die Fähigkeit, Absichten zu verfolgen, und die Fähigkeit, solche Absichten um des ‚Richtigen‘ willen zu verfolgen (und nicht, um Ziele außerhalb der Handlung zu erreichen). Die Handlung der praxis ist deshalb im Unterschied zu derjenigen der poiesis diejenige, in der sich das zeigt, was den Menschen in seiner wesentlichen Unterscheidung von allen anderen Lebewesen offenbart. Das war für Aristoteles die Fähigkeit, ‚tugendhaft‘ handeln zu können – wir könnten auch sagen: aus freier Entscheidung und orientiert an Regeln, aufgrund derer eine solche Handlung als ‚richtig‘ in einem Sinne bezeichnet werden kann, der über die technische Angemessenheit des Einsatzes von Mitteln für gegebene Zwecke hinausgeht.
Wer mit der kantischen Ethik vertraut ist, der wird hier schon eine Vordeutung auf deren zentrale Unterscheidung zwischen hypothetischen und kategorischen Urteilen erkennen. Hypothetische Urteile beschreiben die Wenn-dann-Struktur vieler Handlungsanweisungen: Wenn du einen Gegenstand mit einer Schraube befestigen willst, dann solltest du einen Schraubenzieher benutzen. Darin ist keine moralische Regel und kein entsprechendes Urteil enthalten. Ein kategorisches Urteil mit einem Sollen dagegen setzt nicht ein erwünschtes Ziel mit einem geeigneten Mittel in Beziehung, sondern beurteilt das Handeln (bei Kant eigentlich die Willensentscheidung bzw. den Handlungsvorsatz) mithilfe des Prinzips der Verallgemeinerbarkeit (Universalisierbarkeit) nach dem kategorischen Imperativ. Eine solche allgemeine Regel kannte Aristoteles allerdings nicht. In seinem Denken bezieht sich die ‚Richtigkeit‘ eines Handelns in der praxis auf das ‚gute Leben‘, das wir nur in der polis führen können, weshalb die herrschenden Vorstellungen über das ‚Richtige‘ in der polis eine entscheidende Bedeutung für die moralische Beurteilung einer Handlung und damit für ihren praktischen Charakter besitzen.
In diesem Zusammenhang ist noch ein zentrales Charakteristikum der aristotelischen Handlungskonzeption von Bedeutung. Wir haben schon gesehen, dass für die ‚tugendhafte‘ Handlung, die wir unter der Perspektive ihrer moralischen Richtigkeit und nicht unter der ihrer technischen Erfolgswahrscheinlichkeit beurteilen, auch die Bedingung wichtig ist, dass sie aus einer ‚stabilen Haltung‘ heraus erfolgt, die auf den [<<53] ‚Charakter‘ als die Disposition zu einer bestimmten Handlungsorientierung zurückgeht. In der moralisch relevanten, freiwilligen, bewussten und vorsätzlichen Handlung kommt zum Ausdruck, was bzw. wer der Handelnde ist.
Das geht auf den Gedanken zurück, dass nur das mit Überlegung geschehende und vernünftige Handeln die Grundsätze und allgemeinen Einstellungen des betreffenden Menschen zum Ausdruck bringt, während ein Handeln im Affekt weniger Beziehung zu dem hat, was ein Mensch ist bzw. zu was er sich gemacht hat. Aus dieser Perspektive sind wir weniger durch das charakterisiert, was wir vor einem vernünftigen Stellungnehmen oder außerhalb eines solchen wollen, sondern mehr durch das, was wir mit Entscheidung, Vorsatz und Überlegung wollen. Darin ist die moralisch relevante Handlung zu finden, mit der wir für uns selbst und in der polis demonstrieren, wer wir sind und wie man uns aufzufassen hat.
Das bedeutet allerdings keineswegs, dass das Handeln durch den ‚Charakter‘ als die Disposition zu einem bestimmten Handeln erklärt werden soll, was der Freiheit und der Willensentscheidung als Kriterien des moralischen Handelns gerade widersprechen würde. Das Handeln als Demonstration der ‚Persönlichkeit‘ und der ‚stabilen Haltung‘ des Menschen soll keineswegs die Verantwortlichkeit und damit die freiheitliche Grundlage des Handelns ausschließen. Wir können uns hier vielmehr eine Art von Wechselverhältnis vorstellen. Die einzelnen Handlungen des Menschen formen seine weiteren Dispositionen zum Handeln, und diese Dispositionen lenken die Bestimmung seiner Handlungen. Was wir heute als ‚Charakter‘ bezeichnen würden, stellt sich für Aristoteles also dar als etwas, das wir selbst gemacht haben, obwohl wir dabei auch Handlungstendenzen berücksichtigen müssen, über die wir nicht frei verfügen können. Solche Neigungen aber formen wir mit jeder Entscheidung über eine Handlung weiter aus, oder wir korrigieren sie und lenken sie in eine andere Richtung. Der Zusammenhang von Handeln mit Dispositionen zu bestimmten Handlungsweisen soll nach Aristoteles also keineswegs die Freiheit in der Willensentscheidung und damit den Vorsatz beim Handeln ausschließen.