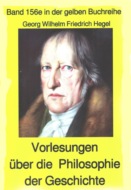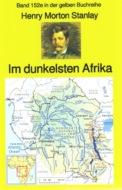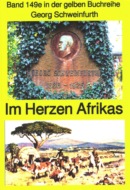Kitabı oku: «Georg Schweinfurth: Afrikanisches Skizzenbuch», sayfa 3
Abgesehen von den großen, ihm ein so abenteuerliches, fast fledermausartiges Aussehen erteilenden Lauschern, deren Länge von der Wurzel bis zur Spitze genau der Totallänge des Kopfes gleichkommt, und den besonders zierlichen, fein bepfoteten Füßchen, scheint der Fennek in keinem wesentlichen Stücke vom Gattungscharakter des Fuchses abzuweichen. Seine ganze Länge erreicht kaum zwei Fuß, und davon gehen acht Zoll für die Standarte ab. Die oben an der Basis des Schwanzes bei allen Füchsen vorhandene Drüse, die sogenannte Viole, duftet beim Fennek nach Rosen und ist durch einen schwarzen Schattenring markiert. Viele Naturforscher haben in der ovalen Gestalt der Pupille einen Unterschied von den übrigen Füchsen nachzuweisen gesucht. Der Berliner Zoologische Garten gab nach genauer Untersuchung der Fenneks sein Urteil dahin ab, dass ihre Augen, wenn man sie dem Sonnenlicht aussetzt, eine ebenso spaltförmige Pupille erkennen lassen, wie die des Fuchses, nur sei die kastanienbraune Iris nicht am Rande, sondern gegen die Mitte zu tiefer gebräunt, wodurch der Eindruck einer rundlichen Pupille hervorgerufen werde.
Die Färbung des Fennek-Balges ist in ihren Nuancen ebenso zart wie die feine Gliederung der feinen Gestalt. Strohgelblich, etwas ockerig auf der ganzen Oberseite, Kopf und Lauscher mit inbegriffen, spielt sie mehr oder minder in jene frische Sandfarbe hinüber, die man isabellgelb nennt; die Beine, sowie die ganze Unterseite des Körpers, mit Ausnahme der Standarte, sind vom reinsten Weiß. Jüngere, nicht die älteren, Individuen sind am ganzen Körper um mehrere Schatten heller, fast weißlich. Der Balg ist wie von Seide und füllt sich zur Winterzeit mit dichtem Wollhaar, wodurch das Fleckige und Buschige des Pelzes noch mehr in die Augen tritt. In manchen Gegenden nennen die Araber daher auch den Fennek „Abu Ssuf“, d. h. Vater der Wolle. „Alles, was aus der Wüste kommt,“ sagt der Araber, „ist zierlich und nett“, nichts aber in der Welt gibt uns eine Vorstellung von jener Zartheit und Reinheit eines frisch eingefangenen Fennek, es sei denn, dass sich der Vergleich an kunstvoll gewaschene Straußenfedern halte oder an den leichten Flaum des Marabu. Diesem weichlichen Kleide entspricht auch der hohe Grad von Empfindlichkeit, welchen das Tier gegen Kälte äußert. Nach besonders kalten und stürmischen Winternächten fehlte auf den vom Nordwinde frischgefegten Sandflächen jegliche Fennek-Spur; das Tier hungert lieber in den warmen Löchern, die es sich nach Art der Füchse gräbt, als dass es seinen zarten Körper der Unbill des Wetters preisgäbe.
Sehr mannigfaltig ist, je nach der Jahreszeit, die Nahrung des Fennek. In der eigentlichen Wüste sind es zunächst die Eidechsen, welche sich fast überall aufspüren lassen und vom Fennek stets mit großer Gier gefressen werden. Von mehr lokaler Verbreitung sind die eigentlich als die Basis der Fennek-Existenz anzusehenden Wüstenmäuse. Gelegentlich bietet sich dem Fennek ein besonders fetter Bissen in den Flughühnern und Wüstenlerchen, wenn er ihren nächtlichen Ruheplatz zu erspähen vermag; dazu kommt noch das ganze Heer von Zugvögeln, deren Auswurfstoffe ja gewiss auch, wie die der Kamele auf der Heerstraße, einen bedeutenden Zuschuss zum Haushalte der niederen Wüstentierwelt liefern mögen, ein Umstand, welcher, zieht man die Menge der im Frühjahre und Herbste die stille Öde der Wüstenflugbahn bevorzugenden, zum Teil sehr großleibigen Passanten in Betracht, von nicht zu unterschätzender Bedeutung erscheint und die Möglichkeit mancher sonst rätselhaften Wüstenexistenz zu erklären vermag.
Heuschreckenschwärme, welche nicht selten die Oase heimsuchen, gewähren dem Fennek eine erwünschte Abwechslung in der Kost. Die stellenweise so häufigen großen Wüstenkäfer aber lässt er stets unberührt, obgleich er die zum Teil so hart gepanzerten Eidechsen mit Stumpf und Stil zu verzehren pflegt. Im Falle der Not, so behaupten die Bewohner, soll der Fennek sogar zu den Fröschen seine Zuflucht nehmen, deren es in den zahlreichen Tümpeln und Pfützen der Oase eine Menge gibt. Seine blutdürstige Fuchsnatur bekundet aber der Fennek vornehmlich im Beschleichen des zahmen Federviehs. Er schrickt selbst vor halbwüchsigen Truthühnern nicht zurück. Beim Blutsaugen befolgt er ein eigenes Verfahren. Mit seinen nadelscharfen, kleinen Zähnen vermag er sich so festzubeißen, dass ich ihn manchmal an den Fingern eines von ihm Gebissenen hängen bleiben sah, bis ihn die Kraft des menschlichen Armes von sich schleuderte. Jedes Geflügel wird vom Wüstenfuchs entweder an der Brust oder am Rücken gepackt, alsdann saugt er trotz alles Zappelns und Flügelschlagens demselben das Blut aus. Man hat mir dutzendweise die Leichen der so Hingemordeten gebracht, immer war an ihnen der Hals unversehrt, und nur einige feine Löcher am Rumpfe verrieten die Todesart. Der Vernichtungskampf, welcher neben den Nilfüchsen, die stellenweise daselbst ebenfalls von außerordentlicher Häufigkeit sind, von den Fenneks allen Hühnern und Tauben der Großen Oase bereitet wird, ist in der Tat so groß, dass die Einwohner von der tückischen Begabung dieser unabwehrlichen Räuber die übertriebensten Vorstellungen haben.
Als kurz nach der Zeit, da mir eine große Zahl eingefangener Fenneks wieder entwichen war, ihre nächtlichen Angriffe auf das Geflügel der Ortschaft zufällig sich vermehrt hatten, schrieben die Oasenbewohner es dem Umstande zu, dass die Flüchtlinge ihren Brüdern in der Wüste den Weg zur Stadt gezeigt hätten; ihr Schaden, meinten sie, sei nun größer, als der bei dem Fange der Fenneks ihnen aus meiner Kasse zugeflossene Gewinn. Jede Jahreszeit bietet in der Oase den Raubtieren eine andere Art Futter dar, auch an vegetabilischer Kost, wie sie ihnen erwünscht ist, fehlt es nicht.
Vom Nilfuchse behaupten die Einwohner, dass er zur Erntezeit die Weizenfelder bestehle. Vom Wüstenwolf ist es allgemein bekannt, dass er ihnen zur Sommerszeit die Gurken und Melonen wegfrisst, alle diese Tiere aber scheinen der Dattelfrucht vor allen anderen Leckerbissen den Vorzug zu geben, und gewiss nicht der letzte dabei ist der Fennek. Seine Vorliebe für Datteln gab zur Entstehung des Märchens Veranlassung, dass er auf Bäumen lebe und sich Nester baue; es hieß, er klettere so gewandt wie eine Katze – dergleichen Unglaubliches mehr wurde von seinen Lebensgewohnheiten berichtet. Die im August beginnende Dattelernte ist daher eine Zeit der Feste für diese Tiere, und die überall in den öden Felstälern des östlichen Oasenrandes zerstreut umherliegenden Dattelkerne legen Zeugnis ab von dem Überfluss jener Tage.
* * *
Fünf Tage in die unzugängliche Bergwildnis am Roten Meer – Ein Reise-Brief
Fünf Tage in die unzugängliche Bergwildnis am Roten Meer – Ein Reise-Brief
Meine im Januar 1865 ausgeführte Reise durch die Wüste von Keneh bis Kosser glich einem angenehmen Spaziergang bei uns in der Frühlingszeit. Botanische Sammlungen wurden nicht viel gemacht, da die Vegetation noch sehr im Rückstande war. Die überall massenhaft auftretende Zilla, die zweijährige Kruzifere, die arabisch „Silli“ heißt, und von der die vorjährigen Stauden alle in Blüte standen, bedingt hauptsächlich das üppige Grün, in das diese Felsentäler gekleidet erscheinen, und bietet den Kamelen eine unerschöpfliche Weide. Wenn wir des Abends unser Lager aufschlugen, da warf ich meine Matte auf die hohen Dorndickichte der Sille und verfiel auf dem elastischen Federpolster, das ich mir solchergestalt bereitet hatte, bald in einen ungestörten erquickenden Schlaf, umfangen von den Träumen der Reise und den roten Blütenmassen der von mir beschriebenen und abgebildeten Pflanzen. Aus dem Schmutz des unerträglichen Nilstaubes so schnell in die reine trockene Wüstennatur versetzt zu werden, die freie Luft dieser Gebirgseinöden einzuatmen, an dem majestätischen Ernst der dunkeln Felsmassen und der feierlichen Ruhe, die überall herrscht, sich zu erbauen, bot mir einen hohen Genuss. Hier begann erst das wahre Reisen, nachdem mich widrige Winde und andere Unannehmlichkeiten so lange im Niltal zurückgehalten hatten. Während dieser Tage lebte ich fast ausschließlich von der Jagd, da ich täglich zahlreiche Felsentauben und zweierlei Steinhühner erlegte, die im Winter häufiger zu sein scheinen, als in den heißeren Monaten. Für denjenigen, der in dieser Jahreszeit vom Nil an das Rote Meer gelangt, erscheint der Wechsel der Temperaturverhältnisse sehr auffallend. Es fehlen nämlich hier die kalten taureichen Nächte, wie sie dem Niltal und namentlich dem begrenzenden Wüstensaum eigentümlich sind; denn die Seeluft, stets bestrebt, alle Unterschiede auszugleichen, verleiht dieser Küste einen milden Winter und einen verhältnismäßig kühlen Sommer, letzteres gilt hauptsächlich für Kosser. Südlich vom Wendekreise greifen natürlich ganz andere Verhältnisse Platz.
Von Kosser aus unternahm ich einen Ausflug zu den südlich gelegenen Gebirgen, dem Gebel (= Berg) Abu Tiur und Gebel Ssubah, die durch ihre schönen blauen Umrisse, die sie am Horizont gewähren, schon früher meine Neugierde aufgestachelt hatten. Ich mietete mir einen Abadi (Eingeborenen) und ein Kamel und trat so die gemütliche Wanderung an. Mein nächstes Ziel war der Brunnen Hendosse, der 5 deutsche Meilen in SSW von Kosser gelegen ist. Die botanische Ausbeute während dieser Tour war zwar keine reiche zu nennen, sie bot mir indes mancherlei neue Gesichtspunkte und bereicherte immerhin meine Sammlungen mit neuen Formen und schönen Exemplaren. Hier in den dem Meere näher gelegenen Gebirgen war übrigens die Vegetation um wenigstens einen Monat vor derjenigen der Wüste voraus.
Am 21. Januar verließ ich gegen Mittag Kosser und wandte mich südwärts, die einförmige Küstenebene durchschneidend. Nach einem langsamen Marsch von 20 Minuten betraten wir das durch flache diluviale Nagelfluhfelsen begrenzte Uadi Murssefa, in dem wir 45 Minuten langsam nach Südwest zogen. Dann verengt sich das Uadi (= Tal), das mit einer ziemlich dichten Vegetation von Zygophyllum bekleidet erscheint, und in dem man zwischen wild zerklüfteten etwa 60 Fuß hohen Kalkfelsen 10 Minuten nach Süden geht. In einem offenen Uadi geht es alsdann weitere 10 Minuten nach Südwest auf eine Kette dunkler Vorgebirge zu.
Indem der Pfad ansteigt, durchziehen wir 20 Minuten stark marschierend ein rechts durch Sandsteinfelsen, links durch roten Granit eng begrenztes Tal. Späterhin folgt rechts ein niederer Hügelzug von schwarzem Diorit. Von 100–150 Fuß hohen Hügeln begrenzt, die rechts aus Diorit, links aus Granit bestehen, verbreitert sich das Tal in südlicher Richtung 15 Minuten weit und senkt sich alsdann, zur Linken verflachte Felsen des gleichsam schlackigen durchlöcherten Korallenkalk der Meeresküste zeigend, 10 Minuten lang gegen SSW.
Abwärts steigend, durchschneidet man weiterhin eine Fläche auf die Gebirge nach Süden zu gehend. Ein von schwarzen Dioritfelsen eng eingeschlossenes Tal beginnt, dessen Rinnsal durch zahlreiche umherrankende Koloquinten, die überreich mit Früchten behangen, geziert erscheint. 35 Minuten marschiert man stark durch das anfangs nach Südwest, dann etwas Ost, Südwest und West gewundene Tal, wo einige Seyalbäumchen (Acacia tortilis D.) auftreten. Steilabfallende 100 Fuß hohe Wände von grünlichem Glimmerschiefer bilden die Hauptmasse des Gesteins. Süd zu West, dann WSW, W, S zu W, und schließlich WSW gehend, marschiert man 30 Minuten weiter allmählich ansteigend. Sille-Vegetation tritt zum ersten Male hier auf und verzögert den Marsch des hungrigen Tiers. Dieses Uadi-System wird von den Leuten als Uadi Sireb bezeichnet. Das letzte ausgeprägte Tal verlassend, das sich weiter in WSW hinzieht, marschiert man alsdann südwärts in einem kleinen ansteigenden Uadi, wo sich der Abu Tiur zuerst den Blicken darstellt. Rechts zeigt sich der Gebel Ssubah oder Ssubaï, der „Fingerberg“, so benannt wegen der zahlreichen Zacken, die sein langhingestreckter Kamm trägt. Späterhin taucht in sehr weiter Ferne noch der Gebel Schedit im äußersten Links auf. 30 Minuten in S zu W und stets ansteigend durchwandert man diese Seitentäler und geht abwechselnd S und SW noch 35 Minuten durch unregelmäßige Diorithügel weiter, bis man einen weithin gekennzeichneten hellen Hügelrücken von der Eozän-Formation vor sich hat, abwärts steigend auf dem letzten Teil des Marsches.
In dem eine Viertelstunde breiten von SO nach NW verlaufenden Uadi Abu Tundub, so benannt wegen der in ihm auftretenden Capparis decidua lagerten wir bei einigen Seyalbäumchen und trafen an dieser Stelle die für Kosser bestimmte tägliche Wasserkarawane, die nachmittags von Hendosse ausgehend des Morgens in der Stadt anlangt. Die Nachtluft war milde und taufrei, erst vor Sonnenaufgang weckte mich eine empfindliche Kühle.
22. Januar. In 15 Minuten wurde das Tal in SSW gekreuzt und der Beginn eines zwischen roten Felsithügeln mündenden Uadis betreten, in dem stark ansteigend und zwischen engen Felsen jede paar Schritte gewunden der Pfad sich in südlicher und südöstlicher Richtung 20 Minuten weit fortzieht.
Nun stößt man auf ein anderes breites Uadi, das in 30 Minuten starken Marsches nach SW durchzogen wird. Seyalbäume, Marchgebüsch – March (Leptadenia pyrotechnica Desn.), ein Staudengewächs. – und einzelne Granithügel boten sich an mehreren Stellen meinen Blicken dar. Nach weiteren 30 Minuten nach SSW zu erreicht man zwischen 150 Fuß hohen Felsithügeln das Ende des Uadi, übersteigt einen kleinen Kamm und betritt ein anderes sehr breites Tal, das man in der gleichen Richtung in 55 Minuten starken Marsches durchschneidet.

Ababda im Wadi Um Ghamis
Dies ist das Uadi Hendosse, und man befindet sich nun bei fünf jener kleiner erbärmlichen Mattenzelte, unter denen die Ababde ihren ganzen Hausstand zu bergen pflegen.
Eine Viertelstunde weiter befindet sich der Wasserplatz, den man erreicht, indem man zuerst gegen SW, dann nach W einbiegt, dann stößt man auf eine enge, von hohen Glimmerschieferfelsen eingeschlossene Schlucht, in der das Wasser wie ein Bächlein zwischen den kolossalen Steinblöcken hinrieselt. Es ist klar und rein, besitzt jedoch einen schwachen Mineralgeschmack, auch sprechen leichte Efflorationen, mit denen in der Nähe der Boden stellenweise überdeckt erscheint, für den Salzgehalt des vom Wasser durchronnenen Terrains. Indem es nämlich seinen Ursprung von dem weiter südlich gelegenen Gebel Ssubah nimmt, sickert es unter der die Talsohle bedeckenden Schicht zersetzten Granitschuttes auf der dichten Unterlage von Glimmerschiefer durch bis zu der beschriebenen Schlucht, wo es auf den entkleideten Felsen zutage tritt, und alsbald wieder in gleicher Weise, wie es gekommen, sich den Blicken entzieht. Ein anderer Wasserplatz, der hauptsächlich Kosser mit Trinkwasser versorgt, ist der südwestlich von der Stadt 12 Stunden entfernte Brunnen Derfaui, dessen Wasser noch besser und reiner und nach den Angaben der Leute in solcher Menge vorhanden sein soll, dass nicht 5 regenlose Winter hinreichen würden, um es versiegen zu lassen. Hendosse liegt näher zu Kosser und ist von Derfaui östlich so weit entfernt, dass die Tour dahin einen Tag vom Morgen bis zum Nachmittag in Anspruch nehmen würde. Ein mittelmäßig großer Schlauch mit Wasser kostet selbst in jetziger Jahreszeit in Kosser immer noch 5 Piaster Courr., obgleich gegenwärtig alle Brunnen reichlich gefüllt sind, da erst vor wenigen Wochen ein wiederholter Regen in den Bergen am Roten Meer niederstürzte. Am 4. Januar gewahre ich des Abends in Keneh, dass der Himmel gegen W auffallend trüber und bewölkt erschien, ich dachte mir gleich, dass es in jenen Bergen regnen müsse. Am andern Tage stürzte sich nach Sonnenuntergang 6 Stunden lang eine große Wassermasse in den Nil, zu dem es von der Stärke eines großen Baches durch eine der Wüstenrinnsale abfloss. Die durch den diesjährigen niederen Wasserstand des Nils sehr bedrängten Fellachen benutzten dieses Rinnsal und arbeiteten bei Nacht an Dämmungen und Gräben, um das Wasser auf ihre Felder zu leiten. Man erzählte mir, dass auf diese Art große Kanäle gefüllt worden seien, in denen man diesen Wasservorrat aufgestaut hat.
Ich rastete nun in der schattigen Felsschlucht, in der man geschützt vor den stechenden Strahlen der Mittagssonne den erquickenden Hauch des rieselnden Wassers und eine sehr behagliche frische Temperatur genießt. Felstauben, Flughühner (Pterocles quadricinctus) und Steinhühner (Perdix Hayi), die hurtig und gackernd auf den Felsen umhereilen, fanden sich ein, und boten mir reiche Küchenvorräte. An solchen Stellen ist nichts leichter als die Jagd, da man nur zu warten braucht, um die sichere Beute zu erhaschen. Wenn man durch die stufenförmigen Felsblöcke, in denen das Wasser fließt, hinaufklettert, erreicht man nach kurzer Zeit die Öffnung der Schlucht auf der Südseite, wo man ein von den 4.500 Fuß hohen Berge Ssubah herunterkommendes gewundenes Uadi betritt. Hier überraschte mich eine stellenweise sehr üppige Vegetation, die bereits in dieser noch wenig entwickelten Jahreszeit 30 Arten blühender Gewächse darbot.
Den schönsten Schmuck gab die Lavandula und der zwischen üppigen Lyciumgebüsch und an Moringabäumen emporstrebende Ochradenus ab. Über die Üppigkeit des Lotus arabicus L., der mit 3 Fuß langen Trieben in dem Schatten des Gesträuches emporschießt, musste ich staunen; auch hier hält man ihn, namentlich für die Schafe schädlich, am Nil wird er geradezu als giftig betrachtet und die Leute sind einfältig genug, ihm die Entstehung der letzten Viehseuche zuzuschreiben. Balanites sah ich an der ganzen Küste bis zum Abu-Tiur-Gebirge nirgends, hier begegnete mir zuerst ein Bäumchen. Zwischen den Felsblöcken fand sich ein großes Horn vom Steinbock, der nach dem Aussagen der Ababde selten vorzukommen scheint, von dem ich indes gleiche Reste an allen Brunnen der bereisten Küste gefunden habe. Hasen sind in dieser Gegend sehr selten, sie halten sich hauptsächlich an die Verbreitung des Tundubs, dessen Beeren und junge Triebe sie mit Vorliebe verzehren.
Der Viehstand der in diesen Einöden hausenden Ababde ist sehr gering und besteht ausschließlich aus elenden Ziegen, die selbst bei der gegenwärtigen Üppigkeit der Vegetation mager erschienen, denn die einjährigen Kräuter, die sie bevorzugen, waren noch nicht gehörig entwickelt. Rinder fehlen natürlich überall und Schafe sind verhältnismäßig selten. Sie gehören der Nilrasse an. Solche mit starren, nicht wolligen Haaren und buschigem Schweif kommen nur aus dem Lande der Bischarin, wo sie äußerst häufig sind, und finden sich auch im Hedschas. Nur das Kamel, das alles zu fressen imstande zu sein scheint, was da wächst und grünt, erfreut sich einer gewissen Wohlhäbigkeit; alle übrigen Geschöpfe, vor allem der Mensch, sind durch eine der gesamten Wüstennatur eigentümliche Dürre gekennzeichnet.
23. Januar gegen Mittag verließ ich den Brunnen und verfolgte von den Hütten der Ababde aus den nach SO abgehenden Arm des Uadi Hendosse, in dem ich nach 30 Minuten zwei Ababde-Hütten antraf. Alsdann verengt sich das Uadi, während die Spitzen des Abu Tiur hervorgucken. Felsen von Gneis und Glimmerschiefer rahmen das schöne Gebirgsbild ein, das dieser Bergkoloss mit seinen 3 majestätischen jäh abstürzenden Zacken darstellt. Nach weiteren 15 Minuten in SSO und SO abwechselnd marschierend, biegt man zur Linken in das große ½ Stunde breite Uadi Abu Tiur ein, während nach S und auf den Gebel Ssubah gerichtet das vorige Tal sich zwischen hohen Vorbergen hin und her gewunden weiter zieht.
In 50 Minuten wurde das breite Uadi nach SO durchzogen, bis wir uns unter der mittleren Spitze des Abu Tiur befanden. Resedastauden von einer Größe und Üppigkeit, als wären sie kultiviert, bedecken die breite Talfläche, die auch nach NO durch eine Kette hoher Vorgebirge begrenzt erscheint. Einige riesige Lassafdickichte (Capparis galeata Fres.) fanden sich voller birnförmiger gelber Früchte, die von der Größe eines Hühnereies breiige Pulpa voller Kerne enthalten, die süßlich und hanfartig schmeckend als Erfrischung wohl genossen werden können. Dieses den Küsten des Roten Meeres eigentümliche Gewächs darf indes nicht mit der den Felsen des Niltals eigenen Capparis aegyptiaca D. verwechselt werden, das auch Lassaf genannt wird, aber völlig abweichend organisiert und ein Zwerg in allen seinen Teilen im Vergleich zu diesem ist. Am Fuß des Abu Tiur fand ich einige Ziegenherden der hier hausenden Ababde, die im Winter und Frühling, solange die Wasservorräte des Berges und die Vegetation es erlauben, hierselbst ihre Herden weiden. An einer Stelle, die durch die Üppigkeit ihrer Staudenvegetation einem künstlichen Garten nicht unähnlich erschien, wurde gelagert, im Schatten von Moringabäumen, die Kasuarinen zum Verwechseln ähnelnd, ihre graziösen Zweige über mich neigten.
24. Januar. Am folgenden Morgen machte ich mich sogleich an die Besteigung des Abu-Tiur, denn in dieser kühlen Jahreszeit hoffte ich endlich einmal ein solches Unternehmen ganz und nicht bloß halb wie während meiner vorjährigen Reise bei mehreren Gelegenheiten bewerkstelligen zu können. Diese Tour bot mir zwar außerordentliche Schwierigkeiten und sehr geringe Resultate, jedoch wenigstens die Befriedigung dar, längst gehegte Wünsche endlich einmal realisiert, und mich von der Beschaffenheit einer solchen Bergspitze überzeugt zu haben.
Um 8 Uhr morgens begann ich das Steigen in einer der sich mir zunächst darbietenden Schluchten südwärts zu der mittelsten und höchsten Spitze des Berges emporstrebend. Ganz unten am Fuße des Berges treten einige Tonschieferfelsen zutage, die ganze übrige Masse des Berges besteht aus einem hellen grobkörnigen Granit, der dieselbe Beschaffenheit besitzt, wie die übrigen von mir bestiegenen südlichen Berge. Mit dem Gebel Ferajeh bei Berenike besitzt der etwa 500 Fuß niedrigere Abu-Tiur (4.000 Fuß) die größte Ähnlichkeit. Hier dieselben jäh abstürzenden Granitplatten, die die Spitzen darstellen, dieselben Riesenblöcke in den Rinnsalen und Schluchten, dieselbe Beschaffenheit des Granits mit seinen grubigen Löchern oder gneisartigen abblätternden Außenflächen der Blöcke, dieselben schmalen Gänge von Urtonschiefer, die sich von dem Kamme aus nach unten senken, und wahrscheinlich zur Bildung der wenigen Rinnsale, die der Berg aufzuweisen hat, Veranlassung gaben, boten sich hier meinen Blicken dar, dieselben Schwierigkeiten meinem Emporklimmen, nur dass gegenwärtig Hitze und Durst nicht in dem Maße die Kräfte beeinträchtigten.
Eine Bergtour unter solchen Verhältnissen ist gewiss ein dreimal größeres Stück Arbeit, als unter ähnlichen in Europa, und eine Höhe von 4.000 Fuß erklimmen, heißt daselbst mindestens 10.000 Fuß. In den europäischen Alpen führt der Pfad bis 8.000 Fuß durch Wälder über Wiesen, oder wenigstens auf Gneis- und Gemssteigen aufwärts, weiterhin gewähren Eis und Schnee sicheren Anhalt den Füßen und gleichen die zu jähen Abstürze aus. Hier dagegen heißt es mühsam von dem Fuß bis zur Spitze jede Stufe riesiger Felsblöcke erobern, sich über haushohe Wände zu schwingen oder in engen Spalten zu den jäh abstürzenden Kämmen sich emporarbeiten. Kein Strauch, kein Kraut, nicht einmal Flechten, die die Glätte des Felsens verringern, bieten den Füßen und Händen des Wanderers erwünschte Ruhepunkte. Überall erweisen sich unsere Arme zu kurz, die Füße zu steif. Dazu kommt noch der missliche Umstand, dass in dieser Zone die höheren Granitspitzen von einer dicken Kruste gänzlich verwitterten Gesteins, das sich im Laufe der Zeiten bildete, bedeckt erscheinen, da kein häufiger Regen das Zersetzungsprodukt wegräumt, und nachstürzendes Gestein erst durch den Fall in die Tiefe das lose Gewordene mit sich reißt. Zu allen diesen Hindernissen gesellt sich noch die Glut der Sonne, die diese Massen nicht selten in dem Grade erhitzt, dass die nackte Hand sich vor jeder Berührung mit ihnen scheut, und schließlich die Gewalt des Durstes und die beschleunigte Erschöpfung der Kräfte des in diesen Breiten weniger ausdauernden Europäers.
Mit einer Pflanzenmappe unter dem Arm, einer Wasserflasche an der Seite, brauchte ich 3 volle Stunden, um die etwa 3.000 Fuß hohe Schlucht bis unter die eigentlichen Spitzen des Berges zu erklimmen. Schönes reines Regenwasser fand ich an mehreren Stellen in muldenförmigen Vertiefungen erhalten, und selbst unten am Fuß befindet sich eine natürliche Zisterne, von der die Hirten dieses Tales zehren. Steinböcke klettern nur bis gegen 500 Fuß diese Abstürze hinan, wie ausgetretene Wechsel und Kotballen mir bewiesen. Weiter oberhalb verringert sich auffallend die Vegetation, ohne bedeutende Unterschiede gegen die in den Tiefen darzutun. Die Moringa („lesser“) steht in der Schlucht bis hoch hinauf in üppigen bis 30 Fuß hohen Bäumchen, deren vorjährige Früchte, lange Schoten, noch überall am Boden herumlagen. Auch die Lassaf-Kapper überzieht große Blöcke mit ihren stachligen Dickichten. An vielen Stellen musste ich haushohe senkrechte Abstürze auf Seitenwegen umgehen, mühsam über wild zusammengewürfelte Blöcke kletternd.
Oben angelangt handelte es sich nun darum, einen Pfad zu den aufrecht steil und meist mit glatten Flächen abstürzenden Spitzen ausfindig zu machen, die noch dazu gänzlich verwittert waren. Rechts und links von der höchsten Ecke des Rinnsals zeigten sich mehrere Zacken in der Richtung nach Süden, eine hinter die andere gesetzt und an Höhe zunehmend. Die zwei höchsten auf der Ostseite waren durch eine Scharte getrennt, zu der ich zunächst hinan klomm. Nur wer den Terglou kennt, kann sich eine richtige Vorstellung dieser steilen Wände und scharfen Felsrisse machen, in denen der menschliche Fuß nimmer sich festzusetzen vermag. Von der Scharte aus machte ich einen vergeblichen Versuch, die Ersteigung des östlichen Piks zu ermöglichen, da ich nirgends eine Spalte zum Emporklimmen finden konnte, und ich mich auf die geneigten Platten nicht wagen wollte. Leichteres Fortkommen verhieß mir die gegenüberliegende westliche Spitze, von der eine wild zerklüftete Schlucht zu dem Hauptrinnsal des Berges hinunter führte, und deren oberster Teil einige Spalten darbot. Ich kletterte daher wieder hinunter, und an der gegenüberliegenden Wand hinauf, wo mir die großen Steinblöcke, die starke Neigung und der Mangel kleineren Gerölls große Schwierigkeiten in den Weg legte. Endlich war ich oben, wieder am Fuße eines der eigentlichen Piks angelangt, und stand abermals ratlos vor den jähen Granitwänden. Schließlich erblickte ich eine zwar fast senkrechte, indes durch verschiedene Löcher differenzierte Spalte, die allein mir den Weg zu dieser zweithöchsten Spitze des Berges ermöglichte. Meinen Körper möglichst eng in diesen Felsenriss einzwängend, gewann ich den nötigen Halt, um die gefährliche, etwa 10 Klafter betragende Strecke zu überwinden. Es war ein würdiges Seitenstück zu meinem Übergang von der ersten Spitze des Großglockners zu der zweiten im Juli 1857. Die Bergzacke selbst war weniger geneigt und bot sichere Stufen und Vorsprünge meinen vier Extremitäten dar. Ich befand mich nun oben auf einer Stelle, die wohl noch nie ein menschlicher Fuß berührt haben mochte, wenn nicht auch bis hierher zufällig einmal römische oder griechische Goldsucher vorgedrungen sein sollten.
Unter den Botanikern war ich gewiss der erste, um die Tatsache konstatieren zu können, dass es auf der Spitze des Abu-Tiur keine Saxifraga oppositifolia, ja nicht einmal die geringste Spur einer Flechte gebe. Vor mir lag das endlose unbegrenzte Meer, das am Horizont sich mittelst bläulicher Dunstmassen mit dem Himmelsgewölbe zu verschmelzen schien, das weite einsame Meer, das kein Segel und keine Rauchsäule belebte, hundert Meilen im Umkreise! Vor mir breitete sich das von einem unentzifferbaren Gewirre zahlloser Vorhügelketten von Glimmerschiefer, Felsit und Kalk erfüllte Küstenland aus, und über den höchsten Spitzen der sich von unten so schauerlich ausnehmenden schwarzen Tal wände schaute ich von meinem erhabenen Standpunkte hoch hinweg. Alles, was in der Tiefe zackig und wild zerklüftet erschien, verschmolz zu einem breiartigen Einerlei, dessen Hauptfarbe braun zu sein schien. Die Kräuter auf den Talsohlen waren von der Natur viel zu licht angepflanzt und viel zu lokal verteilt, als dass ihr Grün diesen Farbenton der Felsenwüste im Geringsten zu modifizieren vermochte. Die kleine Bucht von Kosser zeigte sich von hier sieben Minuten östlich vom wahren Nord, und verschiedene Winkel, die ich nach andern gekennzeichneten Punkten der Küste aufnahm, bewiesen mir die richtige Lage des Berges auf der Moresbyschen Seekarte. Aus dem braunen Wirrwarr der Vorgebirge stachen allein die langhingestreckten von NW nach SO verlaufenden Eozän- und Kreiderücken durch ihre weiße Färbung hervor, der Gebel Duwi und Hamad und der Gebel Beda, westlich drei Stunden von Kosser, waren am meisten kenntlich. Im fernsten NW zu N ragte ein kolossaler Tafelberg empor, wegen der großen Entfernung nur schwer von dem Blau des Himmels zu unterscheiden. Es war, wie der von mir aufgenommene Winkel es bestätigte, der Gebel Fatireh, der Mons Claudianus der Alten, 20 deutsche Meilen von dem Beobachtungspunkte entfernt. Meine Aussicht nach Süden wurde durch die gegenüberliegende Spitze, die meinen Standort um 80 bis 100 Fuß überragte, sehr verringert: Die Berge Nassla und Schedit, die nächsten in der südlichen Kette dieser afrikanischen Kordilleren, zeigten sich allein deutlich meinen Blicken, und verdeckten die höheren des Südens. Gebirge der arabischen Küste traten nirgends hervor. Indes behaupten Einwohner von Kosser, dass man die hohen Berge von Midiam bei Wudsch und Moïlah, kleinen von den Ägyptern besetzten Hafenplätzen, nördlich von Jambo, bei besonders klarer Luft manchmal sehen könne, was nicht unmöglich ist, da letztere bis 7.700 Fuß emporragen.
Warum der Berg Abu-Tiur (= Vater der Vögel) heiße, blieb mir unklar, denn er schien mir nur der „Vater eines einzigen Vogels“, eines Raben, zu sein, der entsetzt über meine Anwesenheit gespenstisch über mir kreiste. Alle diese Berge tragen jetzt arabische Namen, während sie ursprünglich doch einheimische gehabt haben müssen. Ich glaube daher, dass die meisten oft sinnlosen arabischen Namen nur Verdrehungen ähnlicher hamitischer Urnamen sind, so z. B. wie man Ipsambul in Abu Simbel umgewandelt hat.