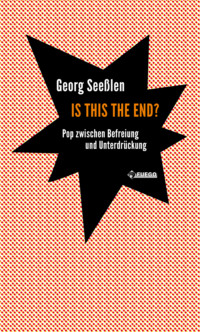Kitabı oku: «Is this the end?», sayfa 2
III
Was wir von Antonio Gramsci gelernt haben, das ist, dass in den westlichen Industriestaaten der Kampf nicht so sehr ums Überleben, nicht einmal allein um die Macht geht, sondern vor allem um die Gestaltung des Alltags. Nicht ums Sein oder Nichtsein geht es der Mehrzahl der arbeitenden Menschen, sondern ums Wie-Sein, ums Mehr- oder Anders-Sein. Das verändert auch die Bedingungen des Links-Seins. Nach wie vor ist es gespalten in ein moralisches und ein politisches Verhalten; links mag der dissidente Bürger auf andere Weise sein als sein proletarischer oder postproletarischer Genosse, und darin eingelagert mag auch eine höchst unterschiedliche Art wirken, feministisch zu sein. Nicht nur weil es einen Unterschied macht, auf Privilegien zu verzichten oder sie gar nicht erst zu haben, sondern auch, weil es einen noch erheblicheren Unterschied macht, Verhältnisse als allgemein falsch oder persönlich unerträglich zu empfinden. Je mehr es indes um den Alltag und seine Ausgestaltung – also um Pop – geht, desto mehr verliert der Widerspruch von moralischem und politischem Antikapitalismus an seiner Ausweglosigkeit. Im Kampf um die Qualität des Alltagslebens heben sich die Widersprüche zwischen den beiden Klassen, Bürgertum und Proletariat, der Mittelklasse und den blue collar workern auf, und zwar in doppeltem Sinne: Sie setzen sich auf der Ebene der Zeichen, Symbole, Narrationen und Bilder fort, und sie verbinden sich zu etwas Neuem, zu einem meta-klassenhaften Konglomerat von Information und Unterhaltung.
Popkritik ist also immer auch die Kritik des Alltagslebens und dessen, was in es »hineinregiert«, die Interessen von Staaten und Ökonomien, die Interessen von Gruppen und Personen. Der Alltag ist nicht nur Widerschein des Politischen, der Alltag ist das Politische schlechthin. Es gibt in ihm und um ihn herum nichts Unpolitisches, wohl aber eine Unzahl von Elementen des Anti-Politischen, das heißt von Elementen, die die Verbindungen zwischen dem Alltag und der Geschichte, dem täglichen Leben und der Wirkung der Macht, unterbrechen wollen. Dreimal dürfen wir raten, wer davon profitiert, wenn die Kultur des Alltags sich von der Kultur der Entscheidungen und der Repräsentationen entfernt, und sei es, indem sie »Sprachen« entwickelt, in denen Alltag und Politik nicht mehr miteinander sprechen können. Statt also eine Möglichkeit zu entwickeln, Alltag und Geschichte miteinander kommunizieren zu lassen (das Ideal der Aufklärung in einer Industrie- und Post-Industriegesellschaft), durch Information ebenso wie durch die Entwicklung von Projekten und Narrativen, hat sich Mainstream-Pop zu einer Sprache entwickelt, in der sich ökonomische und politische Interessen der Subjekte bemächtigen: Populäre Kultur soll ihre Adressaten auf eine Weise an ihren Alltag binden, dass sie beidem nichts mehr entgegensetzen. Pop heißt Profit, und Pop heißt Propaganda, und das Profitinteresse und den Propagandaeffekt herauszustellen, ist eine erste Aufgabe von Kritik.
Aber nun lassen sich Profit und Propaganda immer nur so weit synchronisieren, wie es keinen Widerspruch zwischen Ökonomie und Politik gibt, das heißt in unserem Fall, dass der Kapitalismus vollkommen demokratieförmig, bzw. die Demokratie vollkommen kapitalförmig geworden wäre. Das freilich scheint genau so wenig möglich wie eine vollständige Kontrolle der Popkultur durch Markt und Zensur. Wir, die »subalternen Schichten«, das Gemisch von mehr oder weniger prekarisierten Lohnabhängigen und Alltagsmenschen, deren Klassenlage sich zunehmend nicht mehr ökonomisch, sondern kulturell bestimmt (reiche Prolls und arme »Bildungsbürger«, Milliardäre, die mit Hilfe des »Volkes« das »Establishment« stürzen wollen), wir sind immer noch ein undisziplinierter und widerspenstiger Haufen, aus dem immer wieder neben dem Hunger nach Unterhaltung auch ein Hunger nach Wahrheit aufscheint. Die ökonomische Struktur der Popkultur macht uns zu bedeutenden Mitproduzenten. So wenig sie »frei« und »demokratisch« produziert wird, so wenig kann sie uns einfach vorgesetzt werden. Man kann uns nicht zwingen, man muss uns verführen; man kann uns nicht mehr disziplinieren, man muss uns kontrollieren; man kann uns nicht ausschließlich belügen und verblöden, denn die Brüche, Widersprüche, Entblößungen und Demaskierungen lauern an allen Ecken und Enden. Gramsci forderte uns auf, eine »komplizierte, ideologische Arbeit« zu verrichten, um die Brüche und Widersprüche in der Alltagskultur, die verborgenen Wahrheiten und Enttarnungen, aber auch die verborgenen Wünsche und Hoffnungen ebenso sichtbar zu machen, wie Werbung und Propaganda.
Die Herstellung des Alltagsverstands durch Popkultur und Warenwelt ist der Gegenstand meiner Idee von Popkritik, die weder von außen noch von oben kommt, sondern aus der Mitte von Empathie und Erschrecken, aus Nähe und intellektueller Distanz. Auch darin stimme ich mit Gramsci überein: Dieses »Intellektuelle« ist nur einerseits ein Berufsmerkmal, auf der anderen Seite ist es eine mögliche Haltung in jeder Lebenssituation, in jedem Arbeitsfeld, in jeder Kultur und Subkultur, in jeder Klassenlage. Mit den Intellektuellen verhält es sich wie mit der Kunst: Dass es berufsmäßige Künstler gibt, widerspricht nicht dem Statement, dass in jedem Menschen der Künstler als Möglichkeit steckt. Intellektuelle in diesem Sinn sind das Gegenteil von Experten, Wissenschaftlern oder Priestern, es handelt sich vielmehr um Menschen, welche die Felder der intellektuellen Auseinandersetzung zu erweitern und zu beschreiben haben. Die Intellektuellen haben nicht die Aufgabe, über den Alltagsverstand hinaus zu führen, sondern im Gegenteil, in ihn hineinzuarbeiten und, wie Gramsci das gefordert hat, eine Verbindung zu schaffen zwischen der Alltagskultur von uns gewöhnlichen Leuten und der »Hochkultur«, die angeblich oder tatsächlich sowohl Privilegien ausdrückt als auch an die Anwendung von Privilegien gebunden ist.
Dabei gilt es, zwei Mythen zu entlarven. Der erste Mythos besagt, dass Popkultur simpel, kindlich und »volkstümlich« ist, leicht zugänglich und »leicht verdaulich« in ihrer seriellen Redundanz letztlich leer oder beliebig füllbar, tautologisch und unreflektiert. Das ist Quatsch, oder schlimmer, es ist Ideologie. Der zweite Mythos besagt, dass Hochkultur kompliziert und schwierig, prätentiös und hermetisch ist, schwer zugänglich und schwer verdaulich. Das ist genauso Quatsch und genauso ideologisch. Es ist gewiss kein Zufall, dass es in den rebellischen Zeiten, in den Zeiten einer stärkeren Präsenz von linker Kultur, zwischen Pop und Hochkultur keine unüberbrückbaren Grenzen gibt, die eine Seite nicht nur von der anderen profitiert, sondern beide Seiten von einer lustvollen Vereinigung träumen, während in den Zeiten der rechten Hegemonie taktisch und strategisch die volkstümliche gegen die elitäre Kultur ins Feld geführt werden. Die Differenz zwischen Popkultur und Hochkultur ist einerseits Ausdruck einer historischen und sozialen Entwicklung (man kann den Klassencharakter von Kultur nicht einfach leugnen, und eine Amalgamierung zum Beispiel in musikalischem Klassik-Kitsch ist das Letzte, was uns voranbringt), sie ist andererseits aber auch ein ideologisches Konstrukt. Vor allem aber entspricht sie Marketing-Interessen; beides verkauft sich besser als Abwehrzauber gegen das jeweils andere.
Zweifellos unterscheidet sich eine Kritik des Pop-Produkts von einer Kritik eines Kunstwerkes, nicht so sehr in Bezug auf die Qualität (was immer das sein mag), sondern in Bezug auf die Zeit. Sucht die Kunstkritik nach dem »Bleibenden«, dem, was Kulturen und Epochen miteinander gemeinsam haben, so spürt die Popkritik dem Gegenwärtigen nach. »Musik zur Zeit« lautet der treffende Untertitel der Zeitschrift Spex. Es geht darum, herauszufinden, was »signifikante Äußerungen zu einem bestimmten Zeitpunkt« (Ralf Hinz) sind. Das ist eine etwas abstraktere Bezeichnung des Umstands, dass man Pop immer nur aus dem Leben heraus kritisieren kann, und die Frage nach der bedeutenden Äußerung ist immer die Frage nach dem, was es mit uns zu tun hat (wer immer »wir« gerade sind). Ich kann also einen Beatles-Song mit Mitteln der Kunstkritik beschreiben (und bemerken, wie nahe er an einem Schubert-Lied ist), wie ich umgekehrt eine Botticelli-Ausstellung mit den Mitteln der Popkritik beschreiben kann (wie sehr uns solche Schönheit in den Alltag scheint oder auch nicht); Kunstkritik und Popkritik unterscheiden sich weder durch ihre Gegenstände – denn so, wie alles als Pop gesehen werden kann, kann auch alles als Kunst gesehen werden – noch durch ihre Haltung (Kunstkritik und Popkritik können beide demokratisch-kritisch oder reaktionär-mythisch sein, kann sich an linke wie rechte Diskurs-Modelle anlehnen, sie unterscheiden sich durch Absichten und Methoden. Jede Kunst enthält Pop, und etliches an Pop enthält Kunst.
Dabei sind der chaotische, spontane, unbekümmerte und skizzenhafte Pop und die kohärente, systematische, homogene Hochkultur (um Gramscis Begriffe zu benutzen) aufeinander angewiesen, wenn es um Möglichkeiten von Wirkung und Veränderung geht; das eine ohne das andere ist kulturelles Gefängnis, Glocke, Tautologie, Entmachtung. Alles, was geschieht, ist im Übersprung zwischen Hochkultur und Pop, und umgekehrt ist nur zu leicht zu beschreiben, wem die strikte Trennung zwischen beidem nutzt. Pop (das Jetzt) und Hochkultur (das Archiv des Wissens) sind nicht als Verschmelzung, sondern im Dialog fruchtbar. Denn so wie Pop den Alltag und seinen Verstand (Verstehen und Verständnis) konstruiert, konstruiert die Hochkultur die großen Systeme, Staat, Bildung, Wissenschaft etc. Popkultur, die sich als Widerpart zur Hochkultur versteht, schneidet ihre Adressaten von den großen Systemen und ihren »Narrativen« ab; sie erzeugt ein wohliges Empfinden der Ohnmacht in der Geborgenheit, aber sie bündelt dieses Ohnmachtsempfinden auch wieder und erzeugt die Energien politischer Bewegung. Der schlimmste Fall ist jener Mensch, der sich in seiner »volkstümlichen Unterhaltung« von der demokratischen Teilhabe abkapselt, um dann gegen eine Demokratie zu Felde zu ziehen, die ihm vermeintlich diese Teilhabe verweigerte.
Unglücklicherweise spielt die Kritik zu oft dieses Spiel mit. Wenn Popkritik da hingeht, wo es weh tut, ist sie schnell mit dem Vorwurf »elitärer Arroganz« konfrontiert, und umgekehrt werden die Pop-Bekenntnisse von ansonsten eher akademischen Denkerinnen und Denkern rasch als modische Anbiederung markiert. Als gälte es, die Denkfigur von Elitarismus und Populismus hier fortzusetzen. Aber worum es geht, ist dies: Weder ist die sogenannte Hochkultur ein privilegierter Besitz einer kulturellen Seitenklasse des Establishments, noch ist Pop das intellektuelle und
ästhetische Gefängnis, in das die Unterhaltungsindustrie »das Volk« einsperrt. Beides aber ist in einem ideologischen, ökonomischen und politischen Interesse durchaus zu konstruieren. Wenn ein Volksmusik-Fuzzi erklärt, seine Musik und seine Texte repräsentierten eben das Leben der »kleinen Leute«, von dem die intellektuellen Kritiker keine Ahnung hätten, dann lügt er nicht nur, sondern er konstruiert auch die kulturelle Basis für den politischen Populismus. »Volkstümliche Unterhaltung« schuf die Basis als kulturelle Hegemonie für eine neo-völkische Bewegung in der Politik. Beides kommt nicht ohne die Konstruktion von Feindbildern aus, und sie ähneln sich erschreckend.
Pop ist emotional. Hochkultur ist rational, jedenfalls wird sie allgemein so gesehen. Demnach müsste also Pop anti-rational, und intellektuelle Kritik anti-emotional sein. Wer sagt das? Wie alles, was gesagt wird, wird es vor allem von jenen gesagt, denen es nutzt. Jenen also, die das Rationale aus dem Pop und das Emotionale aus der Hochkultur heraushalten wollen. So begreifen wir allerdings auch wieder, welche Widerstände sich dabei auftun, wenn das eine zur Eroberung des anderen aufbricht, während sich das andere zugleich gegen das eine verteidigen zu müssen glaubt. Veränderungen aber, vielleicht sogar einfach Erkenntnis, gibt es nur, wenn das Emotionale und das Rationale ineinander wirken. Eine Revolution – oder auch nur ein verändernder Eingriff in die großen Systeme von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft –, die ausschließlich rational vonstatten ginge, ist ebenso zum Scheitern verurteilt, wie eine ausschließlich emotionale Bewegung etwas verändern kann.
Die Rechte hat längst erkannt, dass der politische Kampf auch durch kulturelle Hegemonie entschieden wird, und der popkulturelle Mainstream hat dieser Strategie des »Rechtsgramsciismus«, der von den Vordenkern der französischen Nouvelle Droite als erste zum Programmpunkt erhoben wurde, erstaunlich wenig entgegengesetzt. Hat die Linke, auch in der Popkritik, »versagt«? War sie zu hochnäsig oder traditionalistisch, zu ökonomistisch oder ignorant? Hat sie nur abgelehnt, als es darum ging, zu verstehen?
Schwer zu sagen. Ich weiß nur, dass ich mich in ein paar Büchern und etlichen Essays darin versucht habe, Elemente der Popkultur in ihrer Wirkung auf den Alltagsverstand (einschließlich meines eigenen) zu verstehen und in ihnen sowohl Absichten und Interessen als auch Reichtum und Widersprüchlichkeit zu entdecken. Einer der roten Fäden dabei war die Frage, wie sehr sich völkisches, rassistisches, nationalistisches und sexistisches Denken in der Popkultur einnisten und den Alltagsverstand vergiften konnte. Seit den siebziger Jahren gibt es in Deutschland eine Pop-Linke, die sich an Kritik und Theorie zur populären Kultur, zu Ideologiekritik und zu Konstruktion und Dekonstruktion von Alltagsverstand versucht, und es gab und gibt Medien, die ein neues Schreiben über Pop, Kunst, Politik und Hochkultur ermöglichten, wenn auch zumeist in bescheidenem Rahmen. Der Erfolg dieser Arbeit war überschaubar. Dass sie in der bürgerlichen Mitte nicht wirklich ankam, war einigermaßen vorhersehbar, ebenso die rasch hochgezogenen Mauern zwischen linker Popkritik und akademischer Lehre; die Ignoranz jener Linken, die heute lamentiert, es hätte ihr an Gegenkräften gegen die rechte Eroberung von Popkultur und Alltag gefehlt, schon weniger. So konnte diese bizarre Kultur des gönnerhaften Populismus entstehen, die dem niederen Volk seine Vergnügungen liefert, wie es die mehr oder weniger Verantwortlichen in den großen Fernsehanstalten tun, weil es gut für Quote und Karriere ist. Ein Großteil der Popkultur wird von Menschen verantwortet und verwaltet, die selber nicht an Pop glauben; die Produzenten der volkstümlichen Kultur widmen sich persönlich eher den Ritualen der Hochkultur. Und auf diese Weise entstand eine populistische Kultur aus zweiter Hand, die im übrigen nur durch ihren beständigen Wechsel von Hysterie und Wiederholung wirkt, und die am Ende gar nicht anders kann, als zum politischen Bekenntnis zu werden.
Antonio Gramsci hat das an einem Beispiel beschrieben: »Angesichts des Anwachsens der politischen und sozialen Kraft des Proletariats und seiner Ideologie reagieren einige Teile der französischen Intelligentsia mit diesen Bewegungen zur ›Zuwendung zum Volke‹. Die Annäherung ans Volk bedeutete also eine Erneuerung des bürgerlichen Denkens, das seine Hegemonie über die unteren Klassen des Volkes nicht verlieren will und das, um diese Hegemonie besser auszuüben, einen Teil der proletarischen Ideologie assimiliert.« Das »Volkstümliche« in der Kulturindustrie ist also nicht etwas, das aus dem Volk kommt (aus der Welt des Alltags, aus unserer Welt), sondern etwas, das über das Volk kommt (ein Kontroll- und Manipulationsspiel mit Belohnungsregression und Bestrafungsängsten fürs Nicht-Dazugehören).
Allerdings: Diese Zuwendung indes gibt es in einer linken und in einer rechten Form, sie kann neue Allianzen ebenso wie Manipulation oder Betrug bedeuten. Wie es aussieht, wurde wenig oder nichts von einer proletarischen Ideologie, sehr viel aber von einem »proletarischen Geschmack« assimiliert. Und aus einer möglichen Kommunikation wurde ein Geschäft. Die »Zuwendung zum Volke«, die möglicherweise eine neue Allianz hätte erzeugen können, mit all seinen Widersprüchen, wurde als Geschmacks- und Objektfetischismus ein gemeinsames Projekt von Neoliberalismus und Rechtspopulismus. Die Pop-Linke dagegen wurde versprengt und isoliert; es war, als hätte die Kulturindustrie nur auf den geeigneten Moment gewartet, sich ihrer zu entledigen, ihre Medien auszutrocknen, ihre Diskurse ins Leere laufen zu lassen. Man durfte sich mit dem »Zeitgeist« verbunden fühlen. Pop war tot. Wieder mal.
IV
Zum Glaubensbekenntnis des Neoliberalismus gehört, bis in die Kulturen seiner Gegner hinein, ein Triptychon der Verneinung: Es gibt keinen neuen Jesus Christus. Es gibt keinen neuen Karl Marx. Es gibt keine neuen Beatles. Das scheint so selbstverständlich und irgendwie auch schwer entlastend, dass man zu fragen vergisst: Warum eigentlich nicht? Lassen wir mal die Frage nach Jesus Christus und vorläufig auch die nach Karl Marx beiseite, dann können wir uns den Beatles zuwenden. Natürlich war das, was die Fab Four schafften, ein Quantensprung in unserer Musik. Rock’n’Roll eroberte Kunst oder ließ sich von Kunst erobern.
Danach war alles möglich und ist es immer noch. Wer glaubt, zwischen Rock’n’Roll und Kunst würde nichts mehr passieren, hört wahrscheinlich wenig neue Musik oder hat vor Jahren sein Spex-Abo gekündigt. Nur begleitet es eben nicht mehr die Befreiung von Generationen und Kulturen, es ist am Ende, was die Kunst schon immer war, vor allem subjektive Kraft. Über die neue Pere-Ubu-CD zu sprechen, ist fast schon konspirativ, und Jello Biafra ist ein Held für Leute, die sich sowieso auf verlorenem Posten wähnen. Schlimmer geht es jenen, die vom offiziellen Kulturbetrieb musealisiert werden wie Kraftwerk oder Einstürzende Neubauten. Und vom grönemeyernden Pop-Patriotismus wollen wir gleich ganz schweigen. Für den Augenblick jedenfalls.
Neue Beatles gäbe es also zuhauf, nur ein neues Beatles-Publikum gibt es nicht. Erinnern wir uns an die Erfolgsgeschichte von ABBA. Als damals der Spiegel verkündete, ABBA verkaufe mehr LPs als die Beatles, tat man es mit der überheblichen Geste: Da habt ihr es! Eine große Erleichterung der Wächter der Hochkultur: Pop ist und bleibt Ramsch – unnütz zu sagen, dass man auch ABBA nicht genau zu hören bereit war. Obwohl die Platte in jedem WG-Gemeinschaftszimmer stand, sichtbar genug, war die »Bananen-Platte« der Velvet Underground kein kommerzieller Erfolg. Helene Fischer oder Andreas Gabalier füllen Konzerthallen wie die Beatles und lösen Begeisterung aus; die Rolling Stones machen das immer noch, wenn auch eher als Erinnerung an Pop als Pop. Was ist der Unterschied?
Eine Tatort-Besichtigung macht es rasch deutlich: Das eine sieht aus wie eine Gefängnisrevolte, das andere wie die Verteidigung einer belagerten Burg. Das sind zwei sehr extreme Formen von Kollektivierung. So macht sich der nachdenkliche Pop-Star auf, eine verlorene Kraft der Subjektivitäten, einen verlorenen Safe Space der Kommunikation zu errichten, in den Texten, den Interviews an ein verlorenes »Unter uns« zu erinnern. Der nachdenkliche Pop-Star mit einem Hang zur Kunst ist ein Zerfallsprodukt des großen Bruchs. Pop für Leute, die nicht mehr an Pop glauben.
Die andere Seite des »nachdenklichen Pop-Stars« ist der Popkritiker/die Popkritikerin, die sich von der jugendlichen Leidenschaft zurückgezogen haben und eine mehr oder weniger ironische Meta-Haltung einnehmen. Nicht einmal echte Nerds können sie sein, ohne sich zugleich über das eigene Nerdtum lustig zu machen. So haben wir eine Popkritik, was Musik, Comics oder Film anbelangt, in der immer mehr Wissen akkumuliert wird, bis hin zu einer etwas grotesk asynchronen Akademisierung (so viel filmhistorische Fachbücher bei so wenig Interesse an Filmgeschichte!), aber immer weniger Leidenschaft und Empfindung (vom Narzissmus des kritischen Subjekts abgesehen). Die Popkritik, die diesen Namen noch verdient, steht eindeutig neben sich selbst. Sie glaubt weder an ihren Gegenstand noch an sich noch an die Gemeinschaft mit den Adressaten. Popkritik als Technik der Vereinzelung aber ist das Gegenteil dessen, was sie eigentlich einmal hätte werden können, nämlich eine organische intellektuelle Begleitung einer aufrührerischen oder dissidenten Alltagskultur.
Wir lassen uns auf diese Weise zu Agenten der »zirkulären Produktion von Vereinzelung« machen, von der Guy Debord gesprochen hat. »Der Ursprung des Spektakels«, sagt Debord, »ist der Verlust der Einheit der Welt.« Setzen wir an die Stelle von »Spektakel« Pop. Und an die Stelle von »Welt« erst einmal bescheiden unsere Gesellschaft oder unsere Kultur. Dann ist die Frage, was mit diesem Verlust der Einheit, die es vielleicht auch nie gegeben hat, angestellt wird. Wird der Verlust bestätigt, beklagt, erklärt oder rückgängig gemacht? Wird Einheit wieder erzeugt oder wenigstens simuliert oder wird umgekehrt ihr Verlust mit Sinn und Haltung ausgestattet? Geht es zurück ins kindliche Paradies oder vorwärts ins Utopische oder doch nur seitwärts in den Reproduktionsraum der »Freizeit« zwischen den Arbeits- und Konsumzyklen? Ist also Pop Teil des Lebens (Teil der Person und Teil ihrer Stellung in der Geschichte) oder ist Pop Auszeit in der Warenwelt, untoter, verdinglichter Appendix, Schmiermittel zwischen Totarbeiten und Totamüsieren? Wer weiß. Entscheidend ist nicht die Antwort, entscheidend ist der Mut, die Fragen zu stellen.