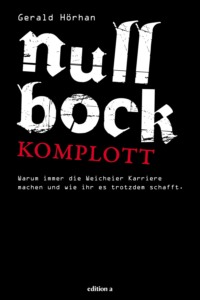Kitabı oku: «Null Bock Komplott», sayfa 2
 Das system
Das system
Vielleicht kommt es euch auch manchmal so vor, als
würden immer die Falschen Karriere machen. Die
Langweiler. Die Jasager. Die Weicheier. Das ist keine
Einbildung. Es stimmt – und es hat einen Grund.
Die Gesetzgebung ist ausgerastet
Ich bin froh, dass es Gesetze gibt. Ich profitiere jeden Tag von ihnen. Nicht bloß, weil sie es mir ermöglichen, nachts sicher heimzugehen. Ich könnte ohne sie kaum meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, dem Geld verdienen. Ich müsste, etwa bei der Durchsetzung von Verträgen, auf Mafiamethoden wie Drohung, Erpressung und noch Schlimmeres zurückgreifen, und ich wäre diesen Methoden selbst ausgesetzt.
Die erste bekannte Gesetzessammlung, der Codex Ur-Nammu, stammt aus Mesopotamien und ist mehr als 4000 Jahre alt. Er legte die Strafen für Verbrechen wie Mord, Raub, Vergewaltigung oder falsche Anschuldigung fest. Außerdem regelte er wirtschaftliche Angelegenheiten wie Darlehen und Zinsen, die Miete für Ochsen oder ärztliche Behandlungskosten.
Der ursprüngliche Sinn der Gesetze bestand darin, den Bürgern eines Staates die Ausübung ihrer Freiheit zu ermöglichen. Bloß haben die westlichen Demokratien, besonders in den vergangenen zehn Jahren, bei der Gesetzgebung eine ungesunde Überaktivität entwickelt. Sie schaffen unaufhörlich neue Gesetze und Verordnungen. Es sind längst so viele, dass sie nicht einmal mehr die versiertesten Rechtswissenschaftler und Rechtsanwälte überblicken können.
Schätzungen zufolge gibt es auf EU-, Bundes- und Landesebene rund 500 000 Gesetze und Verordnungen. Wer alle lesen und verstehen wollen und dafür im Schnitt eine Minute pro Gesetz oder Verordnung investieren würde, wäre bei vierzig Lesestunden die Woche vier Jahre beschäftigt. Wäre er damit fertig, gäbe es schon wieder tausende neue Gesetze und Verordnungen.
Die westlichen Demokratien haben damit den ursprünglichen Sinn der Gesetze, ihren Bürgern die Ausübung ihrer Freiheit zu ermöglichen, aus den Augen verloren. Vielmehr bewirkt die Gesetzesflut das Gegenteil. Ein Kontrollstaat ist entstanden, der die Freiheit der Bürger unnötig einschränkt.
Diese Entwicklung hat zwei Hauptgründe.
Erstens. Das falsche Menschenbild des Staates.
Der Staat traut seinen Bürgern nicht zu, Entscheidungen zu treffen und zu verantworten. Er glaubt vielmehr, dass sie in allen Lebenslagen auf seinen Schutz und seine Hilfe angewiesen sind. Er glaubt, dass ihr idealer Lebensraum eine Art schallisolierter, klinisch sauberer und rund um die Uhr überwachter Arbeits- und Freizeitpark ist, in dem es für jede Lebenslage einen Hausordnungspunkt inklusive Sonderbestimmungen, Ausnahmen und Kontrollen gibt.
Wenn David mit Larry, seinem Jack Russell Terrier, spazieren geht, ist es grundsätzlich gut, dass Larry von Gesetzes wegen niemanden beißen darf. Der Staat müsste eigentlich sagen:
Sorge dafür, dass dein Hund niemanden beißt. Tut er es doch, erwartet dich folgende Strafe und du musst Schmerzensgeld in dieser und jener Höhe an das Opfer zahlen.
Da der Staat David aber unter den Generalverdacht der Unfähigkeit stellt, begnügt er sich damit nicht. Er nimmt ihm lieber die Entscheidung, wie er andere vor dem ohnedies ganz lieben Larry schützen kann, ab. Zumindest versucht er es. Mit unzähligen Gesetzen und Verordnungen, die je nach Kommune anders ausfallen. Der Staat und die Kommunen versuchen damit zu erreichen, dass Larry erst gar nicht in die Lage kommen kann, jemanden zu beißen. Die Ideen des Staates und der Kommunen drehen sich dabei um die Hundemarke, die Hundeleine, die Hundesteuer, den Maulkorb, den Hundeführerschein, die Kategorisierung der Tiere nach Gefährlichkeit und die Einteilung besiedelten und unbesiedelten Gebietes in Hundegefahrenzonen.
Wie so etwas aussehen kann, zeigt die Stadt München. Sie hat im April 2013 ihre Hundegesetze verschärft. Hundebesitzer müssen dort nun ihre Hunde an die Leine nehmen, und zwar innerhalb des Altstadtrings und nur dann, wenn das Tier mehr als fünfzig Zentimeter Schulterhöhe misst. Auch in U-, S- und Trambahnen, in Bussen, sämtlichen Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen gilt der Leinenzwang.
Andere Verordnungen begrenzen dazu noch die erlaubte Höchstlänge der Hundeleine auf zwei Meter im öffentlichen Raum, beziehungsweise auf einen Meter in Menschenansammlungen, Einkaufsstraßen oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Verstöße dagegen gelten als Ordnungswidrigkeit und kosten bis zu 50 000 Euro.
Manche Verordnungen sehen eine Leinen- und Maulkorbpflicht für Hunde vor, die auf einer Liste gefährlicher Rassen stehen. Dazu kommen Zucht- und Einfuhrverbote dieser Rassen, wobei die Listen nicht verbindlich sind. Hundehalter können ihren Pit Bull Terrier durch Nachweis seiner Gutmütigkeit als ungefährlich einstufen lassen. Ebenso kann die jeweilige Exekutive einen besonders wilden Chihuahua als gefährlich einstufen.
Der Kreisverwaltungsausschuss des Münchner Stadtrates bietet den Hundebesitzern, wie andere Kommunen auch, im Gegenzug zur Verschärfung der Hundegesetze eine Hundesteuervergünstigung an. Voraussetzung dafür ist, dass die Hundebesitzer einen Hundeführerschein haben. Doch welcher Hundeführerschein wo wie viel gilt, ist schwer zu sagen. Denn in Deutschland stellen Prüfer Hundeführerscheine zum Beispiel nach den Richtlinien des Verbandes für das deutsche Hundewesen, des Berufsverbandes zertifizierter Hundeschulen oder des Berufsverbandes der Hundeerzieher und Verhaltensberater aus. Daneben gibt es landesspezifische Hundeführerscheine von Tierärztekammern, den von Hamburger und Schleswig-Holsteiner Behörden anerkannten Hundeführerschein der arge Hundeschulen oder den Hundeführerschein nach dem Augsburger Modell.
Ich hätte auch gerne einen Hund wie Larry, aber ich würde mir das nie antun. Jedes Mal, wenn ich die Sache durchdenke, komme ich zu dem gleichen Schluss. Als Städter, der hauptsächlich in Wien und Frankfurt arbeitet, müsste ich einen zusätzlichen persönlichen Mitarbeiter engagieren. Nur so könnte ich mit einem Hund alle Hundegesetze erfüllen, ohne die Aufmerksamkeit für mein Berufsleben zu verlieren. Außerdem würde ich mich ständig darüber ärgern, für wie unfähig mich der Staat hält, an den ich jede Menge Steuern zahle.
Zweitens. Das falsche Rollenbild der Politiker.
Schuld an der Gesetzesflut ist neben dem falschen Menschenbild des Staates das falsche Rollenbild der Politiker. Sie müssen jeden Tag ihre Existenz rechtfertigen. Mangels besserer Ideen tun sie das, indem sie neue Gesetze erfinden. Gesetzesvorschläge zu unterbreiten ist die einfachste Art, politisch aktiv zu sein. Politiker gießen zuerst ihre Weltanschauungen in halbwegs passende Gesetzesvorschläge. Sind sie damit fertig, beobachten sie das aktuelle Geschehen und die Gesetzgebung in anderen Staaten auf der Suche nach Anregungen. In Singapur zum Beispiel ist der unbedingte Schutz der Bürger vor Kaugummis am Straßenpflaster ein Thema. Der Verkauf von Kaugummi war dort von 1992 bis Mai 2004 gänzlich verboten. Mittlerweile ist er zwar gestattet, jedoch weiterhin stark eingeschränkt. Käufer müssen ihren Personalausweis vorweisen.
Im Paragraph 9 der „Allgemeinen Polizeiverordnung zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und Anlagen und zur Abwehr von verhaltensbedingten Gefahren im Stadtkreis Mannheim“ ist bereits geregelt, dass das Ausspucken von Kaugummis auf Straßen und in öffentlichen Grünflächen und Anlagen verboten ist.
Da ließe sich vielleicht noch mehr machen.
Hat sich ein Politiker zu einem Vorschlag entschlossen, stimmt er ihn mit seinen Gremien ab. Die sorgen dafür, dass aus einer ursprünglich vielleicht noch sinnvollen Idee ein verkorkster Kompromiss wird. Danach ruft der Politiker seinen Pressesprecher an. Der formuliert einen Pressetext. Mit etwas Glück bekommt der Politiker eine Schlagzeile, die ihm den Weg in die Fernsehdiskussionen ebnet.
Hund beißt Kind in Ohr. Jack Russell Terrier soll auf Liste der gefährlichen Rassen.
Meist reicht ein Anlass, denn aus einer aktuellen Betroffenheit findet sich immer jemand, der applaudiert. Ein Haus brennt ab, also müssen neue Brandschutzbestimmungen her. Auch wenn das Haus in Wirklichkeit der Besitzer abgefackelt hat, um die Versicherung abzuzocken. Die Unfallstatistik hat sich verschlechtert, also müssen mehr Radarkontrollen her. Obwohl schon deren jüngste Aufstockung keine positiven Effekte mehr gebracht hat. Ein Terroranschlag hat Menschenleben gefordert, also muss noch mehr Flughafensicherheit her. Auch wenn der Anschlag gar nicht die Luftfahrt betroffen hat.
Wenn sonst nichts geht, geht immer ein Vorschlag für ein neues Ausländergesetz oder eine neue Steuer für Vermögende. Denn es gibt immer Menschen, die es entspannt, auf anderen herumzutrampeln, wenn sie selbst gerade schlecht drauf sind.
Zehntausende Politiker ticken in Europa so. Dann sitzt einer von ihnen im Gastgarten eines Cafés und liest Zeitung. Ein Hund bellt. Das nervt ihn, weil es abgesehen davon so ein entspannter Vormittag wäre. Er fragt sich, was an einem Bellverbot für Hunde falsch wäre. Schließlich hat es der österreichische Verteidigungsminister mit der Idee für ein Schreiverbot beim Bundesheer in die Schlagzeilen geschafft. Bellverbot geht nicht, sagen seine Gremien. Dafür lieben die Leute ihre Hunde zu sehr. Außerdem ist es schwer umsetzbar. Am Ende wird daraus eine komplexe Bellregelung mit Differenzierung nach Lautstärke und Listen für Hunde, deren Zucht und Import wegen besonders lauten Bellens verboten ist. Mit Ausnahmeregelungen für alle, die nachweisen können, dass ihr Listenhund selbst dann unter einer bestimmten Dezibelgrenze bleibt, wenn ihm jemand auf die Pfote steigt.
Während erste Sozialdemokraten über Schreiverbote für Babys und erste Liberale über Babyschreizonen nachdenken, verbreitet sich die Idee der Bellregelung für Hunde über ganz Europa. Die EU stört daran, dass jedes Land seine eigene Version entwickelt. Sie hat es gern einheitlich, was sie etwa beim Seilbahngesetz bewiesen hat. Sogar Berlin muss eines haben, obwohl dort der aus Trümmerschutt des Zweiten Weltkrieges aufgeschüttete Teufelsberg mit 120 Metern und der Große Müggelberg mit 114,7 Metern die höchsten Erhebungen sind. Dafür eine Seilbahn zu bauen wäre ungefähr so sinnvoll, wie für den Gemüseanbau am Balkon einen Traktor anzuschaffen.
Trotzdem zieht die EU ihr Ding durch. Im Falle der Bellregelung verabschiedet sie zum Beispiel eine Tiergeräuschsverursachungsrichtlinie. Dann muss irgendwann ein Waldbesitzer durch alle Instanzen bis zum obersten Gerichtshof gehen, will er nicht Strafe zahlen, wenn in seinem Wald ein Reh furzt.
Der Kontrollstaat schafft Dogmen
Die Hauptziele des Kontrollstaates hören sich gut an. Der Kampf gegen Terrorismus, Temposünder, Lärm, Raucher, Korruption und Diskriminierung zum Beispiel. Es ist gut, wenn es der Staat Terroristen erschwert, Flugzeuge zu entführen. Es ist gut, wenn er Autofahrern verbietet, durch Wohnstraßen zu rasen, und Fluglinien, mit Jumbos über Innenstädte zu donnern. Es ist gut, wenn er sich mit den gesundheitlichen Risiken für Aktiv- und Passivraucher befasst, gegen korrupte Politiker vorgeht und dafür sorgt, dass sich Frauen als Voraussetzung für einen Karriereschritt nicht von ihren Chefs begrapschen lassen müssen.
Das Problem ist die Unverhältnismäßigkeit des Staates beim Verfolgen diese Hauptziele. Er hat sie zu Dogmen erhoben, die wahre Kampfzonen eröffnen. In diesen Kampfzonen tritt er nicht mehr für, sondern gegen seine Bürger an. Deshalb muss ein Bürger, der im Flugzeug pinkeln will, unter Umständen zwei Formulare für den Fall unterschreiben, dass die Maschine dabei in die Luft fliegt. Deshalb betreibt die Exekutive eine völlig entfesselte Jagd auf Temposünder. Deshalb machen sich fünf Menschen, die mitten in der Nacht im Freien eine rauchen, womöglich der organisierten Kriminalität schuldig.
Die Gesellschaft ist durch die Dogmen des Staates unmerklich in einen Ausnahmezustand gekippt. Hätte sie sich nicht schon so sehr daran gewöhnt, würde sich dieser Ausnahmezustand beinahe wie ein vom Militär verhängter anfühlen, mit all seinen Konsequenzen für den persönlichen Bewegungsspielraum. Nur ist der Gegner nicht jemand, sondern etwas. Der Terrorismus. Das Schnellfahren. Das Rauchen. Die Diskriminierung. Der Lärm.
Das Pareto-Prinzip, benannt nach dem italienischen Ökonomen Vilfredo Pareto, besagt, dass sich 80 Prozent eines Zieles mit 20 Prozent des Aufwandes erreichen lassen. Danach beginnt die rote Zone. Wer auch die letzten 20 Prozent eines Zieles erreichen will, muss seinen Aufwand dafür verfünffachen. Will der Staat auch die letzten zwanzig Prozent seiner Hauptziele erreichen, bedeutet das unverhältnismäßig radikale Gesetze, unverhältnismäßig scharfe Kontrollen und einen unverhältnismäßig hohen Aufwand an Steuergeldern. Genau diesen Kurs schlägt der Staat ein. Achtzig Prozent seiner Hauptziele hat er schon erreicht.
Der Staat befindet sich bereits in der roten Zone und macht weiter.
Möglichkeiten hat er genug. Er kann verpflichtende Harntests für Flugreisende einführen, weil sie etwas getrunken haben könnten, das sich nach dem Ausscheiden zu einer Bombe verarbeiten lässt. Er kann die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf achtzig Stundenkilometer senken und alle, die hundert fahren, für ein halbes Jahr einsperren. Er kann gegen das Rauchen Vorgehen wie die USA gegen den Alkohol in Zeiten der Prohibition. Die Frage ist nur, zu welchem Preis.
Denn die Dogmen des Kontrollstaates verlieren längst den Bezug zur Wirklichkeit. Dass zum Beispiel die Jagd auf Temposünder längst irrational ist, zeigt ein Vergleich mit anderen Risikobereichen. Bei Haushalts- und Freizeitunfällen kommen dreimal so viele Menschen ums Leben wie bei Verkehrsunfällen. Trotzdem gibt es keine laufenden Razzien, bei denen Beamte kontrollieren, ob Haushaltsleitern standfest sind. Es gibt keine Verordnungen für die Bauart von Fenstern, die das Putzen sicherer machen würden, und es gibt keine Gesetze, die besagen, auf welche Art von Tischen ein Mensch zum Glühbirnentauschen steigen darf und auf welche nicht.
Die Verkehrssicherheit mag einen höheren Stellenwert haben, weil jedes Fehlverhalten eines Autofahrers andere Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft ziehen kann. Doch das rechtfertigt nicht die fortschreitende Radikalisierung des Kontrollstaates in dieser Frage.
Vor dreißig Jahren hat die amerikanische Regierung zur Bekämpfung der Mafia ein Gesetz verabschiedet, dem zufolge die Polizei Autos, die bei Kapitalverbrechen wie Raub oder Mord im Einsatz waren, beschlagnahmen durfte. Heute darf zum Beispiel die italienische Polizei Autos schon dann beschlagnahmen, wenn ihre Fahrer vierzig Stundenkilometer zu schnell waren. In einigen Ländern Europas stehen auf Geschwindigkeitsübertretungen 5 000 Euro Strafe und mehr. Die Schweizer Exekutive kann ihre Bürger für dieses Vergehen seit 1. Juli 2013 sogar einsperren.
In Berlin und Wien diskutieren Politiker ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern, obwohl bei diesem Tempo die meisten Autos lauter sind als bei 50, mehr Sprit verbrauchen, die Staugefahr steigt und die Geschwindigkeit in den Städten wieder auf die zu Zeiten der Pferdefuhrwerke zurückfällt. Inzwischen gibt es sogar Radarüberwachungen für Wasserfahrzeuge und Feldversuche für Geschwindigkeitskontrollen für Radfahrer und Rollerblader. Was als nächstes zu einer Registrierungspflicht für Radfahrer und Rollerblader führen würde, die dann eine Steuer oder Abgabe nahe legen würde.
Irgendwann wird ein Hundebesitzer Strafe zahlen, weil sein Border Collie, der von der Rasse her für 50 Stundenkilometer gut ist, in einer Wohnstraße einem Ball nachrennt, und ein Chip in seinem Ohr eine satellitengesteuerte Radarkontrolle auslöst.
Beim Dogma Korruptionsbekämpfung agiert der Kontrollstaat ebenfalls längst irrational. Schmiergelder, die Firmen im Ausland bezahlten, waren vor zwanzig Jahren noch von der Steuer absetzbar. Aufgrund der schlüssigen Überlegung, dass sie der eigenen Volkswirtschaft dienen. Erhält eine Firma durch Bezahlung von Schmiergeldern im Ausland einen Auftrag, zahlt sie im Inland Steuern und schafft Arbeitsplätze.
Die Frage nach der Integrität des eigenen Handelns und ihren Grenzen wäre legitim und zu diskutieren. Wer selbst besticht, kann nichts gegen Bestechung haben. Doch so hat sie niemand gestellt. Dass es inzwischen gegen Antikorruptionsbestimmungen verstößt, wenn ein Unternehmer einem Manager einer staatsnahen Firma zu Weihnachten eine Flasche Grünen Veltliner eines besseren Jahrgangs schenkt, zeigt, dass der Kontrollstaat auch hier nur noch unreflektiert ein Dogma durchsetzt.
Mittlerweile muss ich selbst bei meinen Geburtstagsfeiern aufpassen. Ich lege viel Wert auf große, gut organisierte Partys, zu denen jeweils rund 400 Gäste kommen. Ich kann nicht ausschließen, dass auch Amtsträger dabei sind. Trinkt so ein Amtsträger Mineralwasser, Orangensaft oder Coca-Cola, ist alles in Ordnung. Trinkt er aber mehrere Caipirinhas oder Manhattan Eistees, würde er ab einer bestimmten Stückzahl den in den Antikorruptionsbestimmungen festgelegten Wert überschreiten.
Beim Kampf gegen Terrorismus ist es genauso. Flugreisende müssen vor den Sicherheitsschleusen ihre Wasserflaschen abgeben, um sich dahinter zu überhöhten Preisen neue zu kaufen. Wenn ich aus Miami kommend in Frankfurt lande, muss ich mich nochmals vor den Sicherheitsschleusen anstellen, obwohl ich bereits die amerikanische Prozedur mit fünf Stempeln, zwei Nacktscannern und einer physischen Abgreifaktion hinter mich gebracht habe. Das Ganze, weil die EU die amerikanischen Sicherheitsbestimmungen nicht anerkennt. Dabei stammen die Geräte am Frankfurter Flughafen und die in Miami wahrscheinlich vom gleichen Hersteller.
Sicherer wird dadurch gar nichts.
Es profitieren bloß die Flughafenshops, die teure Wasserflaschen verkaufen können, die Flughäfen selbst, die Sicherheitsgebühren kassieren können, und die in London börsennotierte Smiths Group, die mit 23 000 Mitarbeitern Sicherheitstechnologie und -dienstleitungen verkaufen kann.
Sicherheitslücken gibt es trotzdem noch und es wird sie immer geben. Die Identität von jemandem, der online eincheckt und kein Gepäck aufgibt, kontrolliert auf Flügen innerhalb der Schengengrenzen niemand mehr. Dann müssen harmlose Reisende ihre Wasserflaschen abgeben, während statt einem friedlichen Herrn Max Huber, der online eingecheckt hat, jederzeit ein Spezialist für Flugzeugentführungen und Terroranschläge an Bord gehen kann.
In Zügen, etwa einem Eurocity, einem tgv oder einem Eurostar, die weitaus mehr Menschen als ein Flugzeug transportieren und damit ideale Ziele für Terroranschläge abgeben, gibt es auch keine Sicherheitshysterie.
Eine hundertprozentige Sicherheitsgarantie kann es nicht geben. Doch die Staaten würden dem Terrorismus sicherlich einen großen Teil seines Nährbodens entziehen, würden sie Unterdrückung und Unfreiheit beseitigen, die Wahrung der Menschenrechte für alle durchsetzen und sich bewusst machen, dass Gewalt, so verständlich ihre Anwendung manchmal erscheinen mag, immer nur neue Gewalt verursacht. Darauf sollten sich die Staaten konzentrieren – nicht auf Wasserflaschen im Flugzeug.
Der Kontrollstaat erzieht seine Bürger
Hat der Kontrollstaat für jede Lebenslage Gesetze und Verordnungen geschaffen, ist er noch immer nicht zufrieden. Das beweist er etwa in der Kampfzone Rauchen. Es reicht ihm nicht, die Raucher mit Nichtraucherzonen in Parks oder an Stränden sogar unter freiem Himmel in immer engere Ghettos zurückzudrängen. Zusätzlich sorgt er dafür, dass jede Zigarettenpackung mit Schockbildern versehen ist. Die EU verschärft ihre Tabakrichtlinie in diesem Punkt laufend. Neben der Steuerbanderole bleibt für den Namen der Marke immer weniger Platz. Vorbild ist Australien. Dort bestehen Zigarettenschachteln künftig fast nur noch aus Schockbildern und Warnungen.
Ein bisschen Aufklärung ist schon in Ordnung.
Rauchen hat ohne Zweifel unangenehme Nebenwirkungen. Herzinfarkt, Lungenkrebs, Raucherbein und so weiter. Es verfärbt Zähne und Finger und verpestet die Luft. Bloß geht es dem Kontrollstaat inzwischen nicht mehr um Aufklärung.
Die legitimen Vorhaben, Konsumenten besser zu informieren, einen Beitrag zu ihrer Gesundheit zu leisten und der mächtigen Tabakindustrie ihre Grenzen zu zeigen, sind nur noch Vorwand. Denn dass Zigaretten außerordentlich ungesund sind, weiß inzwischen jeder.
Die Frage ist, worum es dem Kontrollstaat wirklich geht. Die Antwort ist einfach. Es geht ihm um Erziehung. Der Staat agiert inzwischen wie eine Erziehungsanstalt, die alle Bürger als Insassen betrachtet und in jeden ihrer Lebensbereiche eingreift.
Dass sich seine Erziehungsmaßnahmen nicht auf das Rauchen beschränken, ist auch klar. Als nächstes wird er sie auf Lebensmittel ausweiten.
Limonaden und Triple-Burger sind auch ungesund.
Der New Yorker Bürgermeister wollte bereits die Bechergröße für stark zuckerhaltige Softdrinks begrenzen. Er ist nur knapp damit gescheitert, aber ich wette, dass sich dutzende europäische Politiker die Forderung vorgemerkt haben und sie früher oder später stellen werden. Der Kontrollstaat ist bereit, bei der Erziehung seiner Bürger sehr weit zu gehen. Lehrer dürfen Schüler, die ihnen nicht artig genug erscheinen, zum Schulpsychologen schicken, und die Exekutive darf in vielen Ländern Schnellfahrer zum Verkehrspsychologen schicken. Jemand verletzt Regeln, also ist er wahrscheinlich psychisch gestört oder zumindest labil. Eine Schlussfolgerung, die ein Staat, der ein respektvolles Menschenbild pflegt, so nie ohne Weiteres ziehen würde.
Ein bisschen Psychologie hat noch keinem geschadet.
Die Wahrheit ist, dass sich hinter dieser Idee eine der dunkelsten Seiten des Kontrollstaates verbirgt. Maßt er sich einmal an, per Gesetz auf die Psyche von Bürgern zuzugreifen, fallen Grenzen. Denn aus dem Psychologen wird im nächsten Schritt ein Psychiater und aus dem Psychiater die Zwangspsychiatrie.
Der Kontrollstaat nimmt sich schon jetzt das Recht, seine Bürger zwangsweise zu psychiatrieren. Ein psychologisches Gutachten über auffälliges Verhalten kann reichen, um einen Bürger in eine geschlossene Anstalt zu bringen, wo ihn Ärzte gegen seinen Willen mit bewusstseinsverändernden Psychopharmaka, Elektroschocks oder psychiatrischer Chirurgie behandeln dürfen.
Wenn es schlecht für so einen Bürger läuft, kommt er nie wieder heraus, obwohl die Gutachten, die dem zugrunde liegen, oft von mangelhafter Qualität sind – und nie der letzte Schluss sein können, weil die Psychiatrie keine exakte Wissenschaft ist. Studienautoren haben gesunde Menschen mit einer falschen Diagnose zu Psychiatern geschickt, von denen keiner gemerkt hat, dass die vermeintlichen Patienten in Wirklichkeit gesund waren. Gemerkt haben das nur die anderen Insassen der psychiatrischen Klinik.
Erst im Frühjahr 2013 hat die EU darauf hingewiesen, dass psychiatrische Zwangsbehandlungen ein Verstoß gegen die Menschenrechte sind. An der Praxis hat das bisher nichts geändert. Der Kontrollstaat lässt sich dieses Disziplinierungsinstrument nicht so leicht nehmen. Im Gegenteil. Er wird es ausbauen.
Dann landet irgendwann ein unhöflicher Flugpassagier oder ein notorischer Temposünder hinter den Gittern der Zwangspsychiatrie, und jedes Mal, wenn er eine Pflegerin anschnauzt, erhöht ein Psychiater seine Medikamentendosis. Bis er so kaputt ist, dass er im normalen Leben tatsächlich nicht mehr zurecht kommen würde.
Die Privatsphäre ist dem Kontrollstaat egal
Die amerikanischen Behörden verstehen überhaupt keinen Spaß, wenn Privatpersonen die Privatsphäre anderer verletzen. Das haben sie in Steubenville im US-Bundesstaat Ohio bewiesen. Dort ging der damals 26-jährige IT-Mann Deric Lostutter im Frühjahr 2013 zur Tür, weil es geläutet hatte. Er erwartete den Botenfahrer eines Paketdienstes, doch als er öffnete, sprangen zwölf Swat-Agenten in voller Montur aus einem Lieferwagen und zielten mit entsicherten M16-Sturmgewehren auf seinen Kopf. „Get the fuck down“, schrien sie Lostutter an, der sich keines Unrechtes, das einen dermaßen heftigen Polizeieinsatz gerechtfertigt hätte, bewusst war.
Den Grund dafür erfuhr er wenig später. Er hatte seine IT-Kenntnisse genutzt, um mit Mitgliedern des Anonymous-Kollektivs gegen die Vergewaltiger einer 16-jährigen aus seiner Heimatstadt vorzugehen. Gemeinsam kaperten sie die Internetseite der Täter und stellten Tweets online, in denen die Täter sich über ihr Opfer lustig gemacht hatten. Lostutter und seine Mitstreiter hatten die Täter aufgefordert, sich bei ihrem Opfer zu entschuldigen. Lostutter droht bis zu zehn Jahre Haft für die Hackerattacke. Die Vergewaltiger erhielten ein Jahr beziehungsweise zwei Jahre.
Geht es um ihre eigenen Interessen, legen die USA und Europa in Sachen Privatsphäre einen ganz anderen Maßstab an, wie die von Edward Snowden aufgedeckten Spähprogramme der Geheimdienste beweisen. Relativ ungestraft, wie sich gezeigt hat. Obwohl die nsa tausendfach ihre Kompetenzen überschritten hat, reichten ihr ein paar Entschuldigungen. Die Betroffenheit blieb oberflächlich.
Da müsste doch jemand einen Film draus machen.
Der Generation, die nach der Entstehung des Internets geboren wurde, waren die Spähprogramme egal, weil sie schon in dem Bewusstsein sozialisiert worden war, dass ohnedies jede Kommunikation öffentliche Kommunikation ist. Den älteren Generationen war es egal, weil sie gelernt hatten, dass sie gegen die da oben sowieso nichts ausrichten können.
„Wenn ich in Ihre E-Mails oder in das Telefon Ihrer Frau hineinsehen hätte wollen, hätte ich nur die abgefangenen Daten aufrufen müssen. Ich konnte Ihre E-Mails, Passwörter, Gesprächsdaten und Kreditkarteninformationen bekommen“, sagte Snowden. In so einer Welt, sagte Snowden, wolle er nicht leben. Doch diesen Gedanken lässt kaum jemand zu.
Ich will es gar nicht so genau wissen.
Die Mehrheit fügt sich in das scheinbar unabänderliche, erhält sich durch Wegsehen zumindest eine Illusion von Privatsphäre und klammert sich an die beschwichtigenden Worte der verantwortlichen Politiker. Dabei hätte ihnen von jenen Barack Obamas anlässlich des Auffliegens des NSA-Skandals erst recht schlecht werden müssen. Unternehmen, meinte Obama dabei unter anderem, würden beim Datensammeln noch viel weiter gehen als der amerikanische Staat.
Ich bin nicht wichtig genug.
Das stimmt damit endgültig nicht mehr. Denn Konsumentist jeder, und werden Informationen einmal erfasst und strukturiert abgespeichert, sind sie irgendwann auch öffentlich. Das ist nur eine Frage der Zeit. In jeder Behörde gibt es jemanden, der korrupt oder schlampig ist, oder einfach gerne redet. Im August 2013 berichtete das Nachrichtenmagazin Spiegel, dass das Apothekenrechenzentrum vsa Patientendaten verkaufte. Dies zwar verschlüsselt, womit die Sache legal wäre, bloß war die Verschlüsselung leicht zu knacken. Auf diese Art konnten hoch vertrauliche Patientendaten theoretisch an Pharmakonzerne oder Marktforscher gelangen, oder an jeden anderen, der sie haben wollte. Preis pro Datensatz: 1,5 Cent. Wenn es nicht einmal die amerikanischen Geheimdienste schaffen, Informationen geheim zu halten, schaffen es auch andere Behörden nicht, und schon gar nicht Konzerne. Irgendwann weiß dann jeder, der die richtige Funktion hat, genug für die Information bezahlt oder eine Plaudertasche besoffen macht, in jeder Hinsicht über jeden Bürger besser Bescheid, als dieser über sich selbst.
Wie egal der EU die Privatsphäre ist, hat sie auch schon bewiesen. Nicht nur bei der Beteiligung an amerikanischen Spähprogrammen. Zuletzt etwa bei der Abschaffung des Bankgeheimnisses. In Deutschland können schon seit 2005 staatliche Stellen auf die Daten aller Bankkunden zugreifen, und zwar ohne richterliche Erlaubnis. Auch ein konkreter Verdacht auf eine strafbare Handlung ist nicht nötig. Die Exekutive informiert die Kontoinhaber nicht einmal über die Abfragen. Sie holt sich einfach, was sie braucht. Die Banken müssen dafür eigene Dateien mit den Kontostammdaten führen. Sie speichern dort die Kontonummer, das Eröffnungs- und Auflösungsdatum sowie die Namen und die Geburtsdaten der Verfügungsberechtigten. Gerichte, Staatsanwaltschaften, die Polizei, Finanzämter, Zollfahnder und Sozialversicherungen können darauf zugreifen. Außerdem Behörden, die für die Vergabe der Sozialhilfe, der Wohnraumförderung, der Ausbildungsförderung, des Erziehungsgelds und des Wohngelds zuständig sind. Seit 2013 können auch Gerichtsvollzieher Einblick nehmen.
In den vergangenen Jahren hat sich in Deutschland die Zahl der behördlichen Kontoabfragen zu Privatpersonen mehr als verdoppelt. Allein 2012 gab es einen Anstieg um 15,5 Prozent auf 72 000 Abfragen. Besonders neugierig sind die Finanzämter. Sie fragen nicht nur nach, wenn sie die Richtigkeit der Angaben auf einem Steuerbescheid anzweifeln. Auch Schulden können sie so leichter eintreiben.
Bisher erhalten die Behörden nur Auskunft über die Stammdaten. Doch es ist nur noch ein kleiner Schritt bis zur staatlichen Einsichtnahme in Kontostände und -Umsätze. Die Grenzen lösen sich bereits auf. Bei konkretem Verdacht auf Steuerbetrug und andere strafbare Handlungen müssen die Banken schon jetzt auch diese Informationen herausgeben. Entdecken Finanzämter oder andere Behörden Konten oder Wertpapierdepots, die der Eigentümer gegenüber dem Staat absichtlich oder unabsichtlich verschwiegen hat, besteht so ein konkreter Verdacht bereits.
Datenschützer haben sich vergeblich gegen diese Methoden gewehrt. Nach mehreren Klagen hat das deutsche Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Rechtslage verfassungskonform ist. Im Sinne einer europaweit einheitlichen Regelung hat die EU dafür gesorgt, dass 2013 auch ihre letzten Mitgliedsstaaten das Bankgeheimnis abgeschafft haben. Beim G8-Gipfel 2013, der in einem nordirischen Golfhotel der Luxusklasse stattfand, stand dann auch der internationale Austausch von Bankdaten einschließlich der Kontostände zur Diskussion.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.