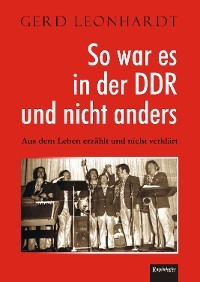Kitabı oku: «So war es in der DDR und nicht anders», sayfa 3
Die Arbeit
„In der „DDR“ kann jeder werden, was er will“. So lautete ein Spruch der SED, und ich füge hinzu: „Jeder kann werden, was er will, ob er will oder nicht!“ Die Berufswahl verlief ganz einfach. Man ging zu einem „Beratungsgespräch“ in das Rathaus, und dort wurde jedem jungen Menschen, der einen Beruf erlernen „musste“, gesagt, welche Möglichkeiten es gerade noch gab. Natürlich adäquat zu den Zeugnissen. Ich wollte in einem Musikgeschäft Verkäufer lernen. Es existierten noch zwei Privatgeschäfte in meiner Stadt, aber ohne die Möglichkeit, dort jemanden ausbilden, und dies aus den allseits bekannten Gründen. Also sagte man mir: „Wir haben noch einen Platz als Pelztierzüchter, das ist einmalig in der DDR. Da wird viel Geld verdient. Alles andere ist schon vergeben.“ Und da es kein Wartejahr gab wie im vereinigten Deutschland, musste ich einen Lehrvertrag abschließen. Zuvor war ich noch gefragt worden, ob ich tierlieb sei.
Somit waren die „Sache“ und das „Beratungsgespräch“ beendet. Meinen Beruf als Pelztierzüchter konnte ich kurz nach Beendigung der Lehre nicht mehr ausführen, weil dieser Betrieb geschlossen wurde. Den Nutrias und Nerzen hatte es scheinbar auch nicht gefallen, denn sie rissen entweder reihenweise aus oder wurden gestohlen. Zumal es viele Beschwerden hagelte, da sich gegenüber die volkseigene Brotunion befand. Nun zeigte sich im ganzen Bezirk Karl-Marx-Stadt keine Möglichkeit, meinen erlernten Beruf weiterzuführen. Nach zwei bis drei Arbeitsstellen bewarb ich mich bei den städtischen Theatern als Bühnentechniker, auch „Kulissenschieber“ genannt. Hier kam wieder etwas „Wärme“ in meinen Körper, denn ich konnte fast jeden Abend kostenlos im Opernhaus sein. Es war mehr die klassische Musik, die mich bewog diesen Schritt zu tun, mehr als Kulissen hin und her zu schieben. Die Beatmusik konnte ich erst einmal an den Nagel hängen, da ich annähernd jedes Wochenende im Opernhaus Dienst hatte. Es gab aber ein Hauptdepot für die beiden Theater, wo sämtliche Dinge für das Musiktheater, das Schauspiel und die Requisite aufbewahrt wurden. Dort setzte ich mich die nächsten fünf Jahre fest. Zur gleichen Zeit wurde die „Singakademie Karl-Marx-Stadt“ gegründet, ein Amateur-Chor mit etwa 160 Mitgliedern. Der Chorepetitor war gleichzeitig Leiter des Opernchores, in welchem ich sofort dabei war und für den Kammerchor herausgepickt wurde. Mit dem ganzen Chor führten wir viele berühmte Chorwerke auf. Von Orffs „Carmina burana“ bis Händels „Messias“ wurde die ganze Bandbreite durchgequirlt. Ich versuchte die Möglichkeit auszuloten, beruflich so schnell wie möglich in die Sangeskunst einzusteigen. Obgleich ich hin und her gerissen wurde zwischen Oper und Beat. Ich nahm Privatgesangsunterricht. Dieser war für mich kostenlos, da ich sozusagen im „Betrieb“ arbeitete und mit der Maßgabe studierte, als Chorist in drei bis vier Jahren eingestellt zu werden. Diese Möglichkeit war in der DDR gegeben, falls das entsprechende musikalische, sängerische und „politische“ Niveau vorhanden war. Bei letzterem musste ich etwas „vorspielen“, was jedoch normal war. Genau dieses Verstellen fiel mir schwer. Ich hielt besser den Mund!
In der Oper war die sozialistische Ausrichtung ebenfalls zu sehen und zu spüren. Als man im Jahr 1965 die „Aida“ inszenierte, wurde der Einmarsch der Wehrmacht in Österreich nachempfunden. An den Portalen stand mit Eichenlaub und in Goldschrift zu lesen: „Kanonen statt Butter“. Überall gab es Leute, die entweder alles noch marschmäßiger aufziehen oder mit einer Inszenierung Protest ausdrücken wollten. Genauso wie am „Deutschen Theater“ in Berlin. Hier trat 1963 der Intendant zurück, weil das Stück „Die Sorgen und die Macht“ von der Kulturkommission verboten wurde. Und dies in jenem Theater, welches nach dem Krieg am 07.09.1945 als erstes wieder eröffnet wurde. Es gab viele derartiger Dinge, die aber größtenteils unter den Tisch gekehrt wurden, falls sich eine Möglichkeit dafür bot.
1968 und der von der „Links-Partei“ vergessene Einmarsch in die CSSR
In den Staaten des „Warschauer Vertrages“ wurde ein jedes mit der sowjetischen Eisenhand geregelt. Sämtliche „Regierungen“ in den „Bruderstaaten“ waren Lakaien und Speichellecker Moskaus, mit Abstrichen gegenüber Albanien und Jugoslawien, denn Tito hatte seinen Krieg selbst gewonnen. Ihren Frust, dass alles nicht so gelang, wie man es sich laut Marx und Engels vorgestellt hatte, luden diese Roten Faschisten bei den Bürgern ab. Logisch, dass es ab und zu wieder einmal „Ärger“ geben würde. So geschah es auch 1968. Zufälligerweise drehte man in Prag einen Film über den Zweiten Weltkrieg, dazu wurden 20 Panzer amerikanischer Herkunft gebraucht. Diese fuhren dann aus Bayern auch in die tschechischen „Barrandov“-Filmstudios. Manche Funktionäre hatten jenen Einsatz schon als den verfrühten „Prager Frühling“ verstanden. Dubcek, der neue Vertreter Moskaus, wollte seinem Volk etwas mehr Freiheit und wirkliche Demokratie anbieten, und er meinte es ernst. Das Resultat: Wir mussten im August des Jahres 1968 mit den anderen „Bruderarmeen“ in die Tschechoslowakei einmarschieren, um den „Imperialismus“ abzuwehren. Mehrere Wochen lang wurden im Kreis Marienberg (Oberes Erzgebirge) große Truppenkontingente der NVA und der Sowjetarmee zusammengezogen. Als Grund gab man an, dass „Konterrevolutionäre Elemente“ gemeinsam mit der NATO einen Überfall auf die Bruderländer beabsichtigen. Genau jenem Streben sollte „vorgebeugt“ werden. Während unsere Truppen sich etwas „arrogant“ zeigten und zurückhielten, ließen die Russen die Sau raus. Sämtliche Wälder der Region waren voll mit russischem Dung und der „Prawda“. Wir kamen später dort an, und die „Iwans“ marschierten als erste rein. Ich wähle bewusst dieses Schimpfwort im Zusammenhang mit dieser Intervention! Im Süden gingen schon die Ungarn über die Grenze. Wir waren etwas danach dran. Die russischen Einheiten der Rückwärtigen Dienste bildeten eine LKW-Schlange, die Fahrzeug an Fahrzeug von Karl-Marx-Stadt bis nach Prag reichte – und dies in beide Richtungen. Nein, das waren keine Divisionen, sondern ganze Armeen, welche einmarschierten. Die sowjetischen Panzer fuhren durch mehrere Dörfer kerzengeradeaus und durchbrachen viele Häuser einfach so und ohne jegliche Rücksicht. Wer sich in den Weg stellte – und derer gab es viele – wurde ohne zu zögern überrollt. In Bärenstein sahen wir die ersten Resultate. In der gegenüberliegenden Stadt Weipert stand mit übergroßen Buchstaben auf mehreren Dächern zu lesen: „1938 Hitler – 1968 Ulbricht!“ Uns wurde es, bis auf wenige Ausnahmen, speiübel. Zu diesen Verbrechern wollte ich nicht gehören, denn Jahre später haben wir zu einen Blasmusikorchester in Nejdek, früher Neudek, sehr gute freundschaftliche Verbindungen aufgebaut. Sie haben uns auch mehrere Dörfer gezeigt, wo diese Truppen einst durchfuhren. Zum ersten Mal seit Bestehen der Mauer war ich froh, wieder in der DDR zu sein! Meine Wut auf das Militär war unvorstellbar. Verständlich, denn mein Vater musste auch für einen verbrecherischen Krieg sein Leben hergeben.
Der überaus beliebte Dubcek wurde nach Russland bestellt und abgesetzt. Wenige Jahre früher hätten die Sowjets mit solchen ehrlichen freiheitsliebenden Menschen, wie Dubcek einer war, die Todesstrafe verhängt. Für ihn installierte man den Kommunisten Husak, den großen „Freund“ Honeckers. Wie sagt doch der zynische Philosoph? „Der Krieg ist ein Nebenprodukt der Friedenskunst.“ Aha! Siehe „Bush Junior“!
Die Arbeit und die Kunst
Inzwischen hatte ich ein neues Instrument „entdeckt“, nämlich die Bassgitarre. Gleichzeitig absolvierte ich ein Teildirektstudium für Bass und Tuba. Bass in Dresden und Tuba beim Ersten Bassisten im Opernhaus Karl-Marx-Stadt.
Im Jahr 1969 sang ich am Opernhaus in Karl-Marx-Stadt vor, wurde aber nicht engagiert. Zwar sagte man mir:“Sie haben ausgezeichnet gesungen ...“, doch es ist so „Tradition“, wer nicht direkt von der Schule kommt, fällt erst einmal durch. Ein Jahr später bekam ich meinen Vertrag, und hier gleich als Chorsolist.
Ich hatte Glück, da ein sehr guter erster Tenor an die „Komische Oper“ nach Berlin gehen durfte. So wurde ich, zum Neidwesen verschiedener Kollegen, in allen Inszenierungen an dessen Stelle gesetzt, und diese war meistens ganz vorn.
„Unsere“ Gastarbeiter!?
Im östlichen Teilstaat gab es genügend Arbeit für alle. Die Löhne wurden tief gehalten und demzufolge immer und überall Arbeitskräfte gesucht. Das Dilemma begann etwa im Jahr 1964. Viele neue und große, staatlich bezahlte Wohnungen wurden gebaut. Die meisten zwar in Ostberlin, doch der Rest kam auch nicht schlecht weg. Die meisten Betriebe in und um Chemnitz waren oder wurden wieder aufgebaut. Nur vielen Werken fehlten ausreichend Mitarbeiter. So entschloss sich die nicht gewählte Regierung der DDR, aus den befreundeten Staaten Arbeiter zu rekrutieren. Zuerst wurden Verträge mit Ungarn abgeschlossen, um für eine bestimmte Zeit Bürger dieses Landes bei uns arbeiten zu lassen, da es dort weniger Arbeit gab.
Die ehemalige Gießereifirma „Krautheim“ in Borna bei Karl-Marx-Stadt suchte seit langem viele Mitarbeiter. Hier kamen nun die ersten ungarischen Bürger an, junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Kurzerhand baute man für sie, in der Nähe des Betriebes, eine große Baracke für etwa 50 bis 60 Personen, und die Sache schien gelaufen. Weit gefehlt! Allen Ungarn hatten die „Herrschaften“ in Ostberlin ein höheres Gehalt versprochen als den Einheimischen, und dies auch gehalten. Wenige Zeit später gab es Krawall. Durch einen Freund von mir, der dort arbeitete, erfuhr ich alles brühwarm. Es wurde eine Versammlung in der großen Betriebskantine anberaumt. „Die Ungarn kriegen mehr Geld als wir“, so lautete der Protest. Der Vertreter der Gewerkschaft, die letztendlich keine war, erklärte, alle sollten weiter arbeiten und die Sache würde geregelt. Nichts da! Keiner der Arbeiter stand auf. Die Alteingesessenen protestierten: „Das kommt gar nicht in Frage, jetzt wird das geklärt!“ Dann erschien wohl noch die „BPO“, also die Betriebsparteiorganisation der SED oder auch Unterorganisation der Staatssicherheit. Dies führte letztendlich zu der Regelung, dass ein jeder etwas davon haben sollte: Die Ungarn bekamen Arbeit und die Deutschen etwas mehr Geld. Weil die „Gastarbeiter“ aus Ungarn eine Minimiete bezahlen sollten, wurde diese daraufhin noch weiter gekürzt, und somit war der erste Frieden gerettet.
Wohnungen waren knapp, und jeder, der in seinem Betrieb einen AWG-Vertrag abschließen konnte, war froh. Derjenige wusste, in ein paar Jahren konnte er mit der Familie eine staatsfinanzierte Neubauwohnung beziehen. Die AWG, genannt „Arbeiter- und Wohnungsbaugenossenschaft“, war eine staatlich-betriebliche Organisation, in die eigentlich jeder eintreten konnte. Er sollte jedoch verheiratet sein, wenigstens ein Kind haben, in Schicht arbeiten oder auch bei den bewaffneten Organen tätig sein. Hinzu kamen noch viele andere Aspekte die bei einer solchen Vergabe die entscheidende Rolle spielten. Ein Teil wurde auch vom Staat, sprich vom entsprechenden Betrieb, mitfinanziert, und der andere Teil musste bezahlt und mit Eigenleistungen erbracht werden.
Kurze Zeit danach kam der nächste Mitarbeiter-Schub aus Ungarn. Und diesen neuen Arbeitskräften wurde mitten in der Stadt ein komplettes Hochhaus zugesagt. Dieses Haus war gerade erst fertiggestellt worden, und die Bürger von Karl-Marx-Stadt sollten dort einziehen. Viele der Ein-, Drei- und Vierraumwohnungen waren bereits für die Bürger der Stadt eingeplant, und sie hatten jahrelang gewartet. Rigoros wurde ihnen mitgeteilt, es gäbe im Moment noch keine Wohnungen. Wie war das doch mit dem „Staatseigentum“? Wer sind denn nun die Herren in der DDR? Die einfachen Bürger keinesfalls. Dieses Hochhaus wurde daraufhin im Volksmund auch „Paprikaturm“ genannt. Nichts gegen die ungarischen Bürger, sie freuten sich und hatten Arbeit. Die Mädchen aus der Stadt belagerten förmlich den „heißen“ Turm, und wir versuchten mit ihnen auszukommen.
Da es in Borna (bei Karl-Marx-Stadt) nur zwei Gaststätten gab, waren die „Buden“ abends immer voll. Voll waren sie aber auch schon, bevor die Ungarn kamen. Also zeigten sich langsam die ersten Spannungen. Man versuchte zuerst noch im Billardländerwettkampf die dicke Luft zu zerstäuben, doch nachdem die beiden Seiten genügend verloren hatten, kam, was kommen musste: Wir standen uns im Weg. Meine Freunde und ich hielten uns raus aus den „Plänkeleien“. Erst gab es fast jeden Tag abends Keilereien, und später stahlen ein paar Idioten den Ungarn ihre Motorräder, die sie sich hart erarbeitet hatten. Aber es sollte noch anders kommen.
Im Laufe der nächsten Jahre wurden verschiedene Gebiete der DDR, in denen die Industrie vorrangig war, mit „Saisonarbeitern“ förmlich überschwemmt. Nach den Ungarn trafen die Polen in unserer Stadt ein.
Da jeder Arbeit hatte, konnte auch niemand sagen, die würden uns die Arbeit wegnehmen. Nein, ganz im Gegenteil! In der DDR hatte ein jeder laut Gesetz nicht nur das „Recht auf Arbeit, sondern auch die Pflicht zur Arbeit“. Wer länger als eine Woche keiner geregelten Tätigkeit nachging, konnte von der Volkspolizei vorgeführt werden und wegen „Landstreicherei“ – Sie kennen das schon – mit Gefängnis bestraft werden! In diesem Staat existierten keine Arbeitslosen. Wer nicht arbeitete, erhielt auch kein Geld! Es gab keine Sozialhilfe oder ähnliches. Warum auch? Arbeit war mehr als ausreichend vorhanden, und qualifizieren konnte sich jeder. Natürlich blieb den meisten ihr Berufswunsch verwehrt, aber zählt das, wenn man überhaupt erst einmal Arbeit hat?!
Mit den Polen kamen die ersten weiblichen Arbeitskräfte, die auch in der DDR einen Berufsabschluss machen konnten. Die polnischen Arbeiter verstreute man im ganzen Land, von Frankfurt/Oder bis nach Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Im Norden waren viele Frauen von ihnen in der Fleischindustrie beschäftigt, wo man sich im Fernsehen darüber beschwerte, die Deutschen würden zu schnell arbeiten. Im Süden waren sie beim VEB „Kupferring“ im Erzgebirge tätig. Ich habe vereinzelte Polinnen kennengelernt. Darunter fanden sich einige bildhübsche junge Damen. Nur die Zähne – eine sehr traurige Kombination! Des Weiteren kamen nach Karl-Marx-Stadt Menschen aus Bulgarien, Kuba (genannt Kubbis), Vietnam (genannt Fidschis), Mosambikaner (genannt Mosis) und Russen, diese vertreten in der gesamten DDR mit über 750 Stützpunkten! Aber letztere waren nicht zum Arbeiten da, sondern um auf uns aufzupassen und auszubeuten. Es waren ja unsere „Brüder“, und diese werden einem ja vorgesetzt! Freunde kann man sich bekanntlich aussuchen. Viele der „Saisonarbeiter“ konnten ihren ersten ordentlichen Beruf erlernen, den sie dann in ihrer Heimat ausüben konnten. Im Allgemeinen waren sie so zwischen drei bis sieben Jahren da, um anschließend mit anderen Mitbürgern ihres Staates ausgetauscht zu werden. Dies erwies sich für die DDR als große Stütze, zumal ja der Ostteil Deutschlands in Osteuropa das „Aushängeschild“ war und Vorbildcharakter haben sollte. In den Jahren 1969 bis 1970 ging es nach unseren bescheidenen Lebensvorstellungen wohl auch ganz schön vorwärts. Ulbricht musste etwas tun, sprich einkaufen, denn die Genossen hatten sich kurz nach dem Bau der Mauer verpflichtet, in sieben Jahren die Bundesrepublik Deutschland nicht nur einzuholen. Nein, es galt der Spruch: „Überholen ohne einzuholen.“ Ein sinnloser Versuch, die florierende Marktwirtschaft im Westen mit „Rotem Terror“ und Unterdrückung der Bevölkerung gleichzusetzen.
Wie sagte man doch so schön: „Zwei Apfelsinen im Jahr und zum Parteitag Bananen.“

Allein die Tatsache, dass ein Teil unserer „Gastarbeiter“ den in der DDR ausgeführten Beruf in ihrer Heimat gar nicht ausüben konnte, war den Politquacksalbern in Ostberlin egal. Also schnappten sich viele junge „Zeitgastarbeiter“ eine einheimische Frau, und die wurde auch geheiratet. Das Ende vom Lied, sie brauchten nicht wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Nicht umsonst ist der Ostteil Deutschlands mit ehemaligen Bürgern aus diesen Staaten gut „besetzt“.
Hier aber ein Schnitt! Alle wussten, nur wer arbeitet, durfte bleiben. Damals gab es in Ostdeutschland, dank fehlender Arbeitsloser, auch keine Sozialhilfe.
Die Bevölkerung reagierte zusehends sauer, denn ein großer Prozentanteil des staatlichen Wohnungsbaus wurde nur für diese Gastarbeiter verbaut. Wenn wieder einmal ein paar Tausend '„Saisonarbeitskräfte“ nach Vertragsende in ihre Heimat fuhren, mussten sämtliche Häuser komplett renoviert werden. Natürlich erfolgte das auf Kosten der Bevölkerung. Ganze Horden ausländischer Krawallmacher zogen besonders an den Wochenenden durch die Stadt und liefen ganz bewusst dorthin, wo es „rundging“. Da gab es eine Großgaststätte, in welcher ich später auch musikalisch gastierte, mit dem wohlklingenden Namen „Schlachthof“. In der Nachbarschaft war der Stadtschlachthof und davor befand sich ein Hotel mit gleichnamigem Tanzsaal. Also schon vom Namen her der „ideale“ Platz, um die „Friedliche Völkerverständigung“, wie es in Ostberlin hieß, praktisch zu erleben und mit „Leben zu erfüllen“.
Langsam wurde es auch zur Gewohnheit, dass inzwischen schon die schönsten und größten Wohnungen mit der besten Sicht auf die Innenstadt den Bürgern aus fernen Ländern vorbehalten war. So auch nach dem Putsch in Chile. Mehrere Tausend Chilenen suchten Zuflucht in die DDR und wurden logischerweise großzügig unterstützt von unserer nicht gewählten Regierung. Hunderte Großplattenwohnungen wurden den Immigranten voll möbliert zur Verfügung gestellt! Als letzte Gruppe kamen ein paar Hundert junge Menschen aus Libyen zu uns. Hier kündigte man uns an, sie seien allesamt „Arbeiterkinder“, denen es nicht so gut gehe wie uns. Die Bürger waren aber gar nicht so arm, wie man uns beizubringen versuchte, denn ihre frei konvertierbare Währung – davon hatten sie überaus reichlich – war sehr beliebt bei den jungen ostdeutschen Damen. Schließlich konnte man damit im „Intershop“ einkaufen. Wer es nicht weiß, ein „Intershop“ in der DDR war ein Geschäft, in dem man Waren aus der BRD kaufen konnte und gar noch etwas billiger als dort.
Jetzt aber etwas zum Lachen. Eine der breitesten Straßen in Karl-Marx-Stadt war die Karl-Marx-Allee in der Mitte der Stadt. Direkt vor dem Haus der ehemaligen SED-Bezirksleitung hatte der sowjetische Bildhauer Lew Kerbel im Jahr 1971 seinen überdimensionalen 12 Meter hohen Karl-Marx-Kopf aufgestellt. Und dieser Kopf schaute direkt gegenüber in den „Intershop“ hinein. Was wird Karl bloß so gedacht haben über unsere DDR-“Aluminiumwährung“? Die Straße heißt heute noch die „Die Schädelgasse“.
Die Libyschen Jungen waren sehr beliebt bei den Mädchen, denn sie hatten richtiges Geld und lachten über uns Deppen. Obwohl – ich möchte mich nicht beschweren. Ab und zu haben wir auch als Musiker später in der „Hofbar“ oder der „Jalta Bar“ bei der praktischen Ausübung unserer Kunst „DDR-Geld“ getauscht, und zwar in Dollars. Wir büßten zwar etwas ein, doch für ein paar gute Rasierklingen und ein Parfüm für die Frauen war uns der Tausch schon wert. Diese Möglichkeit aber hatten nur wenige Menschen bis auf jene, deren Verwandte im freien Teil Deutschlands lebten. Und nicht jeder, der Verwandte „drüben“ hatte, bekam auch selbst Pakete in die DDR geschickt.
Vielen Bürgern waren speziell die Libyer ein Dorn im Auge. Extra ihretwegen wurde eine spezielle Mensa gebaut. Diese Gruppe bildeten Studenten mit Privilegien. Wahrscheinlich nur deshalb, weil sie hartes Geld hatten, bekamen sie auch Silberbesteck und keines aus Aluminium wie die anderen Kommilitonen. Ja, und eine Ärztin war immer für sie in Bereitschaft. Daran sieht man schon den traurigen Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Während die Bürger der „Bruderländer“ in die großen preiswerten älteren Tanzlokale gingen, bevölkerten die Bürger aus westlichen Staaten die teureren Bars dieser Stadt und ließen es sich auch anmerken, dass sie dank der richtigen Währung weitaus beliebter waren. Ein reinweg unzumutbarer Zustand!
Nun gut, eine Währung hatten wir auch. Zum Beispiel lag der Einzelhandelsumsatz pro Kopf der Bevölkerung der DDR für Nahrung und Genussmittel bei 3.400 Mark der DDR. So wenig? Das Brötchen kostete ja auch nur 5 Pfennig. Und nach drei Tagen konnte man es als Hammer benutzen. Aber für zwei Tage war es verzehrbar. Das Brot schnitt mit 52 Pfennig ebenso gut ab. Nur nach fünf Tagen begann es schon zu schimmeln, da es sehr schlecht gebacken wurde und zu frisch war. Außerdem war der Laib nicht doppelt gebacken, wie dies bei einem guten Bäckerbrot üblich ist. Das Viertel Kaffee kostete 8,75 Mark, und das war nicht nur zu teuer, sondern er hatte auch eine grauenvolle Qualität. Kaffee musste auf den Weltmarkt für Dollar eingekauft werden, und dafür hatten die Genossen kein Geld übrig. Bier nannten wir „Sterbehilfe“, da selbiges nach drei Tagen aussah, als schwämmen Hunderte von Wasserflöhen darin.
Also, bei denen da oben sparte man nicht. Wir kommen noch später darauf zurück.
Für Industrieerzeugnisse gaben die DDR-Bürger 3.200 Mark aus im Schnitt. Der Durchschnittslohn lag bei etwa 850 bis 900 Mark. Viele Menschen in der DDR waren es jedoch gewohnt, „nebenbei“ noch ein paar Kleinigkeiten zu „erledigen“. Ein Spruch hieß nicht umsonst: „Man war gelernter DDR Bürger.“
Churchill gebrauchte als erster den Spruch vom „Eisernen Vorhang“. Nur wenn man in einer sozialistischen Mangel- und Betrugswirtschaft aufwächst, bekommt man Ideen, das nicht Vorhandene trotzdem aufzutreiben. Erwartung in der DDR – das war ein Geisteszustand, dem auf der Skala menschlicher Gefühle die Hoffnung vorausgeht und die Verzweiflung folgt.
In der Musik gibt es den „Trugschluss“, der die kadenzierende Dominante nicht immer zur Tonika zurückführt, sondern vielleicht die Tonikaparallele zum Schluss behält. Genauso verhielt es sich mit dem gelernten DDR-Bürger. Der normale Weg in das Geschäft war sinnlos, um fünf Sack Zement zu kaufen. Also machte man dem Nachbarn, Freund oder Bekannten ein Angebot für etwas, das jener eben nicht hat. Man tauschte eben wie zur Hamsterzeit.
Zur Erklärung: Die Hamsterzeit begann nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Menschen, vor allem Frauen, fuhren mit dem, was man noch besaß, um es in anderen Gegenden einzutauschen, damit die Kinder, die größtenteils keinen Vater mehr hatten, etwas zu essen bekamen. Nur als Hinweis: In meiner Klasse, ich bin 1950 eingeschult worden, waren wir 26 Kinder. Davon hatten ganze drei einen Vater! Noch im Jahr 1989, also kurz vor „Ladenschluss“, war die Hamster- und Tauschzeit in der DDR aktueller denn je!
Am besten war derjenige im Ostteil Deutschlands dran, der „Westgeld“ sein Eigen nannte, denn damit konnte man alles erwerben. Nach dem Bau der Mauer brauchte die Führung der DDR wahre Unmengen guten Stahls, um die Grenzanlagen auszubauen mit Selbstschussanlagen und vielen anderen netten Überraschungen. Genau das kostete dem Staat viel Geld, also mussten Devisen ran. Wer Westgeld besaß, musste es sofort eintauschen, sonst konnte er wegen Devisenvergehen bestraft werden. Also rannte jeder, der harte Währung hatte, in die sozialistische Bank und erhielt für sein Geld so genannte „Forumschecks“. Damit hatten die Genossen einen klugen Schachzug gemacht! Die Bürger horteten das gute „Westgeld“ nicht mehr zu Hause wie bisher, und der Staat konnte sofort darüber verfügen. In dieser Zeit gab es auch den bezeichneten Ausspruch für den Fall, wenn jemand etwas brauchte, das es wenig oder gar nicht zu kaufen gab: „(W)Forum handelt es sich?“ Das hieß so viel wie: „Hast du Forumschecks, kriegst du, was du brauchst.“ Beispiel: An meinem Wartburg war der Auspuff kaputt. Der volkseigene Reparaturbetrieb hatte natürlich keine. Also ab zu einem der letzten privaten „Krutscher“, wie das so hieß.
„Mein Auspuff hat ein Loch.“
„Na ja, wir schauen mal nach und machen das Loch zu. Da fällt mir ein, mein Mitarbeiter kennt jemanden, der einen neuen Auspuff hat!? Aber ich glaube, der braucht etwas ‚anderes‘ dafür!“
Genau das war DDR-Originalmusik. Unsere Philosophie war die Richtung vieler Straßen, die von nirgendwo ins Nichts führten. Tolle Zukunft.
Für mich ist es deshalb nicht nachvollziehbar, wie man Menschen heute zur Faulheit erzieht. Wer nicht arbeitet und mitunter genauso viel an finanziellen Zuwendungen bekommt wie jemand, der jeden Tag schaffen geht, wird ein Berufsfaultier und für die Gesellschaft nutzlos und parasitär. Doch das ist meine persönliche Meinung, und die muss nicht geteilt werden.
Es gab eben niemanden in der DDR, der gesagt hätte wie hier im öffentlich-rechtlichen Anstalts-Fernsehen: „Die Bundesrepublik Deutschland bietet an, dass man nicht arbeiten muss, aber trotzdem allerhand Geld bekommt. Warum soll ich das nicht ausnutzen?“ Worte eines jungen ausländischen Mitbürgers in einer Fernsehgesprächsrunde, oder auch im Ersatzdeutsch „Talkshow“ genannt. Intelligenter wird die ganze Sache auch nicht, selbst wenn man es englisch nennt! Welch grauenvolle Politik!
Trotz einer katastrophalen „Subventionswirtschaft“ brachte es die DDR zum 10-stärksten Industriestaat der Welt. Und dies bei einem Anteil am Territorium der Erde von 0,03 Prozent! Da kann man sich ausmalen, wenn die Bürger der DDR hätten wirklich frei arbeiten dürfen, was aus diesem Teilstaat geworden wäre.
Andererseits hätte es auch umgedreht geschehen können. Die USA wären die „Armen“ gewesen und nicht die Russen. Ja, und das reiche Russland hätte in Ostdeutschland den tollen „Stalinplan“ statt des Marshallplans gebracht. Dann dürften im Jahr 1989 die „Ossis“ zu den „Wessis“ gesagt haben: „Jetzt müsst ihr erst einmal richtig ‚arbeiten‘ lernen!“ Genauso, wie sich ein paar Hirnlose gegenüber den Ostdeutschen äußerten. Mit dem Begriff „Neue Bundesländer“ habe ich meine Probleme, nur um Sachsen herauszunehmen. Sachsen ist älter als die meisten westdeutschen Bundesländer. Von der Kulturtradition, dem Fleiß dieses großen, pünktlichen und stolzen Volkes ganz zu schweigen.
Mein erster Vertrag am Opernhaus in Karl-Marx-Stadt, den ich 1970 unterschrieb, hatte mir einen „Zweitwunsch“ erfüllt. Endlich Berufskünstler!?

Der Verfasser im „Tannhäuser“, drittes Bild, in Karl-Marx-Stadt
Ein Herzenswunsch ging endlich in Erfüllung. Geträumt hatte ich schon als kleiner Junge in der Schule, als wir eine Schülerinszenierung vom „Stülpner Karl“ aufführten. Darinnen spielte ich jenen Hauptmann, der den „Karl“ verhaftete, und stellte für mich fest, dass mir das lag; auf der Bühne vor einem Publikum zu spielen. Ich hatte schon gesagt, dass ich innerhalb der Familie keine passenden Vorbilder hatte – bis auf meinen Großvater, der neben der musikalischen auch sonst eine sehr große Allgemeinbildung hatte.
Der staatliche Abschluss wurde mir kurze Zeit darauf schriftlich bestätigt. Mir selbst hat der Beruf als Chorsolist sehr großen Spaß gemacht, doch leider gab es als Chorist nicht sehr viel zu verdienen. Unsere sehr guten Solisten erhielten monatlich knapp 1.000,00 DDR Mark in Karl-Marx-Stadt und mussten mitunter gar 5- bis 6mal pro Woche eine längere Soloparty singen. Viele von ihnen gaben Unterricht, um noch etwas Geld dazuzuverdienen. Wir bekamen als Choristen um die 600,00 Mark brutto. Nebenbei hatte ich noch einige kleine Soloaufgaben, die extra bezahlt wurden, und dazu etwas Schminkgeld, doch letztendlich wurde es nicht viel mehr. Gut, ich habe das ja vorher gewusst. Also bitte nicht beschweren, sagte ich mir.
Im Spätherbst des gleichen Jahres las ich in der ach so „Freien Presse“ ein Inserat, wo ein Gitarrist für eine Berufsband gesucht wurde. Gut, und was machte ich? Natürlich, ich sprach und spielte vor und hätte auch sofort einen ersten Dreimonatsvertrag unterschreiben können. Nur war ich engagiert am Städtischen Opernhaus! Als ich meinen dortigen Vertrag wieder auflösen wollte, stellten sich sowohl der Intendant als auch die Leitung quer, und dies mit Recht. Ich hatte ja einen 2-Jahresvertrag unterzeichnet. Jetzt bekam ich Panik. Der eigentliche Wunsch meines Lebens sollte in Erfüllung gehen, wenn bloß nicht dieser Vertrag wäre. Also stellte ich mich stur und kam nicht mehr zu meinen Vorstellungen. Dies führte zu einem Riesenkrach, denn ich war ja Chorsolist und hatte neben dem Opernchor auch ein paar Soloaufgaben zu erledigen. Durch mein Fernbleiben fehlte dann ein wichtiger Mann auf der Bühne, und diese Lücke musste entsprechend gefüllt werden. Vor allem die „Schwuliberts“ im Chor machten Dampf gegen mich, zumal ich einen aus ihrer Garde hatte abblitzen lassen und mir obendrein noch die schönste Chordame schnappte. Aber es gab auch versöhnlichere Töne von ein paar alten Hasen die meinten, der Gerd macht das richtig. Nein, hier gab es wahrlich nichts zu verdienen. Das tat mir alles sehr, sehr leid, und ich gebe zu, mein Verhalten war echt stinkig! Aber der musikalische Duft der Berufstanzmusiker, (so hießen wir damals) hatte mich in seinen Bann gezogen. Somit wurde mein Vertrag am Opernhaus in Karl-Marx-Stadt aufgelöst, und ich konnte ab Januar 1971 im schönen Annaberg-Buchholz, mitten im Erzgebirge, in meine erste Berufsformation einsteigen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.