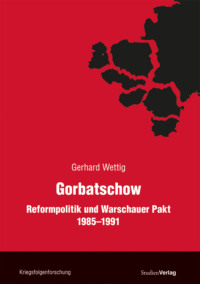Kitabı oku: «Gorbatschow», sayfa 2
In der folgenden Untersuchung der Politik Gorbatschows, soweit sie den Warschauer Pakt berührte, geht es nicht nur darum, relevante neue Fakten zu ermitteln, sondern vor allem auch darum, die Zusammenhänge zwischen den Vorgängen zu klären, die in 18 sich zeitlich überlappende Stadien gegliedert werden. Der danach durchgeführten Analyse ihres Verlaufs liegt die Feststellung zugrunde, dass die UdSSR lange Zeit eine sehr starke, möglicherweise sogar überlegene militärische Position auf dem europäischen Schauplatz besessen hatte, aber stets in fast allen anderen Bereichen schwächer als der ideologisch zum bedrohlichen Feind erklärte Westen gewesen war. Vor allem ihre ökonomische und technische Leistungsfähigkeit sowie ihre soziale Attraktivität waren unterlegen. Das stand in diametralem Gegensatz zum Anspruch auf Überlegenheit des Sowjetsystems und zu den darauf beruhenden politischen Ambitionen. Die Diskrepanz veranlasste das Regime zur Bereitstellung möglichst großer Gewaltpotenziale, um sich nach innen und außen vor den Auswirkungen vorhandener Defizite zu schützen. Umfängliche Sicherheitsapparate und die gegen die eigene Bevölkerung gerichtete Grenze dienten der Abwendung endogener Gefahren, während der Eindruck militärischer Stärke den Westen von der Ausnutzung seiner Überlegenheitsfaktoren abhalten sollte. Die Machtinstrumente verursachten hohe Kosten, welche die schwache Wirtschaft übermäßig belasteten.
Als Gorbatschow an die Spitze der UdSSR gelangte, hatte eine Entwicklung eingesetzt, welche die Aufrechterhaltung der starken militärischen Position – und damit den Ausgleich für die Unterlegenheiten gegenüber dem Westen – zweifelhaft machte: Die NATO hatte die Herausforderung durch die SS 20 erfolgreich abgewehrt und begonnen, ihre Verteidigung durch waffentechnische Innovationen in die Vorhand zu bringen. Gorbatschow stand daher vor der Aufgabe, den allgemeinen Niedergang zu überwinden und die sowjetische Position zu behaupten. Da die Streitkräfte seit jeher dazu dienten, bestehende Defizite zu kompensieren und zu neutralisieren, galt seine Aufmerksamkeit zunächst vor allem dem militärischen Problem, doch wurde ihm zunehmend klar, dass er sich primär um die geringe wirtschaftliche Produktivität, die inferiore Technik und die abnehmende soziale Akzeptanz des sowjetischen Systems als Schwachpunkte kümmern musste. Bei diesen ebenso vielfältigen wie schwierigen Aufgaben stellte sich nicht nur die Frage, welcher er sich zuerst zuwenden solle, sondern es wurden auch Transformationsprozesse nötig, von denen niemand wusste, wie sie zum Erfolg zu führen waren, und bei denen er sich auf vielfach unwillige Parteifunktionäre stützen musste, die sich je länger, desto mehr widersetzten.
______________
1 Stephen Kotkin, Uncivil Society. 1989 and the Implosion of the Communist Establishment. New York 2009.
2 Gerhard und Nadja Simon, Verfall und Untergang des sowjetischen Imperiums. Mit zahlreichen Dokumenten. München 1993.
3 Stephen Kotkin, Armageddon Averted. The Soviet Collapse 1970–2000. Updated Edition, Oxford/GB 2008.
4 William Taubman, Gorbachev. His Life and Times. New York – London 2015.
5 Kristina Spohr, „Wendezeit“. Die Neuordnung der Welt nach 1990. München 2019.
6 Helmut Altrichter, Russland 1989. Der Untergang des sowjetischen Imperiums. München 2009.
7 Robert L. Hutchings, Als der Kalte Krieg zu Ende war. Ein Bericht aus dem Innern der Macht. Berlin 1999.
8 Jeffrey A. Engel, When the World Seemed New. George H. W. Bush and the End of the Cold War. New York 2017.
9 Mark Kramer, Jaruzelski, the Soviet Union, and the Imposition of Martial Law in Poland, in: Bulletin of the Cold War International History Project, 11/Winter 1998, S. 5–14; Mark Kramer, The Collapse of East European Communism and the Repercussions within the Soviet Union, in: Journal of Cold War Studies, 5/4/2003, S. 178–256; 6/4/2004, S. 3–64; 7/1/2005, S. 3–96; Mark Kramer, The Demise of the Soviet Bloc, in: The Journal of Modern History, 83/4/December 2011, S. 788–854.
10 Wolfgang Mueller – Michael Gehler – Arnold Suppan (Hg.), The Revolutions of 1989: A Handbook. Wien 2015.
11 Vladimir Tismăneanu (Hg.), The Revolutions of 1989 (Rewriting Histories). New York 1999.
12 Vladimir Tismăneanu – Bogdan C. Iakob (Hg.), The End and the Beginning. The Revolutions of 1989 and the Resurgence of History. Budapest – New Yok 2012.
13 Rafael Biermann, Zwischen Kreml und Kanzleramt. Wie Moskau mit der deutschen Einheit rang. Paderborn 1997.
14 Andreas Rödder, Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der Wiedervereinigung. München 2010.
15 Karl-Rudolf Korte, Deutschlandpolitik in Helmut Kohls Kanzlerschaft. Regierungsstil und Entscheidungen 1982–1989. Stuttgart 1998.
16 Hanns Jürgen Küsters (Hg.), Der Zerfall des Sowjetimperiums und Deutschlands Wiedervereinigung. Köln – Weimar – Wien 2016.
17 Werner Weidenfeld, Außenpolitik für die deutsche Einheit. Die Entscheidungsjahre 1989/90. Stuttgart 1998.
18 Gareth Dale, The East German revolution of 1989. Manchester – New York 2006.
19 Artur Hajnicz, Polens Wende und Deutschlands Vereinigung. Die Öffnung zur Normalität 1989–1992. Paderborn 1995.
20 Alexander von Plato, Die Vereinigung Deutschlands – ein weltpolitisches Machtspiel. Bush, Kohl, Gorbatschow und die geheimen Moskauer Protokolle. Berlin 2002.
21 Stefan Karner – Mark Kramer – Peter Ruggenthaler – Manfred Wilke (Hg.), Der Kreml und die Wende 1989. Interne Analysen der sowjetischen Führung zum Fall der kommunistischen Regime. Dokumente. Innsbruck – Wien – Bozen 2014; Stefan Karner – Mark Kramer – Peter Ruggenthaler – Manfred Wilke (Hg.), Der Kreml und die deutsche Wiedervereinigung 1990. Interne sowjetische Analysen. Berlin 2015.
22 M. Ju. Prozumenščikov (Verantwortlicher Redakteur) – I. V. Kazarina – T. M. Kuz’mičeva – P. Ruggenthaler (Hg.), Konec ėpochi. SSSR i revolucii v stranach Vostočnoj Evropy v 1989–1991 gg. Dokumenty [Das Ende einer Epoche. Die UdSSR und die Revolution in den Ländern Osteuropas 1989–1991. Dokumente]. Moskau 2015.
23 V Politbjuro CK KPSS… Po zapisjam Anatolja Černjaeva, Vadima Medvedva, Georgija Šachnazarova (1985–1991) [Im Politbüro des ZK der KPdSU… Nach Aufzeichnungen von Anatolij Černjaev, Vadim Medvedev und Georgij Šachnazarov]. Moskau 2006; Otvečaja na vyzov vremeni. Vnešnjaja politika perestrojki. Dokumental’nye svidetel’stva. Po zapisjam M. S. Gorbačëva s zarubežnymi dejateljami i drugim materialam [Auf die Herausforderungen der Zeit antworten. Dokumentarische Zeugnisse. Nach den Aufzeichnungen von M. S. Gorbatschow (über Gespräche) mit ausländischen Politikern und andere Materialien]. Moskau 2010.
24 Svetlana Savranskaya –Thomas Blanton – Vladislav Zubok (Hg.), Masterpieces of History. The Peaceful End of the Cold War in Europe, 1989. Budapest – New York 2011.
25 Aleksandr Galkin – Anatolij Černjajew (Hg.), Michail Gorbačev i germanskij vopros. Sbornik dokumentov 1986–1991 gg. Moskau 2006; Aleksandr Galkin – Anatolij Tschernjajew (Hg.), Michail Gorbatschow und die deutsche Frage. Sowjetische Dokumente 1986–1991. München 2011.
26 Hanns Jürgen Küsters – Daniel Hofmann (Bearb.), Dokumente zur Deutschlandpolitik. Deutsche Einheit. Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes 1989/90. München 1998.
27 Andreas Hilger (Hg.), Diplomatie für die deutsche Einheit. Dokumente des Auswärtigen Amtes zu den deutsch-sowjetischen Beziehungen 1989/90. München 2011.
28 Horst Möller – Dorothee Pautsch – Gregor Schöllgen – Hermann Wentker – Andreas Wirsching (Hg.), Die Einheit. Das Auswärtige Amt, das DDR-Außenministerium und der Zwei-plus-Vier-Prozess, bearbeitet von Heide Amos und Tim Geiger. Göttingen 2015.
29 Michail Gorbatschow, Erinnerungen. Berlin 1995; Michail Gorbatschow, Alles zu seiner Zeit. Mein Leben. München 2014.
30 A. Černjaev, Fenomen Gorbačëva v kontekste liderstva [Das Phänomen Gorbatschow in Bezug auf Führung], in: Meždunarodnaja žizn’, 7/1993, S. 50–61.
31 Georgi Schachnasarow, Preis der Freiheit. Eine Bilanz von Gorbatschows Berater, hg. von Frank Brandenburg. Bonn 1996.
32 Eduard Schewardnadse, Die Zukunft gehört der Freiheit. Reinbek 1991; Ėduard Ševardnadze, Kogda ruchnul železnyj zanaves [Als der Eiserne Vorhang zerbrach]. Moskau 2009.
33 S. F. Achromeev – G. M. Kornienko, Glazami maršala i diplomata. Kritičeskij vzgljad na vnešnjuju politiku SSSR do i posle 1985 goda [Mit den Augen eines Marschalls und eines Diplomaten. Ein kritischer Blick auf die Außenpolitik der UdSSR vor und nach 1985]. Moskau 1992.
34 Nikolai Ryschkow, Mein Chef Gorbatschow. Die wahre Geschichte seines Untergangs. Berlin 2013.
35 Iwan Kusmin, Die Verschwörung gegen Honecker, in: Deutschland Archiv, 3/1995, S. 286–288; I. N. Kuz’min, Krušenie GDR. Zametki odčevidca [Der Zusammenbruch der DDR. Bemerkungen eines Augenzeugen]. Moskau 1996; I. Kuz’min, Šest’ osennych let. Berlin 1985–1990 [Sechs Herbstjahre. Berlin 1985–1990]. Moskau 1999.
36 Valentin A. Falin, Politische Erinnerungen. München 1993.
37 Julij A. Kwizinskij, Vor dem Sturm. Erinnerungen eines Diplomaten. Berlin 1993.
38 Wjatscheslaw Kotschemassow, Meine letzte Mission. Berlin 1994.
39 Igor’ Maksimyčev, Nizloženie Ėricha Chonekkera [Die Absetzung von Erich Honecker], in: Nezavisimaja gazeta, 19.10.1994; Igor’ Maksimyčev – Chans Modrov, Vzlȅt i padenie [Aufstieg und Fall]. Moskau 1993.
40 Gerd König, Fiasko eines Bruderbundes. Erinnerungen des letzten DDR-Botschafters in Moskau. Berlin 2011.
41 Markus Wolf, In eigenem Auftrag. München 1991.
42 Helmut Kohl, Ich wollte Deutschlands Einheit. Dargestellt von Kai Diekmann und Ralf Georg Reuth. Berlin 1996.
43 George Bush – Bent Scowcroft, A World Transformed. New York 1998.
44 Philip Zelikow – Condoleezza Rice, Germany Unified and Europe Transformed. A Study in Statecraft. Cambridge/MA – London 1995.
45 Robert D. Blackwill, Deutsche Vereinigung und amerikanische Diplomatie, in: Außenpolitik, 3/1994, S. 211–225.
46 James A. Baker III., The Politics of Diplomacy. Revolution, War and Peace 1989–1992. New York 1995.
47 Vernon A. Walters, Die Vereinigung war voraussehbar. Hinter den Kulissen eines entscheidenden Jahres. München 1994.
48 Horst Teltschik, 329 Tage. Innenansichten der Einigung. Berlin 1991.
49 Joachim von Arnim, Zeitnot. Moskau, Deutschland und der weltpolitische Umbruch. Mit einem Vorwort von Horst Teltschik. Bonn 2012.
50 Rodric Braithwaite, Across the Moscow River. The World Turned Upside Down. New Haven – London 2002.
51 Vojtech Mastny, Imagining war in Europe: Soviet strategic planning, in: Vojtech Mastny – Sven G. Holtsmark – Andreas Wenger (Hg.), War Plans and Alliances in the Cold War. Threat perception in the East and the West. London 2006, S. 15–45, hier: S. 22–33; Gerhard Wettig, Sicherheitspolitische Leitvorstellungen, in: Gerhard Wettig (Hg.), Sicherheit über alles! Krieg und Frieden in sowjetischer Sicht. Köln 1986, S. 11–58; Phillip A. Petersen – John G. Hines, Die sowjetische Friedens- und Kriegsstrategie in Europa, in: ebd., S. 59–148.
52 Siehe seine Gespräche mit Amintore Fanfani am 3.8.1961 (SAPMO-BArch, DY 30/3638, Bl. 76f.), mit Cyrus Sulzberger am 5.9.1961 (RGANI, F. 52, op. 1, d. 594, Bl. 133f.), mit Vittorio Valetta am 11.6.1962 (RGANI, F. 52, op. 1, d.568, Bl. 106) und mit Raymond Scheyven am 18.9.1962 (RGANI, F. 52, op. 1, d. 548, Bl. 27f.); sowie N. S. Chruščȅv, Za novye pobedy kommunističeskogo dviženija, in: Kommunist, 1/1961, S. 9, 16–22.
53 Nach dem Abzug der Mittelstreckenraketen, die von ihren vorgeschobenen Stellungen aus Ziele in der Tiefe des sowjetischen Territoriums hatten treffen können, hatten die USA nur noch Kernwaffen mit Gefechtsfeld-Reichweite auf dem europäischen Schauplatz, die nach Anzahl und Stärken dem entsprechenden Potenzial der UdSSR unterlegen waren. Falls die beiderseitigen Nuklearsysteme eingesetzt wurden, waren zudem großflächige oder sogar totale Zerstörungen der vorgeschobenen Länder in Ost und West, vor allem der deutschen Staaten, zu erwarten. Das stellte den Sinn der Verteidigungsanstrengungen, also auch die Glaubwürdigkeit der westlichen Bereitschaft zum nuklearen Ersteinsatz, infrage.
54 Die SS 20 deckte mit 4.500 km Reichweite ganz Westeuropa und die umliegenden Meere ab sowie weite Gebiete Asiens. Wegen ihrer hohen Treffgenauigkeit vermochte sie auch „gehärtete“ Punktziele zu vernichten. Als mobiles System, das den Standort rasch wechseln konnte und sich so der westlichen Zielerfassung in Echtzeit entzog, war sie faktisch unverwundbar. Aus dem Marsch heraus konnte sie in 40–60 Minuten startklar gemacht werden; in vorbereiteter Stellung waren dazu nur 5–8 Minuten nötig. Ihre Produktion wurde bis 1983 ununterbrochen fortgesetzt. Insgesamt 333 nachladefähige Systeme mit jeweils drei unabhängig voneinander ins Ziel zu bringenden Sprengköpfen wurden aufgestellt, davon etwa zwei Drittel im europäischen Teil der Sowjetunion. Wie Verteidigungsminister Ustinov den leitenden Militärs der Warschauer-Pakt-Staaten erklärte, war dadurch im Kriegsfall die augenblickliche Vernichtung aller strategischen Objekte in den europäischen NATO-Staaten und den umgebenden Seegebieten gewährleistet. Die westliche Verteidigung ließ sich demzufolge mit einem Schlag ausschalten. Siehe hierzu Erhard Forndran – Gert Krell (Hg.), Kernwaffen im Ost-West-Vergleich. Zur Beurteilung militärischer Potentiale und Fähigkeiten. Baden-Baden 1984, insbes. S. 506–509; B. E. Tschertok, Raketen und Menschen, Bd. 3: Heiße Tage des kalten Krieges. Klitzschen 2001, S. 536f.; BArch-MA, VA-01/32241, Bl. 211, Information über die während der Manöver „Sapad-81“ vorgeführten Komplexe der strategischen Angriffskräfte der UdSSR. Geheime Kommandosache (persönlich).
55 Die DDR war das zentrale Aufmarschgebiet gegen die NATO und gewährleistete als Staat im Rücken Polens, dass dieses für die UdSSR schwierige Land den Pakt nicht verlassen konnte.
56 Im Kriegsfalle erleichterten sie den nuklearen Ersteinsatz zur Ausschaltung der gegnerischen Panzer, weil sie wesentlich geringere zivile Kollateralschäden verursachten.
57 Das Verhalten der Bundesrepublik war deswegen entscheidend, weil die Mitwirkung der für die Stationierung vorgesehenen Staaten (Benelux-Länder und Großbritannien) davon abhing und weil allein die Pershing II, die dort in vorgeschobener Lage aufgestellt werden sollte, sowjetisches Territorium auf ähnliche Weise bedrohte, wie umgekehrt Westeuropa der SS 20 ausgesetzt war.
Entwicklung der Politik Gorbatschows
Grundlegende Entscheidung für kooperative Sicherheit mit dem Gegner
Auf dem europäischen Schauplatz setzte eine für die UdSSR und den Warschauer Pakt negative militärische Entwicklung ein. Das konventionelle Kräfteverhältnis verschob sich zugunsten der NATO. Beeindruckende Fortschritte der westlichen Rüstungstechnik machten es wahrscheinlich, dass diese eine zunehmend überlegene Position erringen werde. Die Durchführbarkeit des – der Moskauer operativen Planung zugrunde gelegten – Konzepts einer sofortigen raumgreifenden Offensive wurde zweifelhaft, weil die großen Panzerverbände, von denen der Erfolg abhing, künftig von rascher Vernichtung bedroht sein würden. Man habe deswegen davon auszugehen, dass statt des östlichen Angreifers der westliche Verteidiger im Vorteil sein werde.58 Aus Informationen, die mittels Spionage gewonnen worden waren, ergab sich, dass die NATO künftig in der Lage sein würde, mit ihren qualitativ verbesserten konventionellen Kampfmitteln ebenso schlimm zuzuschlagen wie mit Nuklearwaffen. Das werde ihren Streitkräften zum Sieg verhelfen.59 Die Ratlosigkeit, die dieser Einschätzung folgte, förderte die Bereitschaft der sowjetischen Generalität, sich auf Änderungen der Strategie einzulassen und entsprechende Vorgaben der politischen Führung zu akzeptieren. Das war keineswegs selbstverständlich, denn die Militärs hatten stets darauf bestanden, dass derartige Fragen ihre ureigene Domäne seien, in die niemand von außen eindringen dürfe.
Gorbatschow wollte die bisherige außen- und sicherheitspolitische Orientierung zunächst beibehalten: Die sozialistischen Staaten müssten die Reihen schließen, um gegen den Feind im Westen Front zu machen.60 Ihm war aber von Anfang an klar, dass die offizielle These, der Westen sei sozioökonomisch und technologisch unterlegen und müsse wegen seines monolithischen und aggressiven Charakters als der böse Feind gelten, nicht der Realität entsprach. Mit den anderen Führungsmitgliedern teilte er von Anfang an die Überzeugung, es dürfe keinesfalls zu einer nuklearen Auseinandersetzung kommen.61 Nur dann konnte die Sowjetunion einen militärischen Konflikt mit dem Westen unbeschadet überstehen, weil die Zerstörungen – anders als im Zweiten Weltkrieg – wesentlich auf fremdem Gebiet stattfinden würden. Als er nach seinem Amtsantritt die Raketenabwehrstellungen um Moskau besuchte, wurde ihm klar, dass diese Sicherheit verloren gegangen war und sich auch durch neue Rüstungsanstrengungen nicht wiedergewinnen ließ. Die Befehlshaber erklärten ihm, im Kriegsfalle wäre die Hauptstadt den in der Bundesrepublik neu stationierten Pershing II schutzlos preisgegeben. Gegen diese könne man wegen ihrer extrem kurzen Flugzeit keine Verteidigungsmaßnahmen treffen.
Dem politischen und militärischen Zentrum der UdSSR, das bis vor Kurzem unangreifbar gewesen war, drohte demzufolge augenblickliche Vernichtung, denn der Gegner würde diese Raketen sofort abschießen, weil sie andernfalls aufgrund ihrer exponierten vorderen Position in den einsetzenden Kämpfen rasch ausgeschaltet wären. Daraus zog Gorbatschow den Schluss, die von der Pershing II ausgehende Gefahr lasse sich nur durch Verhandlungen und Vereinbarungen mit den USA über einen Verzicht auf dieses Waffensystem bannen.62
Mithin sollte an die Stelle der Rüstung gegen den westlichen Gegner ein Zusammenwirken mit ihm treten. Deshalb schlug Gorbatschow den Amerikanern am 7. April 1985 eine wechselseitige Reduzierung der Kernwaffen vor, die alle Pershing-II-Flugkörper einbeziehen sollte.63 Auch wenn er zunächst nur geringe Gegenleistungen anbot, war dies doch ein prinzipieller Richtungswechsel: Sicherheit sollte geschaffen werden nicht mehr durch Rüstung gegen den Widersacher, sondern durch Kooperation mit ihm. Dem Bemühen war kein rascher Erfolg beschieden. US-Präsident Ronald Reagan sah keinen Grund zum Verzicht auf eine wesentliche Komponente der Nachrüstung, solange die UdSSR an der SS 20 festhielt. Bei der ersten persönlichen Begegnung in Genf im November kam bloß eine gemeinsame Erklärung des Inhalts zustande, ein Nuklearkrieg lasse sich nicht gewinnen und dürfe daher keinesfalls geführt werden. Für Gorbatschow war wichtig, dass damit der Dialog auf Ost-West-Ebene begonnen worden war. Fortan setzte er sein Bemühen hartnäckig fort, die Abrüstung der Mittelstreckenraketen auf der Tagesordnung zu halten und auf längere Sicht eine Regelung zu erreichen, welche die von ihnen ausgehende Gefahr beseitige und seinem Land einen Rüstungswettlauf erspare, dem es nicht gewachsen wäre.64 Um die Öffentlichkeit vor allem in den USA zu mobilisieren, präsentierte er am 25. Februar 1986 auf dem XXVII. Parteitag der KPdSU einen Drei-Stufen-Plan zur Beseitigung der Kernwaffen bis zum Jahr 2000.65
Zur Begründung führte Gorbatschow aus, die bewaffnete Konfrontation zwischen beiden Lagern sei das prinzipielle Übel, von dem man sich befreien müsse. Kein Staat, wie mächtig er auch sei, könne Sicherheit nur durch eigene Anstrengungen und nur mit militärischen Mitteln erlangen, denn für Kriege und für eine Politik der Stärke sei die Welt zu klein geworden. Diese lasse sich nur retten und bewahren, wenn man mit den Denk- und Handlungsweisen breche, „die jahrhundertelang auf der Vertretbarkeit, auf der Zulässigkeit von Kriegen und bewaffneten Konflikten beruht haben“. Solange sich daran nichts ändere, habe „jede der Seiten gleiche Unsicherheit“. Gorbatschow zog weitreichende Schlüsse. Halte man am Wettrüsten weiter fest, werde die Gefahr immer mehr zunehmen. Dann könnte sogar die Parität aufhören, „ein Faktor der militärisch-politischen Zurückhaltung zu sein“. Nicht das Gleichgewicht der militärischen Fähigkeiten, sondern allein ein Ausgleich der politischen Interessen schaffe Frieden. Die Hauptgefahr seien die Kernwaffen, denn diese bedrohten die Menschheit insgesamt und müssten daher restlos beseitigt werden. Nicht nur die nukleare Kriegsführung, sondern auch deren Vorbereitung könne weder Sieg noch Gewinn bringen, denn auf Dauer lasse sich Sicherheit nicht aufbauen auf der „Angst vor Vergeltung, d. h. auf den [westlichen] Doktrinen der ‚Eindämmung‘ oder ‚Abschreckung‘“.66
Gorbatschow suchte weiter durch Verhandlungen die USA zum Verzicht auf ihre neuen Raketen in Europa zu bewegen. Wie er im Politbüro erklärte, war die Stationierung der SS 20 „ein schwerer Fehler“ gewesen, denn sie habe zu jener „ernsten Bedrohung“ durch die Pershing II geführt, die unbedingt beseitigt werden müsse. Das lasse sich nur auf der Basis „gleicher Absenkung des Rüstungsstandes“ erreichen, die der anderen Seite keine Nachteile zumute. Er erklärte sich prinzipiell bereit, einen beiderseitigen Verzicht auf Raketen mittlerer Reichweite in Europa zu akzeptieren. Damit würde die UdSSR zwar viel aufgeben, doch das könne sie sich leisten, denn sie wolle keinen Krieg führen.67 Zur konsequenten Verfolgung dieser Linie kam es jedoch lange Zeit nicht. Er hegte gegenüber der Führung in Washington Misstrauen und glaubte, sie betreibe eine antagonistisch ausgerichtete Politik. Daher war für ihn der Warschauer Pakt die „einzige Kraft“, die über die materiellen Möglichkeiten verfüge, „einen Kernwaffenkrieg zu verhindern“ und „den Lauf der Geschehnisse in die Richtung der Entspannung zu lenken“. Im Grunde lief das auf die hergebrachte Vorstellung hinaus, dass sich die Aggressivität des Gegners nur durch eine starke Militärmacht zügeln lasse.68 Gorbatschow war aber zu begrenzten Gegenleistungen bereit. Im September 1986 bot er an, wenn die amerikanischen Euroraketen, vor allem die Pershing II, beseitigt würden, wolle er in Europa auf 100 SS 20 heruntergehen und ihre Zahl in Asien einfrieren. Das hätte die Gefahr für Moskau beseitigt.
Die Bedrohung Westeuropas und Ostasiens wäre aber auch mit dem verringerten sowjetischen Arsenal bestehen geblieben. Die USA antworteten, die Mittelstreckenraketen müssten weltweit verschrottet werden. Gorbatschow ging, nachdem er und Reagan bei ihrer zweiten Begegnung in Reykjavík am 11./12. Oktober 1986 zueinander Vertrauen gefasst hatten, darauf ein. Er war bereit, die Ausschaltung vor allem der Pershing II mit dem Verzicht auf sämtliche SS 20 sowohl in Europa als auch in Asien zu honorieren. Das Abkommen scheiterte jedoch daran, dass seine Forderung nach einem Ende der amerikanischen „Strategischen Verteidigungsinitiative“ (SDI) auf Ablehnung stieß. Dieses Rüstungsprogramm erschien den Experten, auch solchen in der UdSSR, meist unrealistisch; die zugrunde gelegte Vorstellung, man könne alle angreifenden Kernwaffen vernichten, sei eine Illusion. Gorbatschow hatte jedoch die Sorge, dass die Forschungen und Entwicklungen, welche die USA im Blick darauf durchführten, erneut zu bedrohlichen technischen Innovationen führen würden, denen sein Land nichts Entsprechendes entgegenzusetzen habe. Reagan dagegen glaubte, dass sein Projekt, an dem er auch andere Staaten einschließlich der Sowjetunion zu beteiligen bereit war, zu einer Welt ohne nukleare Gefahr führen würde.69 Trotz der gescheiterten Übereinkunft sah Gorbatschow einen wesentlichen Verhandlungsfortschritt. Nachdem das Gespräch 1985 in eine Sackgasse geführt habe, sei es jetzt zum entscheidenden Durchbruch gekommen. Es habe sich gezeigt, dass eine Verständigung möglich sei. Man müsse nur noch etwas warten. Zwar hätten die USA den Anspruch auf militärische Überlegenheit noch nicht fallen lassen, doch kenne man jetzt ihre Haltung besser.70
Gorbatschow bemühte sich weiter um eine Regelung. Die Ausschaltung der Pershing II erschien ihm so wichtig, dass er bereit war, sich mit einem zehnjährigen SDI-Moratorium zufrieden zu geben. Das führte im Laufe des folgenden Jahres zur Übereinkunft.71 Am 8. Dezember 1987 setzten Reagan und Gorbatschow in Washington ihre Unterschriften unter den INF-Vertrag.72 Darin wurde die wechselseitige Verschrottung aller Raketen in Europa und Asien mit Reichweiten zwischen 500 und 5.500 km festgelegt.73 Die UdSSR verzichtete auf ungleich mehr Systeme und Sprengköpfe als die USA. Sie akzeptierte auch erstmals intensive Vor-Ort-Inspektionen zur Überprüfung der vereinbarten Abrüstungsmaßnahmen.74 Die Zugeständnisse zeigen, dass Gorbatschow die Pershing II unbedingt eliminieren wollte und seine Sicherheitspolitik generell auf die Zusammenarbeit mit Washington stützte. Die Kurzstreckenraketen blieben in vollem Umfang bestehen. Aus der Sicht des Kremls kam ihnen geringe Bedeutung zu, weil sie für den Einsatz im frontnahen Bereich bestimmt waren, mithin sowjetisches Territorium nicht bedrohten. Zudem war nicht zu befürchten, dass es zu einer Eskalationsfolge bis hinauf zur global-strategischen Ebene der beiden Führungsmächte kommen konnte.
Die UdSSR war damit nach menschlichem Ermessen auch im Kriegsfall vor einer nuklearen Zerstörung geschützt. Zugleich beseitigte das SDI-Moratorium für die Dauer eines Jahrzehnts – und, wie sich zeigen sollte, endgültig – die Gefahr eines technologischen Rüstungswettlaufs. Damit gaben, wie Außenminister Ėduard Ševardnadze urteilte, die USA die Option auf, ihre Überlegenheit dazu zu benutzen, um die Sowjetunion niederzuringen und deren „wirtschaftliche und soziale Basis“ zu gefährden.75 Gorbatschow bewertete das Abkommen als Erfolg seiner „prinzipielle[n] und konstruktive[n] Linie“ und als „wirkliche Revolution“ in den internationalen Beziehungen.76 Aufgrund des INF-Vertrages wurden in den folgenden drei Jahren alle Flugkörper, Abschussbasen und Unterstützungsdienste abgebaut. Die Durchführung unterlag einer Vor-Ort-Überwachung – ein völliges Novum in den Ost-West-Beziehungen, denn bis dahin hatte die Kremlführung eine derartige Verifikation stets von vornherein abgelehnt. Mehr als 2.000 amerikanische und westeuropäische Inspektoren kamen, oft ohne vorherige Anmeldung, in die UdSSR, und über 1.000 sowjetische Kontrolleure besuchten die Stationierungsorte der Amerikaner in Westeuropa. Den Regierungen beider Seiten gingen jeweils Berichte über den Fortgang der Demontagen zu.77
Gorbatschows Entscheidung für die Zusammenarbeit mit der westlichen Führungsmacht in Bezug auf die Kernwaffen in Europa berührte die politische Grundlage des Warschauer Pakts. Als Stalin im Januar 1951 seine Satellitenstaaten zur forcierten Aufrüstung genötigt und mit einem Koordinationsgremium die Basis für den späteren multilateralen Pakt geschaffen hatte, war er von der Vorstellung eines notwendigerweise antagonistischen Verhältnisses ausgegangen und hatte die Zeitspanne, während der die Amerikaner nach seiner Einschätzung aufgrund des vorerst noch bestehenden Truppendefizits in Europa außerstande waren, „den Dritten Weltkrieg auszulösen“, zum Aufbau einer dominierenden militärischen Position zu nutzen gesucht.78 Gemäß der seit 1953 zum dauerhaften Prinzip erhobenen „friedlichen Koexistenz“ mit den westlichen Staaten galt zwar seitdem die bewaffnete Austragung des Konflikts als vermeidbar, aber zugleich hatte man an der Prämisse des Systemgegensatzes festgehalten, die eine „Zügelung“ dieser unter Aggressivitätsverdacht gestellten „Imperialisten“ durch überlegene Streitkräfte erforderlich erscheinen ließ. Der INF-Vertrag machte nunmehr die Übereinkunft und Kooperation mit dem Westen in einem entscheidend wichtigen Bereich zur Grundlage der Sicherheitspolitik. Das hieß in letzter Konsequenz, dass die UdSSR keine vorgeschobene Front jenseits ihrer Westgrenze mehr benötigte. Wenn es analoge Resultate auch auf den anderen militärisch ausschlaggebenden Feldern gab, wie Gorbatschow es umfassend anstrebte, mochte irgendwann die Stationierung der sowjetischen Truppen in Ostmitteleuropa entbehrlich erscheinen. Damit wurde eventuell sogar der Verzicht auf das östliche Bündnis insgesamt denkbar.
Die mit der Verschrottung der Mittelstreckenraketen eingeleitete Zusammenarbeit mit den USA und der NATO stellte die in Moskau herrschende ideologische Wahrnehmung einer objektiv und unveränderlich bestehenden Feindschaft infrage und führte damit zu einer grundlegenden Annäherung von Ost und West. Doch in Bezug auf die Vorstellungen darüber, wie die beiderseits gewollte zuverlässige Kriegsverhütung praktisch zu verwirklichen sei, entstand ein heftiger Dissens zwischen Gorbatschow und der atlantischen Allianz, denn der Kremlchef vertrat den Standpunkt, dass die Existenz der Kernwaffen insgesamt den Frieden gefährde. Daher müssten alle nuklearen Potenziale eliminiert werden. Nichts davon könne dem Zweck der Kriegsverhütung dienen, denn man könne den Frieden nicht auf die wechselseitige Furcht vor Vernichtung gründen.79 Nicht die Abschreckung, sondern nur ein völlig „neues Denken“ führe zum Frieden.80 Dem widersprach die westliche Seite heftig. Nach ihrer Ansicht waren Erfindung und Entwicklung nuklearer Kampfmittel ein Faktum, das nicht mehr rückgängig zu machen war. Selbst wenn es gelänge, alle darüber verfügenden Staaten zum Verzicht darauf zu veranlassen, wäre immer noch das Know-how vorhanden, das, wenn auch vielleicht zunächst nur heimlich, zur erneuten Produktion verwendet werden könne. Die einzige Möglichkeit, den Kernwaffeneinsatz zu verhindern, sei die Schaffung eines Zustandes, der alle vom Gebrauch nuklearer Kampfmittel durch die damit verbundene Gefahr der eigenen Vernichtung abschrecke.
Revision der offensiven Militärdoktrin
Der sowjetischen Militärdoktrin lag die Vorstellung zugrunde, ein Krieg zwischen Ost und West könne nur durch einen Angriff der NATO entstehen. Der Warschauer Pakt müsse sofort zum „Gegenangriff“ übergehen, um die Kämpfe rasch durch Eroberung des europäischen Kontinents zu beenden. Das friedliebende sozialistische Lager könne nur dann „zuverlässige Sicherheit“ (nadëžnaja bezopasnost’) erlangen, wenn der Feind auf diese Weise entweder vom Krieg abgehalten werde oder, falls das nicht gelingen sollte, die Vernichtung auf seinem Territorium zu erwarten habe. Nach traditioneller Moskauer Ansicht war das ein defensives Konzept. Gorbatschow war sich jedoch bewusst, dass dies der anderen Seite als offensive Strategie erscheinen musste und folglich mit sicherheitspolitischer Kooperation unvereinbar war. Zudem setzte das Vorgehen voraus, über überlegene Streitkräfte zu verfügen, und die damit verbundenen Rüstungsanstrengungen belasteten die wirtschaftliche Entwicklung der UdSSR in außerordentlichem Maße.81 Eine neue Militärdoktrin, die auf dem Prinzip der gleichen Sicherheit für Ost und West beruhe, sollte den Vorwurf der offensiven Ausrichtung entkräften, den Willen zur Zusammenarbeit glaubhaft machen und den Vorstellungen des westlichen „Militarismus“ die Rechtfertigung entziehen.82