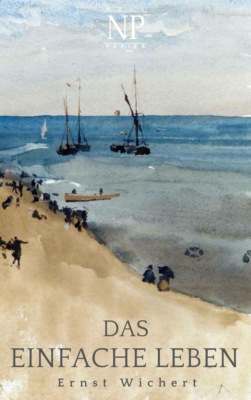Sayfa sayısı 961 sayfa
0+

Kitap hakkında
Gerhart Johann Robert Hauptmann war ein deutscher Dramatiker und Schriftsteller. Er gilt als der bedeutendste deutsche Vertreter des Naturalismus, hat aber auch andere Stilrichtungen in sein Schaffen integriert. 1912 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.Hauptmanns Frühwerk erhielt unterschiedliche Kritiken. Konservative Kreise und auch die Regierung waren von seinen gesellschaftskritischen Dramen nicht begeistert, was sich durch Zensur bemerkbar machte. Weil er ein glühender Sozialist war, wurden seine Stücke zu Zeiten Kaiser Wilhelms II. aus den kaiserlichen Theatern verbannt.Hauptmann galt zu Lebzeiten im Ausland als der repräsentative Dichter Deutschlands. Der ungarische Philosoph und Literaturkritiker Georg Lukacs nannte Hauptmann später den «Repräsentationsdichter des bürgerlichen Deutschlands».In «Das Abenteuer meiner Jugend» schildert Hauptmann die erste Hälfte seines Lebens.Null Papier Verlag