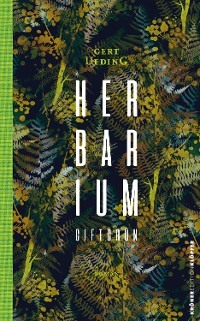Kitabı oku: «Herbarium, giftgrün», sayfa 5
5 Annäherungen
Morgens, noch mit dem faden Geschmack des, er wusste nicht wie, misslungenen Kaffees im Mund, rief Kersting im germanistischen Seminar der Universität an. Man erwarte Müller-Riedel in einer Stunde, Herr Sautter aber sei eben eingetroffen. Kersting bat, ihn bei beiden anzumelden.
Sein Vormittagsprogramm stand. Und der Nachmittag … Er lenkte seine Gedanken schnell in Richtung der Gespräche, die ihn in der Universität erwarteten, sonst hätte er sich in anregend frivolen Vorstellungen verloren. Draußen war es, wie angekündigt, heute kühl und bewölkt. Es regnete zwar noch nicht, aber ihn fröstelte. Bevor er ins Auto stieg, holte er sich noch schnell die Lederjacke aus dem Haus.
Im Vorgarten des Nebenhauses arbeitete der Nachbar an den Ziersträuchern und bedeutete ihm winkend, einen Moment zu warten. Kersting ging ihm entgegen. Der war Postbeamter gewesen, wusste Kersting, und jetzt seit zwei Jahren Rentner. Er trug alte Jeans, ein verfärbtes Flanellhemd spannte über seinem Bauch, darüber eine am Hals offene fleckige Cordweste, und die Morgentoilette hatte er offenbar noch vor sich.
»Bei Ihne isch in letzter Zeit ja mordsmäßig was los. Wen habe Se denn geärgert?«
Er blickte Kersting mit seinen dunklen Dackelaugen vorwurfsvoll an.
»Erst werde Se überfalle, dann schmeißt einer Ihre Fenschter ein und seit e paar Tag macht en junger Motorradgängschter hier d’ Stroß unsicher, dass mer sich gar nit meh raustraut!«
»Motorradgangster?«
»Ha, son junger Kerle. Tuckert langsam die Straße nunter, dann wieder zrück. Hab ihn scho paarmol gsehn.«
»Wie sah er aus? Können Sie ihn beschreiben?«
»Hat halt sei Montur getrage, schwarzes Leder, und au sein Helm auf, wie halt alle die Gängschter, die kennt mer ja ausm Fernsehe.«
»Woran haben Sie erkannt, dass er noch so jung war?«
»Gsehn hab ich sei Gsicht nit, natürlich nit, wegen dem Helm, aber, aber …« Er überlegte.
»Ja. Jetzt hab ichs. Wie er gfahre isch, beschleunigt het und hinte um d’ Kurv kratzt isch. Mer isch ja vor dene nirgends meh sicher.«
Kersting bedankte sich und versprach, der Polizei einen Wink zu geben.
Schon auf dem Flur hörte er laute Stimmen und fröhliches Lachen; es kam aus der geöffneten Tür des Sekretariats. Als er eintrat, erblickte er am Computer eine Frau mit wild gelocktem, rötlich blondem Haar. Er schätzte sie auf Anfang fünfzig, ihr fröhlich-lautes Lachen hatte er schon von fern gehört, als er aus dem Fahrstuhl stieg. Um sie herum stand eine Handvoll junger Leute, die ihr amüsiert zuhörten und mit ihren Kommentaren zur Erheiterung der ganzen Runde beitrugen. »Sie ist die Seele des Seminars«, würde ihm Müller-Riedel gleich auf seine launige Frage hin antworten.
Kerstings Eintritt unterbrach das gesellige Miteinander. Er habe heute früh angerufen und um einen Termin bei Herrn Müller-Riedel gebeten.
»Er erwartet Sie, die übernächste Tür: Sie brauchen nur zu klopfen.« »Und«, fügte Sie hinzu, »er ist vielleicht etwas aufgeregt, irgend jemand hat in seinem Zimmer einiges durcheinandergebracht. Ich hab ihn schon wieder aufgerichtet«, sagte der Wuschelkopf mit heiterer Miene.
»Schaffen Sie das noch bei ihm?«, fragte anzüglich ein langaufgeschossener Pickelhering, dem sie dafür einen Knuff in die Seite verpasste.
Dann fügte sie noch hinzu: »Die Bücher machen viel Vergnügen, besonders, wenn sie drunten liegen. Der Vers hat ihm gefallen, als ich aufräumte.«
»Hört sich nach Wilhelm Busch an.«
»Klar! Der hat auch schon was über Sie geschrieben: Ein hoffnungsvoller junger Mann gewöhnt sich leicht das Malen an!«
Kersting lachte. »Maler Klecksel ist meine Lieblingsbildergeschichte, aber darin habe ich diese Verse nicht gelesen.«
Das Telefon auf dem Schreibtisch schnarrte und sie raunzte gespielt ärgerlich in die Runde: »Jetzt aber raus hier. Ich hab zu arbeiten!«
Müller-Riedel begrüßte ihn und bat ihn, in einem der Sessel in der Besucherecke Platz zu nehmen. Er setzte sich ihm gegenüber, hüstelnd, wie es seine Unart war. Kersting berichtete ihm zunächst die Ereignisse, die auf das gemeinsame Essen gefolgt waren, und auch wie ihm Verenas Zettel abhanden gekommen war.
»Ein Überfall?« In Müller-Riedels Erstaunen mischte sich fast etwas wie Unglauben. »Aber doch nicht wegen dieses Stücks Papier! Noch dazu mit einem Text, den wir beide doch auch so behalten haben.«
»Aber ob er von Frau Roeder stammte, ist jetzt nicht mehr zu beweisen. Ja, dass er überhaupt existierte, beruht nun auf Treu und Glauben unseres Zeugnisses.«
»Haben Sie über die Bedeutung etwas ausgemacht?«
»Das war nicht so schwierig, mein Computer hat das für mich erledigt. Ist einer der Vorzüge des Internet, und doch habe ich zunächst ziellos ’rumgerätselt. Stieß mit Googles Hilfe auf …«
»Paracelsus, ich weiß schon. Habe natürlich auch im Internet Rat gesucht. Aber der Nachsatz? Und vor allem die tiefere Bedeutung dieser Zeilen. Sie wirken doch wie eine Art Geheimschrift. Ich habe versucht, ob die ersten oder die letzten Buchstaben der Wörter einen Sinn ergeben oder wenn man sie im Wechsel liest. Erfolglos, alles erfolglos leider.«
Kersting berichtete von seinem Cusanus-Fund, dass er aber dadurch auch nicht schlauer geworden war.
Sie rätselten noch gemeinsam an dem Text herum: wahrscheinlich eine versteckte Warnung oder Mahnung, die aber vielleicht nie den Adressaten erreichte, weil sich das Notizblatt unter den Uni-Papieren der Studentin befunden hatte.
»Ihre Sekretärin deutete an, dass es hier bei Ihnen auch etwas Aufregung gegeben habe?« fragte Kersting schließlich, um einen Übergang zum Aufbruch bemüht.
»Nicht mit dem Vorfall zu vergleichen, der Sie betroffen hat. Ich sehe auch keine Verbindung zum Roeder-Fall. Trotzdem ärgerlich, enorm ärgerlich! Wenn es nicht die Reinigungstruppe war, die meine Papiere in Unordnung gebracht hat (das glaubt nämlich Frau Schöndenn … meine Sekretärin), hängt das vielleicht mit Unerfreulichkeiten im Umkreis meines Lehrstuhls zusammen, die den freien Künstler nicht interessieren werden.«
»Glauben Sie das nicht. Wissenschaft und Kunst sind, jedenfalls was den Betrieb in und um sie betrifft, nicht so weit voneinander entfernt. Was meinen Sie, was unter Galeristen und Sammlern, Kuratoren und Museumsleuten los ist: bellum omnium contra omnes, Hobbes fände für seine These vom Kampf aller gegen alle jedenfalls auch in meinem Gewerbe die schönsten Beispiele.«
»Haben Sie schon mal etwas von ›Fake-Press‹ gehört?«, fragte Müller-Riedel.
»Von Fake-News schon …«
»Was ich meine, ist nicht weit davon entfernt. Es handelt sich dabei um kriminelle Verlage, die mit falschen, geschönten, rein hypothetischen, jedenfalls völlig ungesicherten, aber wissenschaftlich auftretenden Forschungsergebnissen ihr Geschäft machen. Ein Milliardengeschäft.«
»Wirklich? In den Geisteswissenschaften?«
»Da beginnt es jetzt. Bisher waren nur die Naturwissenschaften betroffen, vor allem Medizin, Pharmazie, auch die technischen Fächer. Da gibt es eine Reihe von Verlagen, die Zeitschriften, Bücher, Internetauftritte produzieren, mit wissenschaftlichen Namen glänzen, angeblich jede eingereichte Arbeit penibel vor der Veröffentlichung prüfen. Das kostet natürlich, und nicht zu knapp, dreitausend, viertausend Euro sind keine Seltenheit. Also ganz enorm! Was dann veröffentlicht wird, ist oftmals hanebüchen, reine Erfindung oder Teilplagiat, mit Scheinbelegen reichlich umrahmt, natürlich im jeweiligen Wissenschaftsjargon gehalten. Die Frechheit kennt keine Grenzen. Man hat sogar Kinderbücher als wissenschaftliche Studie in den Literaturverzeichnissen gefunden.«
»Das ist nicht längst aufgeflogen?«
»Wie gesagt: ein Milliardenmarkt und gut getarnt. Die Verlage, oft in Indien, Neuseeland, sogar den USA beheimatet, haben hochtrabende, aber wissenschaftlich seriös klingende Namen; zum Beispiel (er steht auf und kramt in einem Stoß Papiere auf seinem Schreibtisch) ›Indian Journal of integrative Sciences‹. Man lädt namhafte Wissenschaftler ein, in solchen Zeitschriften zu publizieren, zahlt ein gutes Honorar und führt sie dann als Mitarbeiter. Oder auch Nachwuchsforscher aus renommierten Universitäten, die dennoch gerne auf jeden Call for papers eingehen, weil sie unter enormem Veröffentlichungsdruck stehen.
Mächtige Firmen etwa der Arzneimittel-Industrie sind auch dabei, sponsern Kongresse, wo dann die verrücktesten Thesen ausgebreitet werden, und werben dabei Gutachter für ihre Produkte.«
»Und das soll auch in Philosophie, Literatur- und Sprachwissenschaften funktionieren?«
»Gewiss nicht in diesen Dimensionen. Aber auch in unseren Fächern zählt die Zahl der Veröffentlichungen, es gibt zu wenige seriöse Publikationsorgane. Also bilden sich Zitierkartelle.
Ein Heidelberger Kollege ist dabei besonders erfolgreich, wurde gerade schon zum x-ten Male dafür ausgezeichnet. Schließlich werden Millionen für Editionen, biographische Forschungen und so freche Dummheiten wie die Genderforschung ausgegeben. Jedenfalls habe ich Wind von einer Verlags- und Zeitschriftengründung bekommen, die nach dem Vorbild dieser Fake-Verlage funktionieren soll. Aus dem Haus sind auch Kollegen dabei. Ich habe ein durchaus brisantes Dossier zusammengestellt. Man muss den Anfängen wehren.«
Gregor Sautters neues Dienstzimmer lag nur wenige Türen von dem Müller-Riedels entfernt. Er teilte es mit zwei weiteren Kollegen, deren Namen ebenfalls an der Tür aufgeführt waren, und bot sogar noch weniger Raum als das Franz Buchs. Schreibtisch, Bücherregale, ein Besucherstuhl, mehr hatte nicht Platz. Kersting stellte sich vor und wurde mit einer Handbewegung aufgefordert, Platz zu nehmen.
»Buch hat mir von Ihnen erzählt, es geht um ein Referat oder ähnliches. Aber setzen Sie sich doch.«
Kersting sah sich einem schlanken, dunkelhaarigen Mann gegenüber, der einen schmalen Oberlippenbart trug und ein Ziegenbärtchen am Kinn dazu. Bei der Uni-Gala hatte er nicht weiter auf ihn geachtet, erkannte in ihm aber dennoch sofort Müller-Riedels Tischnachbarn wieder. Sympathisch war er ihm nicht.
»Ich möchte Sie für einen Vortrag gewinnen.«
»Und wie kommen Sie auf mich?«
»Ich habe im Internet die Themenschwerpunkte der Tübinger Germanistik recherchiert. Auch hat eine ihrer Studentinnen, Jana Olivier, von Ihren Vorlesungen geschwärmt.«
»Jana Olivier« – er dehnte die Silben, als ob er sich erinnern müsse, doch Kersting war sicher, dass dies Kramen im Gedächtnis nur gespielt war. Auf einmal hatte er es leid, große Umwege zu machen.
»Jana Olivier«, wiederholte er, »die beste Freundin von Verena Roeder«.
»Ach natürlich, wo Sie das sagen. Hübsches Mädchen, wenn ich mich jetzt nicht täusche.«
»Sie trauert immer noch über Verenas Tod.«
Kersting insistierte. Über Jana wollte er mit Sautter gewiss nicht sprechen.
»Das hat uns alle sehr getroffen. Verena Roeder war eine der begabtesten Studentinnen, die hier rumlaufen. Und übrigens auch, wenn ich das bemerken darf, eine hinreißende Erscheinung. Seltene Kombination. Sie waren alle hinter ihr her, von der Bibliotheksaufsicht bis zum Prodekan.«
»Sie auch?«
Sautter schaute einen Augenblick zur Seite, fixierte Kersting dann sofort wieder.
»Gefühle spielen in unserem Fach eine große Rolle. Wer keine hat oder sie unterdrückt, ist auch ein schlechter Wissenschaftler. Was ich damit sagen will: sie hat mich beeindruckt, wie andere auch. Aber ich kenne die Grenze.«
»Gab es andere, die die Grenze nicht kannten?«
In Sautters dunklen Augen lag jetzt ein spöttischer Zug, als wolle er signalisieren: ›ich weiß wohl, worauf du aus bist‹.
»Es ist schwer für manche Kollegen, sogar für seriöse Familienväter, zu begreifen, dass sie nicht unwiderstehlich sind. Das gibt dann Grenzverletzungen, das gefundene Fressen für die alberne MeToo-Bewegung. Von Samuel Beckett stammt der herrliche Satz, dass es Frauen gibt, die einen stehenden Phallus schon wittern, bevor der Mann das Haus nur betreten hat, und sich dann noch fragen, wie der sie denn überhaupt hat sehen können. Verena gehörte zu ihnen, was aber nicht gegen sie spricht.«
»Gab es denn jemanden, auf den sie es abgesehen hatte?«
»Da bin ich ganz sicher. Sie war in einem Seminar von mir über den Liebesgarten in der mittelalterlichen Literatur. Hielt auch ein Referat. Wenn man sah, wie sie die Quellen zitierte – und sie zitierte zu unser aller Vergnügen viel –, dann merkte jeder, der sich auskennt, dass ihre eigene Gefühlsgeschichte immer miterzählt wurde.«
»Aber eine bestimmte Person wüssten Sie nicht zu nennen, die ihr da vor Augen stand?«
»Vor Augen wohl weniger, siehe Beckett. Doch Spaß beiseite (wieder der spöttische Ausdruck in seinen Augen): nein, ich weiß niemanden Bestimmten. Sie war sehr diskret, auch wenn sie durchaus ihre Gefühle zeigte. Zu nahe treten durfte man ihr nicht!«
›Du hast es auch versucht, da bin ich mir sicher‹, dachte Kersting, begriff aber, dass er nicht mehr erfahren würde, sah auf die Uhr, der Mittag war nahe.
»Aber«, ergänzte nun Sautter mit deutlicher Ironie, »wir haben noch gar nicht über einen Vortrag gesprochen.«
»Für mich heute wäre vor allem wichtig, ob Sie grundsätzlich zu einem Vortrag über die Frühgeschichte des Feminismus bereit wären?«
»Frühgeschichte?«
»Ich bin kein Spezialist«, gab Kersting zu. »Aber ›Frauen in der Renaissance‹, erschien uns ein spannendes Thema.«
»Vor allem ein weites Feld«, bemerkte Sautter nun geradezu süffisant, so dass Kersting schnell den Rückzug antrat. Er stand auf.
»Ich habe noch eine Verabredung und melde mich noch einmal. Die Finanzierung des Kongresses ist noch nicht gesichert. Wir hätten Sie gerne als Referenten, müssen aber noch eine Entscheidung abwarten. Darf ich wiederkommen?«
»Gerne. Aber wer ist ›wir‹?«
Kersting hatte daran nicht gedacht und improvisierte, mit halbem Gedanken an das Gespräch mit Müller-Riedel: »The international Society of Renaissance«. Sprach’s und war schleunigst zur Tür hinaus.
Bei der Rückfahrt dachte er über das Gespräch mit Sautter nach. Natürlich wusste der mehr, als er herausgelassen hatte. Zweifellos ein Zyniker, der eine Gelegenheit zu nutzen verstand. Einer von den smarten homme à femmes, wie sie heute Mode waren, ob auf dem Laufsteg oder im Hörsaal. Immer auf der Jagd, billige Nachfahren der alten Gesellschaftslöwen. Er würde ihm nicht über den Weg trauen, glaubte aber noch nicht an eine tiefere Verstrickung in den akuten Fall. Sautter war einer, der den Laufpass gab, wenn es kompliziert wurde, und sich sauber der Folgen entledigte. Wollte gewiß nicht ewig Assistent bleiben. Ob er zu den Kollegen im Haus gehörte, die an der Gründung des neuen Fake-Verlags beteiligt waren, von dem Müller Riedel erzählt hatte? Er hätte ihn nach Namen fragen sollen.
In der Universitätsbibliothek war, der Semesterferien wegen, wenig los. In einer Ecke saßen Studenten und sichteten die abgeholten Bücher, mehrere waren in ihre Smartphones vertieft, einer wäre beinah die Treppe herunter gestolpert, und konnte sich erst im letzten Moment fangen, dafür schlitterte das mobile Gerät wie ein Stück Seife über den Flur. Man konnte dem Besitzer die Panik ansehen, als er seiner verlorenen Kostbarkeit hinterher hechtete.
Frau Professor Jansen hatte kaum einen Blick für die vertraute Umgebung mit ihrem scheinbar immer gleichen Personal. Das Literaturverzeichnis für ihre Vorlesung im Wintersemester hatte sie fertig und überlegte, ob sie noch in ihr Büro gehen oder gleich nach Hause fahren sollte. Für das häusliche Arbeitszimmer sprach, dass sie weder von eifrigen Studenten gestört würde, noch, dass Kollegen, die sich langweilten, unter irgendeinem Vorwand klopften, um Banalitäten auszutauschen.
Entschlossen ging sie in Richtung des nur wenige Minuten entfernten Parkhauses in der Brunnenstraße, in dem sie einen Platz gemietet hatte. Die auch für eine Professorin beträchtliche Ausgabe lohnte sich – die Parkverhältnisse in der Unistadt waren selbst in den Semesterferien prekär, seit mehr als 25 Tausend Studenten die Uni heimsuchten, und viele von ihnen in der näheren und weiteren Umgebung, oft noch bei Muttern, wohnten; der dürftige öffentliche Nahverkehr zwang sie, mit dem Auto nach Tübingen zu kommen. Beinah hätte sie vergessen, den Brief, den sie in ihrer Hand hielt, in den Kasten zu werfen und lief noch einmal ein paar Schritte zurück.
Es hat begonnen, leicht zu regnen, die Straße ist schon feucht und die Reifengeräusche der vorbeifahrenden Autos übertönen ihre Schritte. Den Regenschirm, den sie am Morgen vorsorglich eingesteckt hat, jetzt noch aufspannen? Sie ist ja gleich da. Das selbst am Mittag verschattete Parkhaus mit seinen vielen uneinsichtigen Ecken ist ihr heute, an diesem trüben Tag noch unangenehmer als sonst. Beim Eintritt sieht sie sich um. Sie ist allein, um die Zeit kein Wunder, hört hier drinnen außer dem Piepsen und hastigem Flügelschlag einiger Spatzen nichts. Sie erinnert sich dabei an jenes Pärchen, das sie an einem Abend des letzten Semesters an ihren niedrigen Z3 gepresst vorgefunden hatte, wo die beiden nicht nur mit heftigem Küssen beschäftigt waren. Sie erreicht den Stellplatz ihres Autos an einer Rückwand tief hinten im Erdgeschoss. Sie will aufschließen, merkt aber, dass die Tür unverschlossen ist und etwas klafft. Sie streift mit ihrem Blick gerade noch die Kratz- und Beulspuren im Lack, da hört sie ihr bekannt vorkommende Schritte, schon ganz nahe, sieht einen Schatten, will schon gerade erleichtert einen Namen rufen, da trifft sie, bevor sie sich ganz umdrehen kann, ein harter Schlag an der Schläfe, dann, beim Stürzen, ein zweiter, noch kräftiger, am Hinterkopf.
Ein Student findet sie fast eine Stunde später, weil er die Mensamarken in seinem Auto vergessen hat.
Dass Sophie Jansen, Professorin für Sprachgeschichte und neue Sprachtheorien, Opfer eines brutalen Überfalls im Universitätsparkhaus geworden und schon beim Transport in die Klinik an den Folgen gestorben war, sprach sich in Universität und Stadt noch am selben Tag mit allerlei zusätzlichen Gerüchten herum. Gewaltverbrechen dieser Art waren hier selten, noch dazu im Universitätsmilieu, jetzt schienen sie sich zu häufen. Erst Verena Roeder, darauf – der erste Fall war noch gar nicht geklärt – eine Professorin, an deren Seminaren jene Studentin regelmäßig teilgenommen hatte: wer da nicht zu spekulieren begann … Jedenfalls tat das später auch der Journalist der Lokalzeitung, mit dem Selbstbewusstsein dessen, der es auf die erste Seite gebracht hatte. Gab es Verbindungen zwischen den beiden Fällen? Worin konnten die bestehen? Hatte Frau Jansen etwas über den Roeder-Mord gewusst, was dem Mörder oder seinen Hintermännern, so es sie gab, gefährlich erschienen war? Oder waren beide in undurchsichtige Geschäfte verstrickt, denen sie dann zum Opfer fielen?
Was das sein könnte, war dem Autor des Artikels aber unerklärlich, auch wenn sich, wie er schrieb, die Universitäten mehr und mehr in gewinnorientierte Unternehmen verwandelten.
Also begnügte er sich mit Andeutungen über verwickelte Privatgeschichten. Auch diesmal sei von keinem Sexualdelikt im üblichen Sinne auszugehen, obwohl ihre Schuhe und Strümpfe verschwunden seien. Vielleicht sei der Täter gestört worden. Im Interview mit dem für beide Fälle zuständigen Kommissar erhielten diese Mutmaßungen einen Dämpfer. Er, so der Ermittler, gehe von einem zufälligen Zusammentreffen aus. Im Fall Roeder (der durchaus nicht ad acta gelegt worden sei) verfolge er Spuren, die in völlig andere Richtung wiesen. Seiner Meinung nach hätte Frau Jansen denjenigen, der ihr Auto aufgebrochen hatte, auf frischer Tat ertappt. Er hätte sie vielleicht gar nicht töten, sondern nur niederschlagen wollen, um zu fliehen. Die fehlenden Kleidungsstücke sollten die Untersuchung wahrscheinlich nur in die falsche Richtung lenken; für ein Sexualverbrechen gebe es keine Indizien. Eine Tat aus dem Augenblicksaffekt heraus. Jedenfalls wiesen alle Spuren in diese Richtung, doch gehe man allen Möglichkeiten nach.
Kersting erfuhr von dem Verbrechen noch am Nachmittag des Tattages und ausgerechnet in den Stunden, in denen er mit den ersten Zeichnungen von Jana Olivier für das geplante Porträt begonnen hatte.
Sie war pünktlich gewesen, ein paar Minuten nach drei hatte es an seine Haustür mit der immer noch defekten Klingel kräftig geklopft, er war gerade in der Küche beschäftigt: die Vorbereitungen für den Tee, den er in einer Pause servieren wollte. Porträtsitzungen waren schließlich immer sehr anstrengend. Als er die Tür weit öffnete, traf ihn ihre Ausstrahlung wieder so heftig, dass er sie in hilfloser Bewunderung umarmen wollte, aber unsicher, ob ihr das nicht zu schnell ging, blieb er mitten in der Bewegung stecken.
Natürlich hatte sie seine Absicht bemerkt, war aber gar nicht verstimmt, trat mit schnellem Schritt auf ihn zu und umarmte ihn nun ihrerseits, flüchtig zwar, doch mit deutlicher Freude in den Augen. Ihre weiße Regenjacke mit dem großen Kragen war sogar auf dem kurzen Weg vom geparkten Auto zum Haus etwas feucht geworden, es nieselte aus dem grauen Himmel. Er hängte sie sorgfältig auf einen Garderobenbügel neben dem Eingang, von ihrer Begrüßungsgeste eingefangen.
Er stieg ihr voraus die Treppe hinauf. So waren sie ins Atelier getreten, sie mit unverstellter, aber unaufdringlicher Neugier, er leicht verlegen, denn erst jetzt, gleichsam durch ihren Blick hindurch, sah er, wie unaufgeräumt es hier oben war. Auf dem großen Metallregal mitten im Raum lagen Skizzenblöcke, Photoapparate, Kreiden und Stifte in Metallbehältern oder Keramikbechern, in der Ablage darunter farbverschmierte Tücher und Glasplatten, ausgedrückte Farbtuben, Farbspraydosen und Paletten. Die Pinsel immerhin waren sorgfältig ausgewaschen und in Porzellanständern aufgereiht. Ganz oben Bücher und Broschüren gestapelt.
Ein schwerer großer Holztisch im Hintergrund, seitlich von der Fensterfläche, die durch eine Glastür auf einen kleinen Balkon hinaus vergrößert wurde, nahm eine schwere Holzdruckpresse auf; neben ihr ziemlich wild verstreut Probedrucke in verschiedenen Stadien. Darunter ein Halbschrank mit schmalen Graphikschubläden. Die Sitzgelegenheiten: sein dunkelblauer Lesesessel, auch nicht ganz von Farbflecken verschont, eine zweisitzige blaue Couch, der in der Höhe verstellbare Hocker und zwei Armlehnstühle, die immerhin von unpassendem Ballast verschont geblieben waren. Rechts und links von der Tür, durch die sie eingetreten waren, standen große, prall gefüllte Bücherregale.
Auf der Staffelei: der »Tanz der Prospekte«. Er verriet ihr den Titel, den er bisher für sich behalten hatte. Das Bild war noch unfertig, die Idee aber trat schon hervor. Es gefiel ihr, das sah er ihr an. Sie musterte es aus drei Metern Entfernung und trat dann ganz nah herzu, um den Farbauftrag besser zu sehen.
An der dem Fenster gegenüberliegenden Seite, mit dem Bild zur Wand hintereinander gestapelt, die fertigen Arbeiten, die noch zusammengepackt und an seine Galerie in Hannover verschickt werden mussten. Er sah ihren Blick.
»Ich zeige Ihnen gern alles, aber vielleicht später, wenn das heute etwas arg trübe Licht gar nicht mehr ausreicht.«
»Oh ja!« Mehr sagte sie nicht, sah sich aber weiter unbefangen um. Trat in den Hintergrund, wo die Wand zwischen zwei Türen mit Bildern in verschiedenen Graden der Fertigstellung engbehängt war.
»Sehr hell haben Sie es hier aber nicht, trotz der großen Fensterfläche.«
»Das macht heute das Wetter. Hell soll es sein, nur kein direkter Sonneneinfall. Die Fenster sehen nach Nordosten.«
Seit zwei Stunden sitzen sie nun hier, sie auf dem bequemsten Stuhl, den er aufbieten kann und dessen gerade Rückenlehne doch die aufrechte Haltung und Körperspannung unterstützt, er auf einem gepolsterten Schemel wie Pianisten ihn benutzen, den Papierblock vor sich auf einem schräg gestellten Zeichentisch festgeklemmt. Zwei Stunden, die er zu den intensivsten, den reichsten seines Lebens zählen wird, so viel geschieht unsichtbar in ihnen, so frei und leicht schwingen die Gedanken zwischen ihnen, so klarsichtig auch, dass jeder von ihnen meint, die des anderen lesen zu können.
Bis das Schrillen des Festnetztelefons die nur von gelegentlichen Bitten und Bemerkungen unterbrochene Stille abrupt beendet. Er hatte es auf lautlos stellen wollen und will es jetzt einfach ignorieren, doch Jana bewegt sich schon, dehnt den Körper ein wenig.
»Gehen Sie nur ran, eine Pause tut mir gut.«
Kersting erschrickt, zögert, entschuldigt sich für seine Unachtsamkeit, nimmt den Hörer. Es ist der Freund Reinke, Anwalt in einer Stuttgarter Kanzlei mit Wohnung in Tübingen. Seit ihrer gemeinsamen Studienzeit ein Freund, auf den er sich unbedingt verlassen kann.
So erfahren sie von dem Verbrechen, das längst die ganze Stadt erregt, nachdem auch bereits die Lokalnachrichten des SWR es gemeldet haben. »Auf Facebook und WhatsApp kann man bereits abenteuerliche Theorien und Täterprofile lesen.«
Sie sitzen dann beim Tee zusammen, in anderer Stimmung, als Kersting es sich erhofft hatte, ernst und bedrückt, die vergangenen zwei Stunden scheinen weit zurück zu liegen, ganz woanders, auf einer hellen Insel jenseits aller grausamen Vorkommnisse. Sie sind beide mit Erinnerungen an die Tote beschäftigt, wobei sie sich gestehen, dass sich bei beiden ein herzliches Verhältnis zu Frau Jansen oder wenigstens der Antrieb dazu nicht eingestellt hatte. Kersting lenkt dann das Gespräch auf die Hauptfrage, die sie unausgesprochen seit der telefonischen Nachricht bewegt: ob nämlich diese Tat mit den anderen Ereignissen um Verena Roeders Tod zusammenhängen könnte. Er meine ›ja‹, sagt Kersting, erntet Zustimmung, aber einen handfesten Grund dafür können beide nicht angeben. »Wir wissen zu wenig!«
»Das ist eine kleine Stadt«, bemerkte er, »da bleibt selten etwas verborgen. Die Einheimischen kennen sich, auch wenn die Verhältnisse durch die so kräftig gewachsene Universität nicht mehr so eng sind wie früher. Ich habe mit vielen gesprochen, bei Ausstellungen oder wenn man mich beim Skizzieren in Stadt und Umgebung ansprach. Jeder hatte etwas von jemand anderem zu erzählen. Dem einen waren Veränderungen an Nachbarhäusern aufgefallen, der andere wusste, dass der Sohn eines Bekannten ein Verhältnis mit einem Max-Planck-Spitzenforscher haben soll, eine Dritte berichtete von dem Erweiterungsprojekt eines Autohauses und welche Rolle der Baubürgermeister dabei spielt. Ich hatte den Eindruck, jeder weiß alles von jedem.«
»Und das haben die Ihnen einfach so erzählt?«
»Ein Maler ist für die meisten eine ganz neutrale Figur, der abseits von den lokalen Querelen lebt. Auf den man aber neugierig ist.«
»Das verstehe ich gut«, sagte die junge Frau mit leichtem Lächeln – »so haben Sie mich ja auch gefangen!« Beide lachten. Der Bann der bösen Nachricht lockerte sich etwas.
»Sind aber nicht Universität und Stadt ganz verschiedene Sphären, mit wenig Berührung? Ich jedenfalls komme mit echten Tübinger Ureinwohnern nur in Berührung, wenn ich mir mal eine Flasche Löwensteiner Riesling im Weinhaus Schmid leiste. Da sitzen dann einige an den zwei, drei kleinen Tischen, trinken ihr Viertele Wein und erzählen sich Geschichten in einer Sprache, in der für mich alles Hekuba ist!«
»Das gilt sicher für die meisten Studenten. Im Übrigen gibt es genug Überschneidungen. Da sind die Clubs wie Rotary oder Lions, in denen die Tübinger Geschäftswelt ebenso präsent ist, wie Institutsdirektoren, Ärzte, Architekten, Verleger. Und dann die Vorlesungen im Studium generale, da sitzen zur Hälfte Tübinger Bürgerinnen und Bürger.«
Kersting sah, dass es Jana fröstelte, stand auf, holte aus seinem Schlafzimmer eine leichte Decke und legte sie um ihre Schultern.
»Haben Sie von dem Millionenprojekt gelesen«, fuhr er fort, »das Stadt, Universität, Landesregierung und die großen Konzerne aus Stuttgart gemeinsam stemmen wollen? Überall schießen ja Silicon Valleys aus dem Boden, und das jetzt auch hier, in der Oberstadt, hinter den Kliniken, in der Nähe der Max-Planck-Institute. ›Man scheißt uns mit Geld zu‹, so hat das ein Spezialist für Künstliche Intelligenz drastisch beschrieben, den man mit viel Geld von Stanford eingekauft hat und der wegen eines Bildes zu mir kam. Geht inzwischen an den Universitäten zu wie beim DFB beziehungsweise in der Bundesliga man ersteigert sich die Spieler für die höchste Summe.«
Kersting hatte sich zuletzt in bitteren Eifer hineingeredet und brach ab, als er das Erstaunen in Jana Oliviers Augen sah.
»Entschuldigen Sie die Rage, aber mich macht diese Entwicklung, die Digitalisierung unserer Welt wütend. Mehr noch der ruchlose Optimismus unserer Politiker und Wissenschaftler; bei den Wirtschaftsbossen wundert’s mich nicht, natürlich.«
»Oh, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen.« Sie sah ihn mit einem ganz neuen Interesse an, sichtlich beeindruckt. »Künstler sind selten so beredt, wenn es nicht um ihre Sachen oder mindestens um die Freiheit der Kunst geht.«
»Nun ja,« gestand Kersting, »irgendwie geht es auch um diese Freiheit. Was ich fürchte, ist die technische Barbarisierung der Gesellschaft. Was möglich ist, wird gemacht, erst recht, wenn man Geld, viel Geld damit verdienen kann. Aber ich will nicht wieder eine lange Rede halten. Kehren wir zum lokalen Kriminalfall zurück, der liegt uns gerade mehr auf der Seele.«
»Lokaler Kriminalfall? Als Sie mir gerade das babylonische Tübinger Projekt schilderten, wusste ich plötzlich, was mir bisher nur so als Ahnung oder als Gefühl schon bei Verenas Tod gekommen ist und was dann stärker wurde, als Sie mir Ihre Erlebnisse mit den beiden Schlägern erzählt haben. Ich konnte es bloß noch nicht ausdrücken. Was wäre, wenn wir es hier gar nicht mit einem Lokalverbrechen zu tun haben?« Sie schwieg einen Augenblick.
»Verena hatte sich nach dem bösen Provence-Erlebnis verändert, aber der Unfall war nicht der einzige Grund dafür. Denn sie verreiste auf einmal öfter als zuvor. Ich, aber auch die anderen, die sie kannten, erfuhren selten – und immer erst nachträglich davon. In Frankfurt war sie, glaube ich. Ganz sicher aber oft am Bodensee. Wir fragten, sie blieb sehr vage: Eine Freundin aus dem Bremer Gymnasium, die zusammen mit ihr Abitur gemacht habe, ihr Bruder oder irgend ein anderer Verwandter, der sie wiedersehen wollte.«
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.