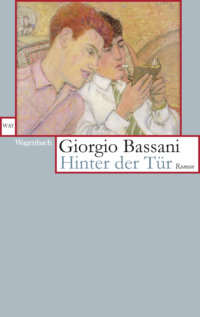Kitabı oku: «Hinter der Tür», sayfa 2
2
Ich weiß nicht, was in den 30 Jahren nach unserer Schulzeit aus Carlo Cattolica geworden ist.
Er ist der einzige meiner Schulkameraden, von dem ich nichts weiß: nicht, welchen Beruf er ergriffen hat, ob er geheiratet hat, wo er lebt, ja, ob er überhaupt noch lebt. Ich kann nur sagen, daß seine Familie 1933, nach seiner glänzend bestandenen Reifeprüfung, von Ferrara nach Turin umziehen mußte, wo sein Vater, der Ingenieur war (ein kahlköpfiges Männchen mit blauen Augen, leicht verrückt: Opernnarr und leidenschaftlicher Philatelist, übrigens vollkommen beherrscht von einem Feldwebel von Frau, einer Mathematikprofessorin, die ihn um Haupteslänge überragte), ganz unvermutet eine feste Stelle gefunden hatte, ich glaube bei einer Fabrik, die Lacke herstellte. Ob der junge Cattolica nun wirklich Chirurg geworden ist, wie er es schon damals, zu Beginn des Liceo, mit seiner üblichen Selbstsicherheit verkündet hatte? Und ob er wirklich das Mädchen geheiratet hat, das er allabendlich mit dem Fahrrad in Bondeno besuchte und mit dem er bereits seit mehr als einem Jahr verlobt war? (Hieß sie nicht Accolti, Graziella Accolti?) Selten ist einer Generation so übel mitgespielt worden wie der unseren; der Krieg und die übrigen Ereignisse haben so unendlich viele unserer Vorhaben und Lebenspläne zunichte gemacht, die nicht minder ernst gemeint waren als die von Carlo Cattolica. Und doch, irgend etwas sagt mir, daß er lebt und daß er, wie er es sich vorgenommen hatte, wirklich Chirurg geworden ist (wenn noch nicht berühmt, so im Begriff, es zu werden), auch daß er, obwohl er Ferrara noch als Junge verließ, letzten Endes doch noch seine Graziella geheiratet hat. Werden wir beide uns jemals wiedersehen? Wer weiß. Ich halte es immerhin für möglich. Aber nur Mut.
Ich sehe das Gesicht Cattolicas noch vor mir: sein klares Profil, rechts neben mir, von der Präzision einer Medaille. Er war groß und sehr schlank; seine funkelnden schwarzen Augen lagen tief unter den ein wenig hervorspringenden Brauenbogen, und seine Stirn, nicht hoch, aber breit, bleich und gelassen, war sehr schön. Es ist merkwürdig, aber das älteste Bild, das meine Erinnerung an ihn bewahrt, ist ebenfalls eine Seitenansicht. Wir waren schon in der Volksschule zusammen gewesen, in der Gemeindeschule Alfonso Varano in der Via Bellaria, schon damals allerdings der eine in der a-, der andere in der b-Klasse; und eines Morgens fiel mir während der Pause auf dem Schulhof seine merkwürdige Art zu laufen auf. Er lief die Mauer entlang und bewegte dabei die dünnen Beine in dem gleichmäßigen, weit ausgreifenden Laufschritt eines Mittelstreckenläufers. Ich erkundigte mich bei Otello Forti nach ihm. »Was, den kennst du nicht?« fragte er überrascht. »Das ist doch Cattolica.« Ich bemerkte, daß er ganz anders lief als wir alle, mich nicht ausgenommen. Bei uns genügte eine Kleinigkeit, uns abzulenken und aus der Richtung zu bringen. Er aber sah, während er lief, ruhig geradeaus, als ob er allein, als einziger unter so vielen, genau das Ziel kenne.
Nun saßen wir nebeneinander, nur durch ein paar Zentimeter voneinander getrennt. Aber irgend etwas, eine Art unsichtbarer Barriere, einer geheimen Demarkationslinie, verhinderte, daß wir mit der unbefangenen Vertrautheit von Freunden miteinander verkehrten. Ich hatte zwar anfänglich den einen oder anderen schüchternen Versuch in dieser Richtung unternommen, etwa indem ich ihn eines Tages, als wir eine Klassenarbeit in Latein zu schreiben hatten, darum bat, ausnahmsweise die beiden dicken Bände meines Wörterbuchs einmal rechts von dem Brett legen zu dürfen, das den Platz für unsere Bücher und Hefte in zwei vollkommen gleiche Fächer teilte. Doch die Kühle, mit der er zustimmte – mit einer winzigen Drehung des Kopfes um die eigene Achse –, ließ es mir nicht geraten erscheinen, mit ähnlichen Annäherungsmanövern fortzufahren. Wonach war ich denn auch auf der Suche?, dachte ich. Reichten mir die gesellschaftliche Bedeutung, die mondäne Wichtigkeit, die unserer Verbindung zukamen, nicht aus? Schon immer war Cattolica der Beste in den a-Klassen gewesen, von der ersten bis zur fünften Klasse des Gymnasiums (ganz zu schweigen von der Grundschule, wo sich die Lehrer auf dem Gang gegenseitig seine Aufsätze zu lesen gaben). Aber auch ich, selbst wenn ich mir hin und wieder eine Pause gönnte, hatte im Grunde immer zu der kleinen Gruppe an der Spitze gehört. Also? War es nicht ganz richtig, daß wir uns als die Bannerträger zweier Heerscharen, die von altersher gegeneinander angetreten waren, so und nicht anders verhielten? Daß im wesentlichen jeder an seinem Platz blieb?
Für gewöhnlich stellten wir im Umgang miteinander die größte Rücksichtnahme, Achtung und Ritterlichkeit zur Schau. War zum Beispiel einer von uns aufgerufen und abgefragt worden und kehrte nun an seinen Platz zurück, dann sparte der andere nicht mit, je nachdem, beifälligem oder trostspendendem Lächeln, nicht mit beglückwünschendem oder auch kameradschaftlich mitfühlendem Händedrücken. Und er sorgte dafür, daß der hinter uns sitzende Mazzanti, der – vollkommen im Bilde über unser Verhältnis und eine Möglichkeit witternd, für sich und Malagù einen Vorteil aus der Situation zu ziehen – gleich zu Beginn ein privates Register angelegt hatte, in dem er Tag für Tag sorgfältig unsere Zensuren eintrug, nun auch wirklich genau die Punkte für den andern notierte und sich als der unparteiische Schiedsrichter, der ergebene und korrekte Buchhalter erwies, der er immer sein wollte. Aber wenn dann die Klassenarbeiten kamen, löste sich das zarte Gespinst gesellschaftlicher Heuchelei jäh wie Nebel in der Sonne. Dann konnte uns keine noch so schwierige Stelle im Griechischen oder Lateinischen zu einer gemeinsamen Anstrengung bewegen. Da arbeitete jeder für sich und hütete eifersüchtig das Resultat seiner eigenen Bemühungen; da geizte jeder mit sich selbst und hätte lieber eine unvollständige oder falsche Übersetzung abgeliefert, als daß er dem andern etwas hätte verdanken müssen. Wie ich es vorausgesehen hatte, übernahmen Droghetti und Camurri, die auf den Bänken vor uns saßen, die Rolle der zuverlässigen Vermittler zwischen Cattolica und den weit vorgeschobenen Vorposten Boldini und Grassi. Wenn die Zeit drängte und Professor Guzzo den Blick von den Korrekturfahnen seiner Arbeit über Sueton hob und mit grausamem Lächeln ankündigte, daß in genau zehn Minuten, und nicht einer mehr, der ›ausgezeichnete‹ Chieregatti die ›Elaborate der Herren‹ einsammeln würde, dann mußte man gesehen haben, wie das Fernsprechnetz der alten a-Klasse funktionierte, mit welch unverschämter Perfektion es wieder in Betrieb gesetzt wurde! In diesen dramatischen Augenblicken war es aus mit dem Lächeln und Händedrücken und mit allen geheuchelten Bekundungen liebenswürdiger Kameradschaft. Die Maske fiel. Und nun zeigte sich mir das sonst so glatte Gesicht Cattolicas, verzerrt von ehrgeiziger Anspannung, wie es wirklich war, in seiner ganzen Feindseligkeit und Gehässigkeit. Es zeigte sich endlich nackt.
Und doch, obwohl ich ihn verabscheute, bewunderte und beneidete ich ihn.
Es gab kein Fach, in dem er nicht vollkommen war, in Italienisch wie in Latein, in Griechisch wie in Geschichte und Philosophie, in Biologie, Mathematik und Physik nicht anders als in Kunstgeschichte, ja sogar im Turnen (vom Religionsunterricht war ich befreit, nahm also nicht am Unterricht Don Fonsecas teil, doch ich zweifelte nicht, daß Cattolica auch bei dem ›Priester‹ ein Musterschüler war); ich haßte seine geistige Klarheit und neidete sie ihm zugleich wie das luzide Funktionieren seines Hirns. Was für ein Wirrkopf war ich, verglichen mit ihm! Zwar war ich im italienischen Aufsatz vielleicht besser als er. Aber natürlich nicht immer; es kam auf die Aufgabe an; die eine machte mir Freude, die andere nicht; und wenn mir ein Thema nicht zusagte, war nichts zu machen; da war es schon viel, wenn ich sechs Punkte bekam. So war ich vielleicht im mündlichen Übersetzen in Latein und Griechisch brillanter (Guzzo hatte mir nach dem anfänglichen Geplänkel sein Wohlwollen geschenkt; wenn wir Homer oder Herodot lasen – vor allem Herodot –, wandte er sich fast immer an mich, um, wie er sagte, ›die genaue Übersetzung‹ zu hören), aber im Schriftlichen, besonders bei der Übersetzung aus dem Italienischen ins Lateinische, war mir Cattolica klar überlegen. Er hatte die ausgefallensten kleinen Regeln der Formenlehre und Syntax im Kopf und irrte sich praktisch nie. Sein Gedächtnis erlaubte ihm zum Beispiel, in der Geschichtsstunde Dutzende und Aberdutzende von Daten, wie aus der Pistole geschossen und ohne sich nur einmal zu irren, anzugeben. Oder vor der vor Wonne schier zerfließenden Krauss in der Biologiestunde die Klassen der Wirbellosen aufzusagen – so sicher und unbefangen, als läse er sie aus einem Buch ab. Wie machte er das, fragte ich mich. Was verbarg sich in seinem Schädel? Eine Rechenmaschine? Mazzanti zögerte nicht. Nach derartigen Gedächtnisleistungen war er bereit, in sein Register eine Neun, ja, eine Neun plus einzutragen. Und das Tollste dabei war, daß das ›Plus‹ sehr oft auf mich zurückging, der ich mich rasch umgewandt und darauf bestanden hatte, daß Mazzanti es hinzufügte.
Aber das Gefühl meiner Unterlegenheit rührte nicht einmal so sehr vom Vergleich unserer Leistungen in der Schule her als von ganz anderen Dingen.
Da war zuerst der Unterschied in der Größe. Er war groß und hager, ein junger Mann bereits und wie ein junger Mann gekleidet, mit langen Hosen aus grauem Vigogneflanell und einem andersfarbigen Sakko aus einem schweren Stoff – in der Tasche steckte ein Zehnerpäckchen Macedonia-Zigaretten – und einer hübschen Krawatte aus Organdy. Ich dagegen – klein und untersetzt, in meinen ewigen Knickerbockers, in denen ich mich so unglücklich fühlte und für die meine Mutter eine besondere Vorliebe hatte – nahm mich neben ihm nur wie ein kleiner Junge aus. Dann der Sport. Cattolica übte keinen aus. Er verachtete das Fußballspiel, aber nicht deshalb, weil er es nicht beherrschte (er hatte einmal auf dem Platz vor der Kirche del Gesù bei einem Spiel mitgemacht und dabei einen hervorragenden Stil gezeigt), sondern weil Sport ihn nicht interessierte und ihm nur verlorene Zeit bedeutete. Ferner: Für welche Fakultät würde ich mich einmal entscheiden, wenn ich auf die Universität ging? Ich wußte es noch nicht. Heute neigte ich zur Medizin, morgen zur Jurisprudenz, dann wieder zur Literaturwissenschaft. Er dagegen hatte sich nicht nur bereits für das Studium der Medizin entschieden, sondern auch seine Wahl zwischen innerer Medizin und Chirurgie zugunsten der letzteren getroffen. Und schließlich hatte er ein Mädchen, das er liebte und das ihn liebte, das Mädchen aus Bondone. Auf diesem Gebiet fehlte mir noch jede konkrete Erfahrung. (Konnte man Erfahrungen nennen, was ich im Sommer am Strand mit kleinen Mädchen erlebt hatte, dies bißchen Hand-in-Hand-Sitzen, Sich-in-die-Augen-Blicken, einen flüchtigen Kuß auf die Wangen und weiter nichts …?) Er dagegen war richtig verlobt: offiziell, mit einem gewaltigen Ring am Finger. Oh, dieser Ring! Es war ein Saphir, in Weißgold gefaßt, ein imponierender Ring, wie für einen Commendatore – und mir besonders unsympathisch. Und doch, wie sehr wünschte ich mir selbst einen solchen Ring! Wer weiß, dachte ich, um ein Mann zu werden, oder wenigstens um das Mindestmaß an Selbstsicherheit zu gewinnen, das man unbedingt braucht, um als einer zu gelten, konnte solch ein Ring vielleicht von großem Nutzen sein.
Mit wem zusammen machte Cattolica nachmittags die Schulaufgaben? Am Anfang war ich nicht dahintergekommen. So sehr schien er sich selbst zu genügen, so unerreichbar zu sein, daß ich an einen wirklichen, vertrauten Freund nicht glauben konnte. Selbst sein Verhältnis zu Boldini und Grassi schien mir von Fall zu Fall von reinen Zweckmäßigkeitserwägungen bestimmt; ich glaubte nicht, daß er je einen Schulkameraden in seiner Wohnung in der Via Cittadella empfing, auch nicht Boldini und Grassi.
Doch das war ein Irrtum.
Eigentlich hatte ich schon vorher etwas geahnt, und zwar seit jenem Morgen, an dem ich als letzter die Treppe vom Chemie- und Naturkundesaal (dem unbeschränkten Herrschaftsbereich der Krauss’) herunterkam und mich, als ich einmal aufblickte, plötzlich den dreien gegenüber fand: Cattolica, Boldini und Grassi, die im Gespräch auf dem Treppenabsatz stehen geblieben waren. Sie sehen und erraten, daß sie gerade dabei waren, eine Verabredung für den Nachmittag in der Wohnung eines von ihnen zu treffen, war eins. Tatsächlich änderten sie, sowie sie mich bemerkt hatten, das Gesprächsthema und begannen – man stelle sich das vor! – eine Diskussion über Fußball, als ob ich nicht gewußt hätte, daß sich Cattolica überhaupt nicht für Sport interessierte und nie über sportliche Ereignisse sprach.
Aber ich wollte mich selbst überzeugen können, wollte es mit Händen greifen. Und als ich am Abend meinen Vater im Klub der Kaufleute nicht angetroffen hatte (seitdem ich nicht mehr mit Otello meine Schularbeiten machte, hatte ich mir angewöhnt, mit dem Rad am Klub vorbeizufahren und meinen Vater dort jeden Abend gegen sieben Uhr abzuholen), entschloß ich mich plötzlich: statt nach Hause zu radeln, fuhr ich zur Kreuzung des Viale Cavour und der Via Cittadella und wartete ab.
Es war etwa zwanzig Minuten vor acht. Der Viale Cavour war vom Kastell bis zur alten Stadtzollschranke beleuchtet; die breite, umgepflasterte Via Cittadella schien dagegen wie in einem dunklen Nebel versunken. Ich rührte mich nicht von der Stelle und behielt das Haus Cattolicas im Auge. Es lag ungefähr hundert Meter von der Kreuzung entfernt – eine freistehende rote Villa mit zwei Stockwerken, vor nicht allzulanger Zeit erbaut, schön, gewiß, aber, so fand ich, zugleich irgendwie ein wenig vulgär. Waren zum Beispiel die rosa Gardinen vor den erleuchteten Fenstern im zweiten Stock nicht gewöhnlich, ja zweideutig? Ähnliche Gardinen schimmerten durch die angelehnten Fensterläden einiger Bordelle in der Via Colomba, in denen Danieli und Veronesi wie daheim waren.
Eine Viertelstunde verging. Schon schickte ich mich an fortzufahren (mir war der Verdacht gekommen, daß die Zusammenkunft anderswo abgehalten wurde, bei Grassi an der Piazza Ariostea oder bei Boldini in der Via Ripagrande), als sich die Haustür öffnete und nacheinander alle drei heraustraten, auch Cattolica.
Sie bestiegen ihre Räder und fuhren die Via Cittadella herauf bis zum Viale Cavour, glücklicherweise langsam genug, um mir Zeit zu lassen, ebenfalls aufs Rad zu springen und mich weit genug von der Kreuzung zu entfernen. Dort angelangt, trennten sich die drei. Boldini und Grassi bogen links ab, zur Stadtmitte, Cattolica rechts, zur alten Stadtzollschranke.
Wohin fuhr er jetzt? Es war klar: Er war unterwegs nach Bondeno zu seiner Freundin. Aber der Gedanke, daß er sich nach einem arbeitsreichen Tage (am Vormittag in der Schule, von der allgemeinen Achtung getragen, am Nachmittag zu Hause, umgeben von der Verehrung und Zuneigung seiner nächsten Freunde) nun auch noch den Luxus gestatten konnte, seiner Verlobten den Gutenachtkuß zu geben, war mir plötzlich unerträglich.
3
Obwohl Otello Forti nach den ersten zwei Monaten ein vorzügliches Zeugnis erhalten hatte, wollte er in den Ferien nur drei Tage daheim verbringen, den Heiligabend und die beiden Weihnachtstage. Ich sah ihn nur kurz, am zweiten Feiertag, ein paar Stunden, bevor er nach Padua zurückfuhr. Er war mit seinen Gedanken schon ganz bei der bevorstehenden Abreise. Ich besuchte ihn zu Hause, in der Via Montebello 24.
Er führte mich zunächst vor die große, prächtige Krippe, die wie immer im Erdgeschoß im Wohnzimmer stand und die ich bewundern sollte. Es war seit mindestens zehn Jahren das erste Mal, daß keiner der Brüder daran gedacht hatte, mich zur Mitarbeit bei der Aufstellung der Krippe aufzufordern. Danach stiegen wir in sein Zimmer hinauf. Aber selbst dort, in seinem kleinen Zimmer im obersten Stock, das mir immer auch ein wenig wie mein eigenes Zimmer gewesen war, konnte ich mich nicht nützlich machen. Sowie wir oben waren, nötigte er mich in den Sessel am Fenster. Dann begann er, seinen Koffer zu packen. Als ich aufstand, um ihm zu helfen, wollte er durchaus, daß ich mich wieder setzte. Er packe lieber allein, erklärte er mir, da er es so viel schneller hinter sich brächte. Solcher Beharrlichkeit gegenüber gab ich nach, setzte mich wieder und sah ihm von meinem Sessel aus zu. Ohne den Blick zu heben, machte er sich an seinem Koffer mit einer Langsamkeit zu schaffen, die etwas Gewolltes hatte. Ich hatte ihn anders in Erinnerung gehabt, blonder, dicker, rosiger. Vielleicht war er, abgesehen davon, daß er in seinen langen Hosen schlanker wirkte, tatsächlich magerer geworden und auch ein paar Zentimeter gewachsen. Aber in seinen Augen lag jetzt, hinter den Brillengläsern, die er als Kurzsichtiger brauchte, ein ernster, ja bitterer Ausdruck, der mich kränkte und verletzte. Nun hatte er zwar nie, überlegte ich, einen sehr aufgeschlossenen Charakter gehabt. Von uns beiden hatte stets ich die Initiative ergriffen, ob es sich um ein Spiel, eine Fahrt mit dem Rad über Land oder um eine Lektüre handelte, die nicht zu unserem Pensum gehörte, wie Salgari, Verne und Dumas. Er ließ sich von mir mürrisch und widerstrebend, aber manchmal, Gott sei Dank, auch lachend mitreißen; insgeheim bewunderte er mich, gerade weil es mir hin und wieder gelang, ihn zum Lachen zu bringen. Aber jetzt? Was hatte sich zwischen uns geändert? Wieso hatte ich Schuld daran, daß er nicht versetzt worden war? Warum machte er nicht endlich Schluß mit dieser Trauermiene?
»Was hast du?« fragte ich ihn.
»Ich? Nichts. Wieso?«
»Ach, ich weiß nicht. Es sieht beinahe so aus, als ob du auf mich böse wärst.«
»Gratuliere! Du bleibst immer derselbe«, antwortete er, mit einem Lächeln, bei dem sich nur seine Lippen verzogen.
Offenbar spielte er auf meine alte Neigung an, mir über jede Kleinigkeit Gedanken zu machen, und auf mein ständiges Bedürfnis nach dem Wohlwollen der anderen; aber er hatte wohl auch die Veränderung im Sinne, die das Mißgeschick an seinem Charakter bewirkt hatte. Falls es mir Spaß machte, mochte ich mich weiterhin meinen üblichen dummen und kindischen Einbildungen hingeben, schien er sagen zu wollen. Er aber nicht; denn er hatte weder Lust noch Zeit dazu. Sein Unglück hatte einen Mann aus ihm gemacht; und ein Mann mußte seine Würde wahren.
»Ich verstehe nicht, was du sagen willst«, erwiderte ich. »Aber, entschuldige, ist das überhaupt eine Art und Weise? Wenn du mir wenigstens geschrieben hättest …«
»Soviel ich weiß, habe ich dir geschrieben. Hast du meine Briefe nicht erhalten?«
»Doch, schon gut, aber …«
»Nun also!«
Jetzt hatte er den Blick erhoben und sah mich an, hart und feindselig.
»Wie oft hast du mir geschrieben? Drei Briefe waren es in den beiden ersten Wochen. Und dann – nichts mehr.«
»Und du?«
Er hatte recht. Ich hatte als erster nicht mehr geantwortet. Aber wie sollte ich ihm jetzt erklären, warum ich nicht mehr den Mut gehabt hatte, eine Korrespondenz fortzusetzen, bei der unsere Rollen plötzlich vertauscht waren? Ich hatte gemeint, es sei an mir, ihn über sein Unglück zu trösten. Statt dessen hatte in gewisser Weise er mir von Anfang an gut zureden und mich trösten wollen.
Es war ein milder Tag (kein Vergleich zu dem strengen Winter des Vorjahrs – trotz der schon vorgeschrittenen Jahreszeit war die starke Kälte bisher ausgeblieben), und so gingen wir später in den Garten. In der blauen, ein wenig nebligen Luft der Abenddämmerung besuchten wir noch einmal all die Orte, die sich mit unserer Freundschaft verbunden hatten – eine Art Generalbesichtigung: den schönen Rasen in der Mitte, jetzt feucht und kahl, wo wir beide, zusammen mit seinen Brüdern und Vettern, so manche Partie Krocket gespielt hatten; das kleine Bauernhaus dahinter, dessen Erdgeschoß als Lagerraum für Holz und Kohlen und dessen erster Stock als Taubenschlag benutzt wurde; und schließlich den mit Bäumen bestandenen Hügel an der Gartenmauer, auf dem Giuseppe, der ältere Bruder Otellos, in einem grauen Verschlag, der aus wurmstichigen Brettern und einem Drahtgitter bestand und ursprünglich als Hühnerstall gedient hatte, Kaninchen züchtete. Otello führte jetzt die Unterhaltung. Er erzählte mir ziemlich weitschweifig von seinem Leben im Internat, das, so gab er zu, hart war, vor allem wegen der unmöglichen Zeiten, zu denen sie von den Präfekten des Morgens geweckt wurden (um Viertel nach fünf mußten sie aufstehen; dann ging es in die Kapelle zum Beten), aber es war auch gut organisiert, damit niemand die Hände in den Schoß legen konnte und immer irgend etwas zu tun hatte. Das Pensum? Sehr viel umfassender als das unsere im vergangenen Jahr. In Latein würden sie über das dritte Buch der Äneis geprüft werden, ferner über Ciceros Briefe und Den Krieg mit Jugurtha von Sallust; im Griechischen über die Kyrupädie des Xenophon, die Dialoge des Lukian und eine Auswahl aus den Parallelbiographien des Plutarch; und im Italienischen über Die Verlobten von Manzoni und Den rasenden Roland des Ariost.
»Den Orlando furioso ganz?« fragte ich verblüfft.
»Ja, ganz«, antwortete er trocken.
Eine Frage aber hatte mir auf den Lippen gebrannt, und erst im letzten Augenblick, vor der Tür, schon im Begriff zu gehen, entschloß ich mich, sie zu stellen. »Hast du dich dort schon mit irgend jemandem angefreundet?« fragte ich ihn.
Mit augenscheinlicher Genugtuung bejahte er. Doch, er habe einen sehr sympathischen Jungen aus Venedig kennengelernt, mit dem zusammen er nun arbeite. Er hieß Alzerà, Leonardo Alzerà (sein Vater war Graf!) – ein sehr begabter Bursche, auch in Italienisch, Latein und Griechisch, aber hauptsächlich in Mathematik und Geometrie; in diesen beiden Fächern sei er – unter Garantie! – nicht zu schlagen. Ich schmierte rasch mal ein Gedicht oder eine Novelle herunter, nicht wahr? Schön, er aber löste mit der gleichen Leichtigkeit zu seinem Vergnügen komplizierteste Gleichungen dritten Grades. Ein Phänomen! Mit einem solchen Kopf konnte es nicht schwer sein, einmal Wissenschaftler, Erfinder, kurz, eine Berühmtheit zu werden …
Ob sich das Folgende tatsächlich am Morgen des 8. Januar, bei Schulbeginn nach dem Dreikönigsfest, zugetragen hat, kann ich nicht mit Bestimmtheit erklären. Ich glaube, ja. Sicher ist, daß ich eines Morgens früh, eine halbe Stunde vor dem Läuten in die Del-Gesù-Kirche trat. (Ich war noch nie in der Kirche selbst gewesen; wenn Otello vor einer Klassenarbeit oder in Voraussicht einer wichtigen Prüfung hier eintrat, ›um sich die Götter gnädig zu stimmen‹, wie ich es voller Nachsicht bei mir nannte, hatte ich ihn immer nur bis zur Tür begleitet, ohne die Schwelle je zu überschreiten.)
Kein Mensch war um diese Stunde in der Kirche. Ich hatte langsam das rechte Seitenschiff durchschritten, die Nase in der Luft wie ein Tourist; aber die durch die hohen Fenster einfallenden Sonnenstrahlen ließen mich die großen barocken Gemälde über den Altären nicht klar erkennen. Vor dem in Halbdunkel getauchten Chor angelangt, war ich zum linken Seitenschiff hinübergegangen, das vom Sonnenlicht überflutet war. Hier aber erregte sogleich eine seltsame Gruppe bewegungsloser und schweigsamer Gestalten meine Aufmerksamkeit, die sich neben der zweiten der beiden Nebenpforten eingefunden hatte.
Wer waren sie? Wie ich bald erkennen konnte, sowie ich nahe genug gekommen war, handelte es sich nicht um lebende Personen, sondern um Statuen. Statuen aus bemaltem Holz, in Lebensgröße gearbeitet. Und zwar um jene berühmte Beweinung Christi aus S. Maria della Rosa, vor die mich in meiner Kindheit Malvina (meine einzige katholische Tante) so oft geführt hatte, allerdings nicht hier, sondern eben in S. Maria della Rosa in der Via Armari, von wo die Gruppe offenbar später in die Jesuskirche gebracht worden war. Auch jetzt versenkte ich mich wieder in die grausame Szene und sah den fahlen, gemarterten Leib des toten Christus, der auf dem nackten Boden ruhte, und um ihn versammelt, erstarrt in ihrem Schmerz in stummer Gebärde, mit stummen verzerrten Gesichtern, mit Tränen, die sich nie ausweinen durften, die Angehörigen und Freunde: Maria, Johannes, Joseph von Arimathia, Simon, Magdalena und zwei fromme Frauen. Und während ich die Statuen betrachtete, erinnerte ich mich an Tante Malvina, die bei diesem Anblick nie ihre Tränen zurückhalten konnte. Sie zog den schwarzen Jungfernschal über ihre Augen und kniete nieder, natürlich ohne daß sie es wagte, auch ihren kleinen ungetauften Neffen niederknien zu heißen.
Endlich raffte ich mich auf, wandte mich um und wollte die Kirche verlassen.
Und in diesem Augenblick entdeckte ich Carlo Cattolica. Er kniete in einer Bank des Mittelschiffs, ruhig und gesammelt, der einzige Besucher in der Kirche.
Meine erste Regung war, ihn nicht zu stören und fortzugehen, ohne daß er mich bemerkte. Statt dessen ging ich auf Zehenspitzen und mit klopfendem Herzen durch das Seitenschiff bis zu seiner Bank.
Er hatte seine Bücher neben sich gelegt und betete. Die schöne, reine Stirn über die gefalteten Hände gebeugt, bot er mir, der ich ihn beobachtete, das gleiche scharfgeschnittene, rätselhafte Profil, das er mir täglich in der Schule zeigte. Ich spürte einen Schmerz. Warum waren wir nicht Freunde, fragte ich mich. Warum konnten wir nicht Freunde werden? Vielleicht, weil er mich nicht genug schätzte? Aber daran konnte es nicht liegen, denn wie tüchtig und intelligent Boldini und Grassi immer sein mochten, sie waren es gewiß nicht mehr als ich. Dann vielleicht der unterschiedlichen Religion wegen? Aber die Zugehörigkeit zu einer anderen Religion hatte zwischen Otello und mir nie eine Rolle gespielt. Ganz und gar nicht. Die Fortis waren alle sehr religiös und in katholischen Organisationen tätig (der Rechtsanwalt Forti gehörte dem Vinzenzverein an, und auch Giuseppe war vor zwei Jahren dort Mitglied geworden), und doch hatte mich keiner von ihnen je spüren lassen, daß ich Jude war. Übrigens waren die Eltern Cattolicas keineswegs dafür bekannt, besonders kirchlich gesinnt zu sein. Warum also? Warum?
Cattolica hatte sich erhoben, sich bekreuzigt und mich bemerkt – er kam auf mich zu. »Nanu, was machst du denn hier?« fragte er mich leise.
»Ich habe mir die Beweinung angesehen«, antwortete ich und wies dabei mit dem Daumen in die Richtung der Statuengruppe.
»Ach, hast du die noch nicht gekannt?«
Doch, ich hätte sie schon gekannt, erklärte ich ihm, da ich sie als Kind des öfteren in S. Maria della Rosa gesehen hätte. Und während wir noch einmal umkehrten, um die Statuen nun gemeinsam anzuschauen, verbreitete ich mich über Tante Malvina und ihre Leidenschaft, Kirchen zu besichtigen, sämtliche Kirchen der Stadt.
Das schien ihn zu interessieren. Er wollte wissen, wer diese Tante war. Vielleicht die Schwester meiner Mutter?
»Nein, die Schwester meiner Großmutter«, erwiderte ich und fügte hinzu: »Meiner Großmutter mütterlicherseits, die eine Marchi ist.«
Wir waren unterdessen auf den Platz vor der Kirche hinausgetreten. Es fehlten nur noch wenige Minuten bis neun Uhr, und überall, auf dem Kirchplatz, in der Via Borgoleoni und vor allem vor der Tür des Gymnasiums zeigten sich in Scharen die Schüler. Nebeneinander lehnten wir an der roten Fassade der Jesuskirche. Und da uns keiner unserer Kameraden zu bemerken schien, setzten wir die Unterhaltung fort. Es war das erste Mal. Das Ereignis bewegte mich. Es machte mich gesprächig, es reizte mein Bedürfnis nach vertraulicher Mitteilsamkeit.
Wir hatten begonnen, allgemein über Religion zu sprechen, aber er fragte mich, ob es wahr sei, daß wir ›Israeliten‹ nicht an die Madonna glaubten, ob es stimme, daß nach unserer Auffassung Jesus Christus nicht der Sohn Gottes sei, ob es zutreffe, daß wir noch immer den Messias erwarteten, ob wir tatsächlich ›in der Kirche‹ den Hut auf dem Kopfe behielten, und dergleichen mehr. Und ich antwortete Punkt für Punkt mehr als bereitwillig auf alle Fragen, weil ich plötzlich fühlte, daß seine oberflächliche, gewöhnliche, ja taktlose Neugier mich nicht verletzte, sondern mir im Gegenteil gefiel, mich befreite.
Aber zuletzt stellte ich ihm eine Frage.
»Entschuldige«, fragte ich, »seid ihr – ich meine deine Familie – schon immer katholisch gewesen?«
»Das möchte ich meinen«, antwortete er mit einem angedeuteten, hochmütigen Lächeln. »Warum?«
»Ich weiß nicht. Cattolica ist ein Ort, am Meer … zwischen Riccione und Pesaro, und die Juden haben alle, wie du weißt, ihre Familiennamen nach den Namen von Städten und Dörfern erhalten.«
Er straffte sich.
»Aber das stimmt nicht«, widersprach er sogleich und zeigte sich, wenigstens auf diesem Gebiet, vollkommen informiert. »Viele Israeliten heißen nach Städten und Dörfern, aber nicht alle. Eine ganze Reihe hat Namen wie Levi, Cohen, Zamorani, Passigli, Limentani, Finzi, Contini, Finzi-Contini, Vitali, Algranati und so fort. Was hat das damit zu tun? Ich könnte ebensogut eine endlose Reihe von Leuten aufzählen, die Namen haben, die jüdisch klingen, ohne daß sie deswegen jüdisch sind.«
Er war unterdessen weitergegangen, fuhr aber fort, mit gedämpfter Stimme, das Thema ausführlich zu erörtern. Was uns die Gelegenheit gab, ausnahmsweise einmal zusammen durch die große Schultür zu gehen, dann den langen Gang hinunter bis zu unserer Klassentür und schließlich, immer Seite an Seite, durch das Klassenzimmer bis zu unserer Bank zu gelangen, ganz wie zwei gute alte Freunde.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.