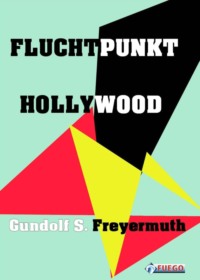Kitabı oku: «Fluchtpunkt Hollywood»
Gundolf S. Freyermuth
Fluchtpunkt Hollywood
Sieben Porträts deutscher Filmemigranten
FUEGO
Über das Buch
Die große Flucht vor der Nazi-Barbarei war ein einmaliger Exodus an Talent und Wissen, an Erfahrung und handwerklichem Können. Eine ganze Kultur wanderte nach 1933 aus Deutschland aus. Kaum ein Schriftsteller von Rang mochte den Nazis dienen, von zehn Professoren flohen vier, die Mitarbeiter von Filmproduktionen fanden sich fast vollständig in Hollywood wieder. Die amerikanische Filmmetropole zog Autoren und Regisseure, Schauspieler und Produzenten an.
Ins Exil zu gehen, bedeutete aber auch, aus der Welt gejagt zu werden, in die man geboren wurde. Die Emigration zerstörte langgehegte Hoffnungen - und eröffnete neue Chancen. Für gut anderthalb Jahrzehnte, von der Mitte der dreißiger bis zum Ende der vierziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wurde Los Angeles zur Hauptstadt eines besseren, des »Anderen Deutschland«.
Ein halbes Jahrhundert später, in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre, besuchte Gundolf S. Freyermuth sieben deutsche Filmemigranten in den USA – letzte Überlebende des Exils in Hollywood:
- den Cutter und Regisseur Paul Falkenberg,
- die Schauspielerin und Sängerin Gitta Alpar,
- den Schauspieler und Regisseur Paul Henreid,
- den Produzenten und Regisseur Gottfried Reinhardt,
- den Romancier und Drehbuchautor Hans Sahl,
- die Schauspielerin Grete Mosheim
- den Romancier, Drehbuchautor und Regisseur Curt Siodmak.
Die Porträts erschienen, in der Regel gekürzt, zwischen 1988 und 2000 in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften, insbesondere in der stern-Serie “Fluchtpunkt Hollywood” – deren Titel wiederum auf Jan-Christopher Horaks hervorragende Studie Fluchtpunkt Hollywood: Eine Dokumentation zur Filmemigration nach 1933 aus dem Jahre 1983 verwies. Einige der Texte wurden auch 1990 in das Reportagebuch Reise in die Verlorengegangenheit eingearbeitet (siehe Drucknachweise im Anhang). Diese digitale Edition publiziert alle Texte zum ersten Mal selbständig und ungekürzt.
- Prolog -
Der große Exodus
Kaum ein Schriftsteller von Rang hat den Nazis dienen wollen, komplette Forschungsinstitute zogen in die USA, von zehn Professoren flohen vier, unter den 3000 Spitzenwissenschaftlern, die ihre Heimat verlassen mussten, waren allein neunzehn Nobelpreisträger, die Mitarbeiter von Filmproduktionen fanden sich fast vollständig in Hollywood wieder – eine ganze Kultur wanderte aus.
Doch das 1933 ausgetriebene Stück deutscher Tradition wieder einzubürgern, bestand nach der unfreiwilligen Befreiung durch die Alliierten wenig Neigung. An das Schicksal der Emigranten, der Bewohner des »Anderen Deutschland«, als dessen Repräsentant sich Thomas Mann in Kalifornien empfand, wollte das schlechte Gewissen der Täter und Mitläufer sich nicht erinnern lassen. Ein Grabmal des unbekannten Emigranten existiert nicht.
Anders in den USA. Dort erkannte man die historische Bedeutung des deutschen Exils. »Seit nach dem Fall von Konstantinopel im Jahr 1453 Gelehrte in großer Zahl nach Westeuropa geströmt waren«, schreibt etwa der amerikanische Literaturwissenschaftler James K. Lyon, »hatte die Welt keine so umfängliche, plötzliche Bereicherung einer Kultur auf Kosten einer anderen erlebt.«
Erst im Gefolge der Studentenrevolte kam auch in der Bundesrepublik die Wiederkehr des Verdrängten, wurde die Tradition des »Anderen Deutschland« zum lebendigen Teil des Kulturlebens. Um vieles einflussreicher als die Werke aus der Zeit des »Tausendjährigen Reiches« sind für unser Denken die Leistungen der Emigranten – die Lehren etwa der Soziologen und Philosophen Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Ernst Bloch, die eine ganze Generation von Studenten prägten; die Einsichten von Psychoanalytikern wie Erich Fromm oder Wilhelm Reich; die Ästhetik der Bauhaus-Künstler; die Romane Thomas und Heinrich Manns, Lion Feuchtwangers oder Alfred Döblins, die Gedichte und Dramen Bert Brechts.
Die gewiss aber nachhaltigste Wirkung auf die Nachkriegsgenerationen haben die emigrierten Regisseure und Drehbuchautoren, Kameramänner und Cutter, Schauspieler und Produzenten gewonnen, die Schöpfer von Filmen wie Casablanca oder High Noon, Ninotchka oder From Here to Eternity, River of No Return, Sunset Boulevard oder Some Like It Hot. Wie keine andere Gruppe von Emigranten sind sie heimgekehrt – in unsere Köpfe und Herzen.
Wenige nur im bundesdeutschen Millionenpublikum wissen allerdings, dass die Menschen, die diese Hollywood-Filme schufen, nicht in Connecticut oder North Dakota aufwuchsen, sondern in Wien oder Berlin, dass ihre Karriere nicht bei MGM oder Paramount begann, sondern bei der Ufa oder der Münchner Lichtspielkunst.
Schuld an dem geringen Bewusstsein von der Bedeutung des deutschen Exils hatte nicht zuletzt die obsessive Beschäftigung mit den Nazi-»Größen« in den Massenmedien der Nachkriegszeit. Vergleicht man das geringe Interesse, das in den fünfziger, sechziger, siebziger und auch noch achtziger Jahren für die aus Deutschland Verjagten aufgebracht wurde, mit der intimen Aufmerksamkeit, ja Faszination, die Gestalten wie Bormann oder Heß, Frank, Mengele oder gar Hitler und seine vermeintlichen Tagebücher weiterhin weckten, so stellt sich das ungute Gefühl ein, dass damals in vielen Hinterköpfen die Nazis noch dreißig, vierzig Jahre nach Nachkriegsende über ihre Opfer triumphierten – zu Unrecht nicht nur in einem moralischen, sondern auch im historischen Sinne.
Denn viel mehr als mit dem Wahn von gestern, hatte damals und hat bis heute das Leben in der Bundesrepublik mit dem fortgeschrittenen Alltag in den freien Ländern zu tun, den die Emigranten als erste Deutsche erlebten und künstlerisch darstellten. Viel lehrreicher als die Intrigen im Führerbunker oder die unappetitlichen Details aus dem Privatleben der Herrenrassisten und ihrer bedauernswerten Familien sind für uns die Erfahrungen, die ein Teil ihrer Opfer im Exil machten. Ihre Flucht in die westlichen Demokratien, in die entwickelte amerikanische Industriegesellschaft war auch eine Reise in die politische und soziale Zukunft, in der wir heute leben.
Auf den Spuren dieses »Anderen Deutschland« bin ich vor einem Vierteljahrhundert, Mitte der achtziger Jahre, begleitet von Gero Gandert, damals Kustos der Deutschen Kinemathek in Berlin, und dem Fotografen Michael Montfort, nach New York und Hollywood gereist. Hier zumeist, und nicht in unserer Nachkriegs-Republik, konnte man sie noch treffen, die Akteure des Nicht-Mitmachens, die Helden des aufrechten Weg-Gangs nach dem totalen Sieg einer verbrecherischen Politik.
- Teil I -
Der unbekannte Emigrant: Paul Falkenberg
Mit achtundzwanzig Jahren ist Paul Falkenberg ein typischer Intellektueller der Weimarer Republik: klassisch gebildet, modern eingestellt, politisch aber eher desinteressiert. Eine steile Karriere als Filmcutter scheint ihm vorgezeichnet – bis er eines Tages eine fatale Begegnung hat ...
An einem sonnigen Vormittag im August des Jahres 1931 unternimmt der achtundzwanzigjährige Paul Viktor Falkenberg einen Spaziergang durch die Berliner Innenstadt, der sein Leben für immer verändern wird.
Auf dem Kurfürstendamm herrscht das alltägliche geschäftige Treiben, die Straßencafés sind gut besetzt. Die Welt scheint in Ordnung. Wenig im gutbürgerlichen Straßenbild deutet daraufhin, dass es ein Leben am Rande des Abgrunds ist, eine Zeit der wirtschaftlichen Not, in der jedes zweite Gewerkschaftsmitglied stempeln geht und die Nationalsozialisten zur stärksten Partei aufrücken.
Wie die meisten, die hier auf dem Ku’damm promenieren, weiß Paul Falkenberg von den großen politischen Auseinandersetzungen, die der ersten deutschen Demokratie den Garaus zu machen drohen, nur aus der Zeitung. Wahlveranstaltungen besucht der Sohn eines liberalen Lehrerehepaares nicht, erst recht keine der Nazis. Den Völkischen Beobachter oder den Angriff in die Hand zu nehmen, käme ihm nie in den Sinn.
Der junge Mann, Verfasser einer Dissertation über Gottfried Keller und einer der ersten deutschen »Tonfilm-Schnittmeister«, lebt in einer anderen, unpolitischen Welt. Er führt die Existenz eines typischen Intellektuellen der Weimarer Republik. Sein Berlin ist die Kulturhauptstadt Europas, tonangebend in Literatur, Theater und Film, eine Metropole der Technik und der lockeren Sitten, grell und schrill und hektisch, volkstümlich und versnobt, lokalpatriotisch und kosmopolitisch – eine Weltstadt, in der man, wie Elias Canetti sich erinnert, »keine zehn Schritte ging, ohne jemand zu begegnen, der berühmt war«.
Draußen in den Vorstädten aber herrscht bereits die Gewalt. Nazis und Kommunisten liefern sich Saalschlachten, SA-Trupps überfallen wehrlose Passanten, weil sie »jüdisch aussehen«, jeden Tag gibt es irgendwo im Reich Schwerverletzte und Tote. Der uniformierte Mob schickt sich an, die Republik zu zerstören.
Den Sündenbock für die soziale Misere haben die völkischen Horden längst ausgeguckt: die »jüdische Weltverschwörung«. Was oder wer das sein soll, weiß keiner so recht. Doch das hindert ja nicht, den nächstbesten zu verprügeln, der daran beteiligt sein könnte, einen von 500 000 unter den 65 Millionen deutschen Bürgern, den Gemüsehändler an der Ecke mit dem dunklen Teint oder den Arzt mit dem jüdischen Namen zwei Straßen weiter.
Falkenberg findet die hasserfüllten Parolen der Nazis eher komisch, ihre rassistischen Ideen verschroben, ihr martialisches Gehabe lächerlich. »Worin ich mich ungemein getäuscht habe«, wie er an diesem Morgen auf dem Ku’damm am eigenen Leibe erfahren muss.
Plötzlich umringen ihn fünf Braunhemden. Sie haben den Spaziergänger als Juden erkannt. Der Nazi-Trupp ist mit Schlagstöcken aus dickem Malakka-Rohr bewaffnet.
»Warum haust du nicht ab nach Jerusalem«, schreit der uniformierte Anführer, ein bulliger Typ aus dem Bilderbuch der Brutalität. Seine Fahne, riecht Falkenberg sofort, hat weniger mit Politik als mit Alkohol zu tun.
Die Nazis, etwas jünger als ihr Opfer, beginnen auf Falkenberg einzuprügeln. Seine Hilferufe kümmern keinen der vielen Passanten. Ein Hieb trifft Falkenbergs Hut, er rollt auf die Straße, automatisch läuft Falkenberg hinterher.
»Das war mein Glück«, meint er später, »denn die Brüder blieben damals noch vom Damm fern, die trauten sich nicht vom Schatten der Bäume und Hauseingänge weg.«
Im selben Augenblick hält ein Taxi neben ihm. Der Fahrer öffnet den Schlag.
»Ick kenn dat schon. Wenn ick hier Jeschrei höre: Polizei, Polizei, dann weeß ick, dass wieder so 'n Ding läuft, und ick krieg' gleich 'ne Fuhre.«
Noch am selben Tag beschließt Paul Falkenberg, Deutschland zu verlassen. Der junge Filmcutter ist seit seiner Mitarbeit an Fritz Langs M - Eine Stadt sucht einen Mörder und Carl Dreyers Vampyr ein gefragter Mann. Anfang 1932 bietet sich ihm eine Gelegenheit, in Paris zu arbeiten. Die Berliner Wohnung behalten Falkenberg und seine Frau bei – bis Hitlers Machtübernahme alle Hoffnungen auf eine Rückkehr zunichte macht.
Wenn zwölf Jahre später die Alliierten die deutsche Hauptstadt befreien werden, lebt dort keiner von Falkenbergs engsten Verwandten mehr. Er selbst kann es erst dreißig Jahre, nachdem er Berlin verlassen hat, über sich bringen, die Stadt seiner Geburt zu besuchen. Wohnen wird er nie wieder in Deutschland.
Die Tür der Wohnung in den New Yorker »Central Park Studios«, einem Altbau mit hohen Räumen in der 76. Straße West, öffnet ein kleiner gebückter Mann. Er steckt in einem viel zu weiten weißen Tropenanzug mit schmalen blauen Streifen. Dem schmächtigen Körper sieht man an, dass er das Kleidungsstück vor einer Weile noch auszufüllen vermochte. Aus dem jungen Hitler-Flüchtling ist, als ich ihn treffe, ein körperlich schwacher, aber geistig hellwacher Greis geworden.
Nicht ohne Misstrauen und mit einigem Widerwillen, das lässt er den Besucher aus Deutschland fühlen, führt Paul Falkenberg mich in den living room. Sich umzuschauen, bleibt keine Zeit. Der Gastgeber diktiert den Ablauf des Gesprächs.
»In meinem Leben ist nicht viel passiert«, sagt er mit einem keineswegs freundlichen Blick. »Ich habe nicht viel mitgemacht, gerade mal zwei Weltkriege, eine Revolution, eine Inflation, zwei Emigrationen, das ist alles.«
»Den Schritt in die Emigration haben Sie ein gutes Jahr vor den meisten Ihrer Leidensgenossen vollzogen«, frage ich, »war das nicht, gemessen an dem, was man damals wissen konnte, eine sehr heftige Reaktion auf ein isoliertes Ereignis?«
»Vielleicht habe ich es deshalb so stark empfunden«, sagt Falkenberg und schaut noch um einiges böser, »weil ich an so was nicht gewöhnt, nicht abgestumpft war. Die meisten haben damals in Deutschland derlei in der Schule oder sonst wo erlebt, und ich wusste, dass es das gibt. Aber persönlich habe ich nie zuvor, und übrigens auch nie danach, eine solche Erfahrung machen müssen.«
Falkenberg beugt sich vor und stützt sich dabei auf die geschnitzte Armlehne seines Stuhls. Spöttisch lächelnd erzählt er von den ersten Jahren seines Exils.
Die Nazis, das erkennt er bald, sitzen fest im Sattel, der Rückhalt in der Bevölkerung ist überwältigend. Wer nicht zu der Mehrheit gehört, die das barbarische Treiben billigt, schließt vor der alltäglichen Gewalt, vor politischem Mord und der systematischen Verfolgung der jüdischen Bürger, die Augen. Keinerlei Hoffnung besteht für die Flüchtlinge, in absehbarer Zeit zurückkehren zu können.
In den europäischen Exil-Ländern aber wird die Lage zunehmend prekärer. Das Dritte Reich weitet seinen Machtbereich konsequent aus. In immer mehr Staaten gelangen faschistische oder rechtsdiktatorische Regierungen an die Macht, und auch die wenigen verbleibenden Demokratien verschärfen aus Furcht vor Hitler-Deutschland die Restriktionen gegenüber den Emigranten. Als letzte Hoffnung erscheint am Horizont Amerika.
1938 treffen die Falkenbergs im Hafen von San Pedro an der amerikanischen Westküste ein. Drei Jahre verbringt das Paar in Hollywood, ohne dass Paul Falkenberg Arbeit findet. Kurz vor Pearl Harbour nimmt er schließlich ein Angebot aus New York an. Wenig später ist er Assistent des spanischen Filmregisseurs Luis Buñuel, ebenfalls ein Europa-Emigrant, der am Museum of Modern Art Unterschlupf gefunden hat.
Anders als im ewig sonnigen Kalifornien fühlt sich Falkenberg an der Ostküste sofort heimisch. Der Alltag verläuft in New York, der ersten Station so vieler Einwanderergenerationen, »europanäher«. Hier existieren die urbanen Treffpunkte, die die Ex-Berliner im zersiedelten Los Angeles so sehr vermissen. Und es gibt die Kneipen und Restaurants von Yorkville, mit Leberknödeln und Hackbraten, Wiener Schnitzeln und Königsberger Klopsen.
»War das etwas, was Sie vermisst haben?
»Ja, selbstverständlich. Man hat sich gefreut, die deutsche Küche wiederzufinden.«
»Haben Sie Lust, zum Lunch dorthin zu fahren?« schlage ich vor.
»Ja, warum nicht«, sagt Falkenberg und scheint durchaus erfreut.
In Yorkville, dem traditionellen deutschen Viertel, fanden einst die Freiheitskämpfer der 1848er Revolution Aufnahme, auf die Hitler-Flüchtlinge jedoch wartet eine gespenstische Szenerie: Hakenkreuze hängen in den Schaufenstern der Läden, und uniformierte SA-Leute, amerikanische Staatsbürger deutscher Abstammung, patrouillieren auf den Bürgersteigen. In den Kinos laufen die Filme von Goebbels’ Ufa im Original. Es gibt deutsche Theater und Bierkeller, in denen lederbehoste Buan Schuhplattler tanzen, und es gibt auch Partei-Krawalle und Antisemitismus. Die alten Yorkviller halten aggressiven Abstand zur neuen Welle der überwiegend jüdischen Emigranten, die sich in Washington Heights niederlassen, dem »Vierten Reich«, wie die Emigranten selbst frotzeln.
Doch Ende 1941, als Falkenberg nach New York kommt, ändert sich die Situation. Der Kriegseintritt der USA lässt die alteingesessenen Yorkviller eine radikale patriotische Wendung vollziehen: hin zu dem Land, dessen Staatsbürgerschaft sie besitzen.
»Waren Sie damals schon Amerikaner?«, frage ich, während das Taxi sich Meter für Meter durch den Mittagsverkehr vorwärts schiebt, von der 76. Straße West durch den Central Park zur 86. Straße Ost.
Falkenberg schüttelt den Kopf. »Nein, das wurde ich erst 1944.«
»Bekamen sie als Noch-Deutscher während des Krieges Probleme? »
»Nicht wirklich. Zwar musste ich als angeblich feindlicher Ausländer es der Polizei melden, wenn ich verreisen wollte. Wollte ich aber nicht.«
»Und im Alltag, wenn man Sie an Ihrem Akzent als Deutscher erkannte?«
»Ach, im Grunde spricht in New York kein Mensch richtig Englisch. Es ist eine Stadt für Einwanderer, und man hatte auch während des Krieges keinerlei Schwierigkeiten mit irgendeinem Akzent.«
Das Taxi hält an einer belebten Geschäftsstraße. Fast ein wenig versteckt hängen hier mitten in New York ein paar deutschsprachige Reklameschilder. Sie werben für ein »Wurst Haus«, ein »Bremen House« oder für die »Kleine Konditorei«, den berühmten Emigrantentreff, der in zahllosen Memoiren und Exil-Romanen erwähnt wird. Von dem alten Yorkville scheint nicht mehr viel übrig. Die germanische Enklave verliert ständig an Boden. Ihre Kundschaft stirbt schlicht aus.
Falkenberg sieht sich kurz um.
»Ich war schon lange nicht mehr hier.«
Das Lokal, das wir nach einigem Zögern betreten, bietet eine Mischung aus vergilbtem Dreißiger-Jahre-Look und Altentagesstätte. Gemütliche Tristesse, triste Gemütlichkeit. Die Speisekarte ist zweisprachig und offeriert ausschließlich »Hausmannskost«.
Mitten in Manhattan, in Sichtweite der Skyscraper, wirkt die urdeutsche Umgebung geradezu unheimlich unzeitig, gespenstisch alt. Wie sonst nur in der DDR ist hier das Vorkriegsreich konserviert. Es ist, als stiegen wir in die Verliese einer Vergangenheit, deren Reize und Schrecken ich nur aus den Erzählungen meiner Eltern und Großeltern kenne.
»Was war das für ein Gefühl, wenn Sie in den Nachrichten gehört haben, Berlin, Ihre Geburtsstadt, die Stadt Ihrer Jugend, wird angegriffen, zerbombt?«
»Wissen Sie, man war emotional so involviert, dass man ....« Zum ersten Mal fehlen Falkenberg für Sekunden die Worte. »Also«, sagt er mit einem Ruck, »man hatte einfach keine rationalen Attitüden mehr. Es war so, dass man am liebsten... Jeder hätte gern ein Maschinengewehr genommen und wär' durch deutsche Straßen und hätte ein paar Leute niedergeknallt. Wir wussten eben doch ...«
Die Kellnerin kommt, gewandet in eine Mischung aus Dirndl und Krankenschwesterntracht, und nimmt die Bestellungen auf. Falkenberg scheint froh über die Unterbrechung.
»Mein Schwager wurde im KZ Oranienburg ermordet«, fährt er dann fort, wie um die Wut zu erklären, die nach so langer Zeit eben wieder in ihm aufgestiegen ist, »und meine Mutter haben sie 1942 nach Theresienstadt verschleppt. Mein Vater war ja schon tot.«
Fast sagt er es erleichtert. Sein leerer Blick sieht mich nicht, und doch spüre ich ihn wie ein Gewicht auf meinem Körper.
»Meine Mutter«, sagt er schließlich, »konnte dann 1944 freigekauft werden – 1000 Dollar pro Jude.«
Es klingt bitter, fast verzweifelt. Die Schmach dieses Menschenhandels ist unvergessen.
»Wiedergesehen habe ich sie nie«, sagt Paul Falkenberg. »Sie hatte schon das Billett. Aber in der Nacht vor der Abreise traf sie der Schlag.«
Das soßenschwere Essen wird serviert. Aus dem halbdunklen Innenraum des Restaurants heraus wirken die Häuserfronten und der Verkehr draußen vor den Fensterscheiben wie Kulissen in einer amerikanischen TV-Serie. Die Wagen rollen lautlos, als sei der Ton ausgefallen. Deutschland ist unendlich weit weg, das macht das Sprechen leichter. Diese Entfernung, die wohltuende Distanz, war es wohl auch, die so viele Emigranten nach dem Krieg, nach dem Ende von Terror, KZs und Massenmord, in den USA bleiben ließ.
»Da kann ich Ihnen noch eine dieser traurigen Exil-Geschichten erzählen«, beginnt Paul Falkenberg, nachdem er eine Weile schweigend gegessen hat. »Als die Nachricht vom Tode meiner Mutter kam, war gerade Lotte Andor bei uns, auch eine Emigrantin, und Lotte brach in Tränen aus. Ich sage: Lotte, was weinst du? Du hast meine Mutter doch gar nicht gekannt? Da sagt sie: Wieso ich weine? Weil du weißt, wo deine Mutter begraben ist, und ich weiß es von meiner nicht.«
Mein Blick fällt auf eine dürre alte Frau, die vollkommen regungslos an einem der Tische im hinteren Teil des Lokals sitzt und unentwegt zu uns herüberschaut, als könne sie das Gespräch verstehen. Unwillkürlich senke ich meine Stimme.
»Haben Sie ...«
»Die Briefe«, spricht Falkenberg gedankenverloren vor sich hin, »die mir meine Eltern in der Nazizeit geschrieben haben, liegen in der Germania Judaica in Köln. Ich habe sie denen gegeben, weil ich nicht in der Lage bin, sie noch einmal zu lesen. Ich kann es einfach nicht, es ist ...«
Er hält inne und folgt meinen Augen. So sehen wir beide auf die dürre alte Frau, die in diesem Augenblick wie ein nasser, wenn auch sehr leerer Sack vom Stuhl rutscht. Fast geräuschlos schlägt sie auf dem Boden auf und bleibt regungslos liegen. Zwei Kellnerinnen gehen ruhig auf sie zu, heben sie an den Armen hoch und schleifen sie durch die Tischreihen zum Ausgang.
Als die Bedienung vorbeikommt, fragen wir, was passiert sei.
»Te Lady«, erklärt die Kellnerin mit einer kühlen Stimme, die sich seltsam zu ihrem schweren süddeutschen Tonfall ausnimmt, »hat too much Cocktails getrunken.«
Da taucht sie wieder auf aus den Schrecken der europäischen Vergangenheit, die ganz rauhe, aber ganz normale amerikanische Gegenwart: »Mind your own business!« Jeder kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten, und die bestehen bei den anderen Gästen im wesentlichen darin, möglichst viel Essen möglichst schnell zu verschlingen. Und vor allem: Keine Probleme, Mann!
Falkenberg grinst. »Darf ich Ihnen sonst noch etwas Unangenehmes erzählen?«
»Ja«, sage ich. »Haben Sie nach dem Krieg einmal überlegt, zurückzukehren nach Deutschland?«
»Nein, keinen Augenblick.«
Falkenberg schaut empört, und ich erinnere mich, ein wenig beschämt über die Selbstverständlichkeit meiner Frage, an die leichenstarrenden KZ-Filme, an die hohe Kunst der Verdrängung, die mein vernaziter Klassenlehrer in den sechziger Jahren »Vergangenheitsbewältigung« nannte und ebenso scheinheilig wie ungern in zwei, drei Schulstunden durchexerzierte.
»Man diskutierte natürlich, ob man zurückgehen sollte. Einige hatten ja auch seltsame Schwierigkeiten hier«, sagt Falkenberg und grinst wieder. »Sehen Sie, das letzte Mal, als ich Günther Anders traf, musste ich mit ihm zum FBI wegen seiner Einbürgerung. Ich sollte über ihn Auskunft geben, also erzählte ich: Zuletzt hat Mr. Anders geschrieben über Kafka als Warner. Da fragten die mich: ›So, so, wer ist ein Warner, wer ist dieser Kafka?‹ Und da waren all die langen Gänge und vielen Büros in dem Gebäude, und ich dachte: ›Das ist Kafka.‹ Aber wie sollte man nun dem FBI erklären, wer Kafka war und wovor er gewarnt hat?«
Noch heute kann man Falkenberg die diebische Freude an seinem damaligen Auftritt ansehen.
»Na, und so ging der Anders dann eben zurück« fährt er fort, »aber für mich, für die meisten kam das alles nicht in Frage.«
Wenn ein anderes Land als die USA zur Debatte gestanden hätte, dann Israel. Mehrere Male arbeitet Falkenberg, der sich nach Kriegsende als Produzent von Dokumentarfilmen selbständig macht, im Auftrag der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen im neuen jüdischen Staat.
»Wann haben Sie zum ersten Mal wieder Deutschland besucht?«
»1954 war ich in Köln, aus Israel kommend. Meine Frau wollte ihre Schwägerin in Berlin besuchen, ihr Bruder wurde ja im KZ ermordet.«
Paul Falkenberg schaut mich an. Es ist keine Gedächtnisschwäche. Sein Kopf funktioniert hervorragend. Er weiß, dass er den Mord an seinem Schwager zum zweiten Mal erwähnt. Er gedenkt nicht, mir – und sich – das zu ersparen.
»Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich kann es nicht«, erzählt er weiter, »ich kann mich nicht dazu überwinden, nach Berlin zu gehen. Sie ist dann hin, und wir trafen uns in Paris wieder und fielen uns in die Arme und sagten: ›Gott sei dank, dass wir nicht in Deutschland sind.‹ Aber das war nicht mehr ein Gefühl des sinnlosen Hasses, das war Fremdheit.«
Die grellen Reklamen, die Menschen aller Hautfarben, die englischen Laute, die durch die offenen Seitenfenster hereindringen, alles wirkt nach der Zeitreise ins grauenerregende deutsche Vorkriegs-Reich wohltuend exotisch. Wir fahren im Taxi von Yorkville zurück zu den »Central Park Studios«.
»Später besuchten Sie dann Berlin?« frage ich.
Falkenberg schaut weg, hinaus in die Jogger-Sommer-Eiscreme-Szenerie des Central Park. Nach einer Weile antwortet er.
»Ja, zuerst 1961.«
»Wie hatte sich das Leben verändert, seit Sie die Stadt zum letzten Mal gesehen hatten?«
»Über die frühen sechziger Jahre will ich nichts sagen.« Er hält inne, und man sieht ihm an, dass ihm die konservative Wohlstandsrepublik, in der die Leute mit dem guten Gewissen und schlechten Gedächtnis das Sagen hatten, nicht geheuer war. »Später traf ich dann eine völlig neue Generation von Leuten.«
Einen Augenblick mustert er mich fast wohlwollend.
»Junge Leute wie Sie. Aber es ist trotzdem schwer zu vergessen.« Und schon verdüstert sich sein Blick wieder. »Einmal war ich auf einer Party von Freunden, da waren Maler, Schauspieler, Architekten. Es war eine angenehme, gelöste Atmosphäre, und ich dachte plötzlich: ›Mein Gott, ist das jetzt 1977? Oder ist das 1931?‹ Alles war wie gehabt, genau wie gehabt.«
Falkenberg wischt sich über die Augen, als könne er ihnen nicht trauen.
»Und ich hatte diese gespenstische Vorstellung: Was wird geschehen, wenn wieder ein Hitler kommt, und die Leute wissen nicht, was sie tun sollen, weil ihnen das Brot weggenommen wird, wenn sie nicht zu Kreuze kriechen?« Der alte Mann lacht unruhig. »Von solchen Gedanken wird man nie wieder ganz frei.«
Falkenberg schaut mich an. Ich weiß nicht, was er von mir erwartet. Dass ich die unerschütterliche Festigkeit unsere Demokratie rühme, versichere, dass wir, die Nachkriegsgenerationen nie ...?
Taktvoll entbindet er mich von einer optimistischen Antwort, indem er nach einer kurzen Pause weiter spricht.
»Naja,« sagt er, »was soll's. Aussterben kann ich inzwischen alleine, da brauch' ich keine Hilfe mehr.«
Er lacht, und es klingt noch unruhiger. Das Taxi hält. Falkenberg drückt den Türgriff herunter, wendet sich aber wieder um.
»Eins will ich Ihnen noch erzählen. Als ich mal einen meiner Dokumentar-Filme in Princeton vorführte, kam hinterher Einstein auf mich zu: ›Vielen Dank für den schönen Film.‹«
Falkenberg schaut wieder sehr böse, und ich bekomme den Verdacht, dass all diese bösen Blicken viel Liebe verbergen sollen und das Unglück bannen, das die geliebten Dinge und Menschen so oft getroffen hat.
»Und so sage ich immer«. fährt Falkenberg fort: »Oscar? Nein, ist nicht drin. Aber Einstein mochte einen Film von mir. Wieviel mehr Ruhm soll man sich wünschen?«
Er schaut mich an, ein langer letzter Blick, dem die Frage anzusehen ist: Was hat er wohl verstanden von dem, was mir wichtig war?
»Ja«, sagt Paul Falkenberg beim Aussteigen, »jetzt haben Sie alles gehört von einem, der seit fünfzig Jahren unbezahlter Statist ist auf der Bühne der Weltgeschichte.«
Er schüttelt seinem Besucher fest die Hand und geht, auf seinen Stock gestützt, die Stufen hinauf zur Haustür. Der Anzug schlottert dabei um einen winzig gewordenen Leib, der seine letzten Kraftreserven zu mobilisieren scheint.
Die Haltung des alten Mannes ist gebeugt, aber sein Wille unbeugsam – unversöhnt der Geschichte und denen gegenüber, die ihm und Millionen seiner jüdischen Leidensgenossen nach dem Leben trachteten, die verfolgten, erniedrigten, folterten, mordeten.
In der Tür dreht er sich um und hebt die Hand zum Abschied. So bleibt er, während das Taxi davonfährt, bewegunglos stehen. Als habe er, der große Schnittmeister, seinen Film angehalten, um darüber die Schlusstitel zu legen.
Wenige Wochen später ist Paul Victor Falkenberg, geboren im Norden Berlins, vertrieben aus dem Land seiner Eltern, 41 Jahre deutscher und fast 42 Jahre amerikanischer Staatsbürger, gestorben und in seiner New Yorker Heimat beerdigt worden.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.