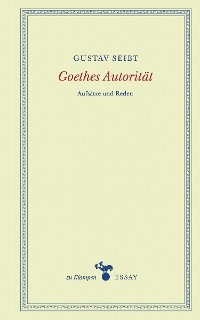Kitabı oku: «Goethes Autorität», sayfa 2
Am 15. August 1828, vier Wochen nach dem Brief an Friedrich August von Beulwitz und zwei Monate nach dem Tod von Carl August, notierte Goethe zum letzten Mal in seinem Taschenkalender unter Mariae Himmelfahrt: »Napoleons Geburtstag«.
Sein Kaiser
Goethe im Empire
Der gefährlichste Moment in Goethes Leben war die Nacht nach der Schlacht von Jena und Auerstedt. Vierzigtausend siegreiche französische Soldaten fielen über die kaum siebentausend Einwohner zählende Residenzstadt des feindlichen, mit dem besiegten Preußen verbündeten Herzogtums Weimar her. Die Krieger waren erschöpft, erregt und hungrig; also wurde geplündert, geraubt, verwüstet und in einzelnen Fällen auch vergewaltigt. Fünf Häuser beim Schloss gingen in Flammen auf, bald stand eine kerzengerade Rauchsäule im klaren Oktoberhimmel über der Stadt. Nur der Umstand, dass die vollkommene Windstille eines kalten Herbsttages herrschte, verhinderte eine große Brandkatastrophe. Auf den Straßen lag haufenweise Schießpulver, das die nach Erfurt flüchtenden Preußen zurückgelassen hatten. Ein Funke hätte verheerende Explosionen verursachen können.
Während Christoph Martin Wieland sofort eine französische Schildwache erhielt, war das Haus Johann Wolfgang von Goethes am Frauenplan in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober 1806 schutzlos. Man wartete auf den Marschall Ney, der bei dem Weimarer Minister einquartiert war, doch einstweilen klopften nur marodierende Soldaten ans Tor, die in den unteren Räumen im vorderen Teil des Hauses untergebracht wurden. Spät nachts aber drangen noch zwei aggressive, mutmaßlich betrunkene Tirailleurs bis in die hinteren Zimmer vor, in die Goethe und die Seinen sich zurückgezogen hatten. Was genau geschah, ist unbekannt, der Dichter hat darüber eisern geschwiegen. Durch Standhaftigkeit und Glück sei man gerettet worden, heißt es unbestimmt im Tagebuch. Christiane scheint die entscheidende Rolle gespielt zu haben; mit Hilfe eines Weimarer Nachbarn gelang es ihr, so erzählte man sich, die Eindringlinge von Goethes Schlafzimmer abzuhalten. Sie warfen sich daraufhin in das für Ney bestimmte Bett, aus dem der Marschall sie am nächsten Morgen mit flacher Klinge verjagte.
Den Tod und den möglichen Verlust aller Manuskripte und Arbeitspapiere, das hatten diese Stunden vor Goethes Auge gestellt. Die Frau seines späteren Schwagers Vulpius war vergewaltigt worden; sein Freund, der Zeichner Kraus, hatte alle seine in Jahrzehnten geschaffenen Werke verloren und starb wenig später an gebrochenem Herzen; Charlotte von Steins Haus war kahlgeplündert. Näher ist Goethe einer Katastrophe, ja dem totalen Ruin nie gekommen. Den napoleonischen Krieg, der nicht mit Vorratsmagazinen und Nachschublinien geführt wurde, sondern sich vom eroberten Land ernährte, hat er ein Jahr später in einem Marschlied der »Pandora« lakonisch in Worte gefasst. Dort singen die Krieger:
So geht es kühn
Zur Welt hinein,
Was wir beziehn,
Wird unser sein.
Will einer das,
Verwehren wir’s
Hat einer was,
Verzehren wir’s.
Hat einer g’nug
Und will noch mehr;
Der wilde Zug
Macht alles leer.
Da sackt man auf!
Und brennt das Haus,
Da packt man auf
Und rennt hinaus.
Die nächste politische Folge des Krieges war die Existenzbedrohung des Staates, mit dem Goethe seit dreißig Jahren zusammengewachsen war. »Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach wären wir einstweilen gewesen«, soll Carl August, im preußischen Havelland auf einer Trommel sitzend, gesagt haben. Die Verbündeten des besiegten Preußen schonte Napoleon sonst nicht. Braunschweig, das Herzogtum des wichtigsten preußischen Heerführers, verschwand von der Landkarte; warum hätte das Land des preußischen Generals Carl August bleiben sollen? Am Nachmittag des 15. Oktober kam Napoleon nach Weimar. Die Herzogin Luise erwartete ihn als einzige anwesende Hoheitsträgerin an der Schlosstreppe, umgeben von Hofleuten und Ministern. »Ich beklage Sie, Madame«, rief ihr der vorübereilende Kaiser zu, »ich werde Ihren Mann absetzen – J’écraserai vôtre mari.«
Während zwei langer Monate schwebte diese Drohung über dem kleinen Staat. Erst der Frieden von Posen vom 15. Dezember, mit dem Weimar dem Rheinbund beitrat, machte ihr ein Ende. Zwar musste das Land furchtbar bluten – 2,2 Millionen Franken, ein ganzes Jahresbudget, betrug die Kontribution –, aber Napoleon hatte es nicht gewagt, das Herzogtum, dessen Erbprinz mit der Schwester des Zaren verheiratet war, aufzuheben. Wäre dies geschehen, dann hätte Goethe erst einmal sein Lebensumfeld verloren: sein Jahresgehalt von 1900 Talern, den Zugriff auf die für seine Arbeit unentbehrlichen Bibliotheken und akademischen Institutionen, möglicherweise sein Haus am Frauenplan.
Auf die doppelte Existenzbedrohung, die physische und die materielle, reagierte Goethe blitzschnell und mit ungewohnter Entschiedenheit. Fünf Tage nach der Plünderungsnacht heiratete er, ohne seinen Landesherrn zu fragen, seine nicht ganz standesgemäße Lebensgefährtin Christiane Vulpius, die Mutter seines fünfzehnjährigen Sohnes. Im Trauring war nicht das Datum der Hochzeit, sondern der Tag der Schlacht von Jena eingraviert: 14. Oktober 1806. Goethe trug das Datum der schlimmsten preußischen Niederlage bis an sein Lebensende am Finger. Und er sorgte dafür, dass ihm das Eigentum an seinem Haus definitiv bestätigt wurde. Bisher nämlich zahlte der Herzog die Steuern dafür und erhielt auch die durch ein Braurecht begründeten Einnahmen daraus. Das hätte bei einem Ende des Weimarer Staates zu Missverständnissen Anlass geben können. Nun wurde Goethe regelrechter, steuerzahlender Eigentümer seines Hauses, und damit war auch für den Erbfall vorgesorgt. So tat Goethe in den Tagen und Wochen nach Jena für sich das, was damals in ganz Deutschland begann: Er verwandelte ständische Familien- und Besitzformen in bürgerliche. Goethes ganz persönliche napoleonische Modernisierung war im Januar 1807 abgeschlossen.
Es spricht einiges dafür, dass Goethe den Kaiser der Franzosen zum ersten Mal an jenem 15. Oktober 1806 gesehen hat, als dieser seine Drohungen gegen die Herzogin ausstieß. Goethe war in all diesen Tagen am Hof; warum soll er nicht mit den anderen Kavalieren und Beamten hinter seiner Landesherrin gestanden haben, als diese den Eroberer empfing? Das Tagebuch schließt dies nicht aus; denn Goethe erwähnt im Tagebuch auch sonst keine bloßen Sichtkontakte mit dem Kaiser, wie sich bei anderen Gelegenheiten nachweisen lässt. Sicher ist, dass er am folgenden Tag zu einer Audienz beim Kaiser, dem er als Vertreter des literarischen Weimars hätte aufwarten sollen, nicht erschien. Er meldete sich in letzter Minute krank, auf einem mit Bleistift beschriebenen Stück Papier: »In dem schrecklichen Augenblick ergreift mich mein altes Übel. Entschuldigen Sie mein Außenbleiben. Ich weiß kaum, ob ich das Billet fortbringe.« Der Empfänger, Kollege Geheimrat Voigt, wusste, was mit »Übel« gemeint war: Goethes schmerzhaftes Nierenleiden. Aber auch sonst konnte ein Zusammentreffen mit dem offenkundig erbosten Sieger für Goethe nichts Verlockendes haben. Sein empfindliches Ehrgefühl musste schon die zu erwartende Abkanzelung scheuen. So vergingen noch zwei Jahre, bevor Goethe wieder Gelegenheit bekam, dem Erschütterer seiner Existenz unter die Augen zu treten.
Was wusste Goethe über Napoleon, als die französische Kriegsfurie nach Weimar kam? So viel, wie man als aufmerksamer deutscher Zeitgenosse nur wissen konnte; vor allem nichts Gutes. Die 1804 anonym erschienene Schrift »Napoleon Bonaparte und das französische Volk unter seinem Consulate«– heute als »Anti-Napoleon« bekannt1 – hat er selbst rezensiert. Und die »Fragmente aus der neusten Geschichte des Politischen Gleichgewichts in Europa« hatte ihm ihr Verfasser Friedrich von Gentz druckfrisch zugeschickt; Goethe erwähnt sie noch in den späten »Tag- und Jahresheften« für 1806. Freilich, eine Rezension des brisanten antinapoleonischen Traktats in der »Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung« hat der umsichtige, die Weltlage präzise einschätzende Kulturpolitiker Goethe schon nicht mehr zugelassen.
Beide Schriften – Gentz hat Schlabrendorf benutzt – boten nicht Charakterbilder, sondern Analysen des politischen Systems. Während Schlabrendorf die totalitären Züge im Inneren herausstrich – reglementierte Erziehung, Militarisierung des Alltags, gelenkte Presse und Personenkult, Spitzelwesen und Sicherheitswahn –, stellte Gentz das Kaiserreich als Gefahrenherd für das europäische Mächtesystem dar. Denn revolutionärer Radikalismus und militärischer Erfolgsdruck machten Napoleons Regime strukturell friedensunfähig. Der Regent Frankreichs sei durch Waffenruhm an die Macht gekommen; also muss er weitersiegen: »So lange er entschlossen ist zu herrschen, bleibt die Aufrechterhaltung seines militärischen Ruhmes seiner Sorgen erste und letzte. So enge, so vielfältig ist keine andere Regierung in Europa mit dem Militärinteresse verbunden.« Solche Diagnosen waren noch nicht aus nationalistischen Emotionen gespeist, sondern stellten für die Gegenwart die alteuropäische Alternative von Gleichgewicht oder Hegemonie. Neu war der Befund, dass die inneren Verhältnisse der Staaten außenpolitische Relevanz besaßen. Das gab der Analyse von Gentz den apokalyptischen Ton: Wenn man Napoleon nicht bekämpfte, drohte ein Zeitalter europäischer Unfreiheit.
Trotz solcher Lektüren und trotz seiner eigenen Erfahrungen hat Goethe sich anders entschieden. Schon in den ersten Wochen des Jahres 1807 vollzog er das literarische Manöver, mit dem er der Öffentlichkeit seinen Friedensschluss mit der neuen rheinbündischen Ordnung kundtat. Er schlug sich auf die Seite des Historikers Johannes von Müller, indem er dessen Berliner Akademierede über »Friedrichs Ruhm« rezensierte und übersetzte. Der Schweizer Johannes von Müller, der berühmteste Historiker der Epoche, damals preußischer Hofhistoriograph und vor der Schlacht von Jena martialischer Anhänger der Berliner Kriegspartei, war Ende 1806 auf die Seite Napoleons getreten. Dieser hatte ihn in Berlin einer langen Audienz gewürdigt und in einen welthistorischen Diskurs verwickelt; Müller hatte sich daraufhin entschlossen, die neuen Verhältnisse als endgültig anzuerkennen. Die jährliche Ansprache zum Gedenken an Friedrich den Großen – eine heikle Aufgabe im besetzten Berlin – hielt Müller auf Französisch. Darin stellte er historische Größe als Gemeinbesitz der Völker dar, der ihnen dauernde Achtung sichere; und er appellierte an den lebenden großen Mann Napoleon, das Volk des toten großen Mannes Friedrich zu schonen.
Mit seiner Rede machte Müller sich bei den Patrioten unmöglich – nicht zuletzt bei Gentz, der ihm die Freundschaft aufkündigte –, und eine üble Hetze gegen seine Person begann. In dieser Lage sprach Goethe sein Machtwort: »Er hat in einer bedenklichen Lage trefflich gesprochen, so daß sein Wort dem Beglückten Ehrfurcht und Schonung, dem Bedrängten Trost und Hoffnung einflößen muß.« Darüber hinaus ermunterte Goethe Müller ausdrücklich, sich in der »Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung« politisch zu äußern. Dieser publizierte dort bald lange Besprechungen zur neuen rheinbündischen Gesetzgebung, in denen er empfahl, die Reformspielräume der neuen Ordnung zu nutzen. Schon ein halbes Jahr später war Müller leitender Minister im neuen napoleonischen Musterstaat Westphalen. Das Jenaische Literaturblatt blieb fortan so rheinbündisch wie sein Weimarer Oberaufseher. Schon vor der Erfurter Begegnung also hatte Goethe sich unmissverständlich – und ohne Absprache mit seinem Herzog – auf die Seite der neuen Ordnung geschlagen.
Dabei blieb es fortan. Goethes Sohn August studierte das neue französische Recht in Heidelberg; Goethes engster politischer Freund wurde Graf Reinhard, der Mitarbeiter Talleyrands und Napoleons Gesandter beim westphälischen Königshof in Kassel. 1807 begann Goethe sich, wie seine Lektüren zeigen, mit der Möglichkeit einer dauerhaften europäischen Universalmonarchie anzufreunden. Jedenfalls hielt er die Niederlage Preußens für ebenso endgültig wie den Untergang des Alten Reichs. So wurde die Suche nach einer neuen Rahmenordnung für den machtlosen Weimarer Kulturstaat unvermeidlich. Goethes rheinbündische Option hatte zunächst nichts mit persönlicher Faszination durch den Kaiser der Franzosen zu tun; darin unterschied er sich auch von Johannes von Müller, der durch ein Erweckungserlebnis gewonnen worden war.
Den deutschen Trotz und Franzosenhass hielt Goethe für Hypochondrie: »Wenn aber die Menschen über ein Ganzes jammern«, schrieb er am 27. Juli 1807 an Zelter, »das denn doch in Deutschland kein Mensch sein Lebtag gesehen, noch viel weniger sich darum bekümmert hat; so muß ich meine Ungeduld verbergen, um nicht unhöflich zu werden oder als Egoist zu erscheinen.« Im kleinen Kreis gefiel er sich in Zynismen. So sagte er zu Riemer (am 16. Mai 1807): »Die Franzosen hätten keine Imagination, sonst hätten sie statt der zwanzig Häuser in Jena und Weimar, wenn sie nicht zufällig abgebrannt, sondern von ihnen angezündet sind, die Stadt an allen Ecken angezündet und mit Stumpf und Stil abgebrannt. Das hätte dann anders in die Welt geklungen.« Aber natürlich beschäftigte ihn schon damals auch die Person des Kaisers. Wie früh eine Grundlinie seines Urteils gezogen war, verrät eine Aufzeichnung wiederum Riemers aus dem Februar 1807: »Außerordentliche Menschen, wie Napoleon, treten aus der Moralität heraus. Sie wirken zuletzt wie physische Ursachen, wie Feuer und Wasser.«
Hinter solchen teils tagespolitischen, teils allgemein typologisierenden Auslassungen stand auch eine kulturelle, ja geschichtstheoretische Reflexion zur Vaterlandsliebe. Schon vier Wochen nach Jena und Auerstedt, am 18. November 1806, erklärte Goethe gegenüber Riemer den Freiheitssinn und die Vaterlandsliebe, die man aus den Alten zu schöpfen meine, zur Fratze. Der antikisierende patriotische Republikanismus – die damalige Gestalt der Napoleonfeindschaft – werde in der Gegenwart zu einer ungeschickten Nachahmung, die im Widerspruch zum allgemeinen Gang der neuen Kultur stehe. »Wir leben auf der einen Seite viel freier, ungebundener und nicht so einseitig beschränkt als die Alten, auf der anderen ohne solche Ansprüche des Staates an uns. Der ganze Gang unserer Kultur, der christlichen Religion selbst führt uns zur Mitteilung, Gemeinmachung, Unterwürfigkeit und zu allen gesellschaftlichen Tugenden, wo man nachgibt, gefällig ist, selbst mit Aufopferung der Gefühle und Empfindungen, ja Rechte, die man im rohen Naturzustande haben kann.«
Den am Horizont auftauchenden Nationalismus hat Goethe als akademisches, pseudoantikes Neuheidentum begriffen, gespeist von zu viel Klassikerlektüre: »Sich den Obern zu widersetzen, einem Sieger störrig und widerspenstig zu begegnen, darum weil uns Griechisch und Latein im Leibe steckt, ist kindisch und abgeschmackt. Das ist Professorenstolz, der seinen Inhaber ebenso lächerlich macht, als er ihm schadet.« Der geistesgeschichtliche Moment, unmittelbar bevor Fichtes »Reden an die deutsche Nation« den aus Frankreich übernommenen Patriotismus ins Deutsch-Völkische umsteuern, ist in dieser Äußerung ebenso abzulesen wie der kulturtypologische Hintergrund von Goethes Option für Napoleon: Sie galt nicht dem neurömischen Diktator, der mit den Attributen und Attrappen der Republik hantierte, sondern eher dem Augustus, der als Erbe Karls des Großen auftrat.
Zum Erfurter Fürstenkongress im Oktober 1808, dieser großen Schaustellung des napoleonischen Empire, die Napoleon inszenierte, um den russischen Zaren zu gewinnen, hatte Goethe von sich aus gar nicht gehen wollen. Sein Herzog rief ihn, und Christiane drängte ihn, dem Ruf zu folgen. Goethe wurde zum außerplanmäßigen Protokollchef für den kurzfristig anberaumten Weimarer Tag des Fürstenkongresses ernannt. So hatte er für den reibungslosen Ablauf einer Aufführung von Voltaires Drama »Der Tod des Caesar« mit Talma als Brutus im Weimarer Hoftheater zu sorgen. Nicht zuletzt zur Vorbereitung darauf besuchte Goethe in Erfurt mehrfach das dort gastierende Théâtre français, das Abend für Abend die schwerblütig-pathetischen Tragödien des Grand Siècle spielte.
Diese Erfurter Abende stellten ein Ritual dar, das es Goethe erlaubte, den Kaiser der Franzosen über mehrere Stunden ganz aus der Nähe zu beobachten. Kein Historiker oder Germanist, auch Hans Blumenberg nicht, der so viel aus der ersten Blickbegegnung zwischen Goethe und Napoleon macht, hat das beachtet. Denn Goethes Tagebuch verzeichnet zwar die Stücke, die er gesehen hat – »Brittanicus«, »Mithridates« und »Zaire« –, aber nichts von den abendlichen Abläufen im Theater. Doch besitzen wir einen zeitgenössischen Bericht von Caroline Sartorius, der Frau des mit Goethe befreundeten Göttinger Historikers Georg Sartorius, die wie Goethe im Erfurter Kaisersaal saß. Alle anderen Zuschauer, einschließlich der Fürsten, haben ihre Plätze bereits eingenommen, als Trommelschlag die Ankunft der beiden Kaiser, Napoleons und des russischen Zaren, verkündet: »Alexander geht voran, Napoleon dicht hinter her und hatte als der Letztkommende den Rang. Dafür ließ er Alexander zur rechten sitzen. Es liegt wirklich etwas unheimliches darin mit Napoleon in demselben Raum eingesperrt zu sein. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, und Alexander ward schier vergessen. Beyde Kaiser waren äußerst einfach gekleidet: es schien als sollte der Glanz der sie umgab ihnen blos zur Folie dienen.« Zum Aussehen Napoleons sagte Caroline Sartorius: »Er hat einen besonders zierlichen Fuß und eine schöne Hand. Sonst scheint er mir nicht schön gebaut. Der Rumpf ist im Vergleich zum Untertheil, viel zu massiv, der Kopf steckt in den Schultern es ist kein rechtes Verhältnis im Ganzen. Einen Bauch hat er jedoch nicht. Die Haare sind schwarz, der Teint ganz italiänisch, die Form des Kopfes nicht ohne Grazie die Züge sind gerade nicht antic, lassen sich aber doch der Ähnlichkeit unbeschadet bis zur Antique erheben. Die Augen liegen sehr tief und Blick und Farbe sieht man garnicht … Sein Äußeres imponiert eben nicht, aber es ist Grazie und ein sehr ruhiger Anstand darin.«
Goethe hat ganz gewiss keinen schlechteren Beobachtungsposten als Frau Sartorius gehabt; ob auch er es unheimlich fand, mit Napoleon im selben Raum eingesperrt zu sein, wissen wir nicht. Doch fällt auf, dass er den Kaiser nie beschrieben hat; obwohl doch eigentlich jeder, der ihn sah, seine äußere Erscheinung erwähnte. Jedenfalls konnte er von ihr nicht mehr überrascht sein, als er vor Napoleon trat – anders als dieser, der mit einem anerkennenden »Vous êtes un homme« das Gespräch eröffnete. Die berühmte Unterredung am Vormittag des 2. Oktober 1808, die eine knappe Stunde dauerte, fand in einem nur 57 Quadratmeter – 8,9 auf 6,45 – großen Salon mit einer niedrigen, 3,20 Meter hohen Decke statt. Goethe und der Kaiser waren fast gleich groß – 169 beziehungsweise 168 Zentimeter; zunächst saß der Kaiser noch an seiner Frühstückstafel, danach erhob er sich und zog sich mit Goethe in einen kleinen Erker zurück.
Nur der erste Teil des Gesprächs wurde unter den Augen von mehreren Marschällen sowie des Reichskammerherrn Talleyrand geführt. Näher konnte man dem Kaiser kaum kommen als Goethe in dieser Stunde. Er erlebte ihn nicht nur im Zwiegespräch, sondern momentweise auch beim Regieren, denn die Staatsgeschäfte liefen weiter, während der deutsche Dichter seine Aufwartung machte. Marschall Daru kam mit deutschen Kontributionsangelegenheiten, dem leidvollen Hauptthema der französischen Okkupation; Berthier sprach von polnischen Aufständen. »Ich will gerne gestehen«, schrieb Goethe fünf Wochen danach an seinen Verleger Cotta, »daß mir in meinem Leben nichts Höheres oder Erfreulicheres begegnen konnte, als vor dem französischen Kaiser, und zwar auf eine solche Weise zu stehen. Ohne mich auf das Detail der Unterredung einzulassen, so kann ich sagen, daß mich noch niemals ein Höherer dergestalt aufgenommen, indem er mit besonderem Zutrauen, mich, wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf, gleichsam gelten ließ, und nicht undeutlich ausdrückte, daß ihm mein Wesen gemäß sei.« Und zu Riemer sagte er, Napoleon habe ihm »gleichsam das Tippelchen auf das I gesetzt«.
Solche Äußerungen und Goethes langes Zögern, überhaupt etwas darüber niederzulegen, haben Erwartungen erweckt, die Hans Blumenberg, diesen Spezialisten für Gipfeltreffen, behaupten ließen, der Inhalt der Unterredung sei »belanglos«, und solche Belanglosigkeit sei der wahre Grund für Goethes Geheimniskrämerei gewesen. Doch kann man so nur denken, wenn man ein Göttergespräch erwartet, das sich dann allerdings auf den Austausch erkennender und standhaltender Blicke beschränken kann. Und wirklich mag man finden, dass Napoleons Unterhaltungen mit Johannes von Müller und Wieland, die sich um Fragen der Weltgeschichte drehten, reichhaltiger waren. Belanglos aber ist das, was Goethe von seiner Unterredung berichtet – er ist der einzige verlässliche Zeuge, die anderen, einschließlich Talleyrand, hängen von ihm ab –, trotzdem nicht.
Der erste »öffentliche« Teil handelte von der Literatur. Goethe sagt, der Kaiser habe sie wie ein Kriminalrichter betrachtet, also mit dem strengen Blick auf die Glaubwürdigkeit; daher seine Kritik an Voltaires »Mahomet«, in dem der Tyrann sich selbst anschwärzt, und daher auch sein Tadel für erzähltechnische Inkonsequenzen im »Werther«. Napoleon machte damit die Wirklichkeit, zunächst in Form äußerlicher Wahrscheinlichkeit, zum Kriterium der Literatur. Am Ende verallgemeinerte er das mit der Sentenz gegen die Schicksalsdramatik: »Die Politik ist das Schicksal!« Also setzte der Kaiser sich gegenüber dem Dichter selbst als das Prinzip oder die Personifikation der Wirklichkeit in Szene. Das ist gegenüber einem Autor, der zeit seines Lebens so sehr auf eine überpolitische Kunst setzte, ein bedeutender Moment.
Im zweiten, intimeren Teil des Gesprächs versuchte Napoleon, mit Goethe selbst Politik zu machen. Kurz zuvor hatte er in einem Memorandum überlegt, ob man nicht einflussreiche Schriftsteller durch Sinekuren – er dachte an Beraterstellen beim Staatstheater – unterhalten und gewinnen könne. Napoleon lud Goethe mit seiner Familie nach Paris ein; und er forderte ihn – möglicherweise allerdings erst in Weimar am 6. Oktober – auf, einen neuen »Caesar« beziehungsweise ein Brutus-Drama zu schreiben; eines, das die tragischen Folgen von Caesars Ermordung für das Römische Reich darstelle. In seiner späten Niederschrift hat Goethe diesen pragmatischen Teil der Unterredung ins Undeutliche verwischt, vermutlich weil er seine Loyalität gegenüber dem Herzog Carl August nicht in Frage stellen lassen wollte.
Überglücklich war Goethe ebenso wie Wieland auch über den Orden der Ehrenlegion, den der Kaiser den beiden deutschen Autoren am Ende des Fürstenkongresses verlieh; der Zar fand, er müsse ein Gleiches tun, und so trafen große Schatullen und knisternde Urkunden aus West und Ost in Weimar ein. Es war überhaupt das erste Mal, dass deutsche Schriftsteller einen Orden bekamen. Kein deutscher Fürst war je zuvor auf diesen Gedanken gekommen. Das Kreuz der Ehrenlegion hat Goethe bekanntlich bis über die Befreiungskriege hinweg getragen und sich dafür 1813 sogar den dreisten Anpfiff eines österreichischen Offiziers eingehandelt; wenn ein Patriot ihn späterhin darauf ansprach, sagte er: »Das Pentagramma macht dir Pein?« und ließ das Kreuz in der Rocktasche verschwinden.
Seit Erfurt war Napoleon für Goethe »Mein Kaiser«. Das hat nicht nur mythologische Bedeutung. Der Dichter fühlte sich unter dem durch die Ehrenlegion sichtbar gemachten persönlichen Schutz des Weltregierers; so war die existentielle Verunsicherung von 1806 geheilt. Nach der bonapartistisch-bürgerlichen Reform kam ein neuer Zug von imperialem Feudalgeist in Goethes politische Existenz. Der Kontrast zu seinem Herzog war schneidend. Carl August bangte nach Erfurt mehr als davor um sein politisches Überleben, denn das Bündnis Napoleons mit dem Zaren, das Weimar vorerst schützte, erwies sich bald als brüchig. Unterdes verschob der Protektor des Rheinbundes weiterhin nach Lust und Laune deutsche Grenzen, beispielsweise die von Westphalen. Goethe aber ließ sich zwei Tage nach dem Ende des Erfurter Kongresses ein Französisch-Lehrbuch aus der Weimarer Bibliothek kommen. Und kurz danach tat er die große, oft zitierte Äußerung: »Deutschland ist Nichts, aber jeder einzelne Deutsche ist viel. Verpflanzt, zerstreut wie die Juden in alle Welt müssten die Deutschen werden, um die Masse des Guten ganz und zum Heil aller Nationen zu entwickeln, die in ihnen liegt.« Wenn man das auf Goethes damalige Lage bezieht, die in Weimar durch einen heftigen Streit mit dem Herzog über Theaterfragen verdüstert war, dann muss man vermuten, dass Goethe an den Paris-Vorschlag des Kaisers mehr als einen Gedanken verschwendete.
Dazu kam Goethes tiefe Unzufriedenheit mit der Reaktion des deutschen Publikums auf seine neuen Werke, vor allem den Roman »Die Wahlverwandtschaften«. Mit einer bemerkenswerten politischen Analogie schrieb er dazu am 31. Dezember 1809 an seinen deutsch-französischen Freund Graf Reinhard: »Das Publikum, besonders das deutsche, ist eine närrische Karikatur des demos; es bildet sich wirklich ein, eine Art von Instanz, von Senat auszumachen, und im Leben und Lesen dieses oder jenes wegvotieren zu können, was ihm nicht gefällt.« Gegen solche republikanische Anmaßung setzt Goethe die Gemeinsamkeit historischen und künstlerischen Tätertums. Am Ende würden auch die »Wahlverwandtschaften« als unveränderliches Faktum vor der Einbildungskraft stehen, »wie man sich in der Geschichte nach einigen Jahren die Hinrichtung eines alten Königs und die Krönung eines neuen Kaisers gefallen läßt. Das Gedichtete behauptet sein Recht, wie das Geschehene.« Brüderlichkeit unter den Großen der Geschichte, das ist es, was sich hier ausspricht.
Trotz fortdauernder Kriege und neuer Volksaufstände vertraute Goethe auf die Stabilität des Empire, anders als Gentz, Metternich oder Freiherr vom Stein, auch anders als Talleyrand. Vor allem der Hochzeit Napoleons mit Marie-Luise, der Tochter des österreichischen Kaisers, schrieb er, darin bestärkt von Reinhard, eine enorme Bedeutung zu. Hier schien der Bruch zwischen dem alten Europa und dem revolutionären Frankreich endlich geheilt. In dieser Stimmung von Erleichterung und neuer Sicherheit machte sich Goethe daran, die Geschichte seines Lebens zu schreiben. Wenn es ein Werk von ihm gibt, in dem die klare Luft des Empire weht, dann ist es »Dichtung und Wahrheit«; nicht umsonst rühmte Jakob Grimm das »Epische, Gründliche, Historische, das Weitaufgenommene, von Farbe Himmelblaue« daran. »Dichtung und Wahrheit« ist nicht nur ein Bildungsroman; er zeigt den Einzelnen in seinen Zeitverhältnissen, und zwar, wie Goethe im Vorwort ausdrücklich hervorhebt, auch in den »ungeheuren Bewegungen des allgemeinen politischen Weltlaufs«. »Dichtung und Wahrheit« ist ein großes Stück Zeitgeschichte, und als solches natürlich ein Werk der napoleonischen Epoche. »Goethe und sein Jahrhundert«, so hat ein zeitgenössischer Rezensent den Charakter des Buches resümiert.
Eine Woche nachdem Goethe mit der Niederschrift seiner Autobiographie begonnen hatte, schrieb er in einem Brief an den Historiker Georg Sartorius: »Es ist irgendwo gesagt: daß die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit umgeschrieben werden müsse, und wann war wohl eine Epoche, die dieß so nothwendig machte als die gegenwärtige!« Bezeichnend ist der Anlass der Äußerung: Sartorius hatte Goethe eine Untersuchung über das Verhältnis von Siegern und Besiegten, nämlich von Ostgoten und Römern im Reich von Theoderich zugesandt, mit der er einen Preis des Pariser »Institut« gewonnen hatte. »Der Haß der Römer gegen den selbst milden Sieger, die Einbildung auf ausgestorbene Vorzüge, der Wunsch eines anderen Zustands ohne einen besseren im Auge zu haben, Hoffnungen ohne Grund, Unternehmungen aufs gerathewohl«, so resümierte Goethe den Inhalt der Schrift von Sartorius, die damit zu einer Allegorie der deutschen Zustände in Napoleons Reich wurde. Man darf bei so entschlossenem Willen, Vergangenes unter zeitgenössischen Gesichtspunkten zu verstehen, auch nach den aktuellen Bezügen in »Dichtung und Wahrheit« fragen.
Diese liegen vor allem in den ersten fünf Büchern auf der Hand, und jeder Leser ist aufgefordert, hier seine eigenen Entdeckungen zu machen. Das Verhältnis von Siegern und Besiegten verhandelt die Geschichte des Königsleutnants in Goethes Elternhaus während der französischen Besatzung Frankfurts im Siebenjährigen Krieg. Die Erzählung bietet eine Verhaltenskasuistik für ein Problem, das in der napoleonischen Zeit millionenfaches Schicksal in Deutschland war: Einquartierung fremder Soldaten. Soll man sich in Trotz verstocken wie der Vater oder das Beste daraus machen wie Goethes Mutter und ihre Kinder? Die Antwort ist eindeutig. Goethe erzählt von einem absichtslosen Beginn deutsch-französischen Kulturaustauschs, und es ist eine der vielen schönen Pointen, dass er als Elfjähriger die Rolle des Nero in Racines »Brittanicus« selbst gespielt hat, in der er Talma auf dem Erfurter Kongress beobachten konnte.
An der Figur Friedrichs des Großen, die die kindliche Lebenswelt des Erzählers in Parteien zerfallen lässt, verhandelt Goethe wie Johannes von Müller 1807 das brennende Problem der historischen Größe: Friedrich ist ein großer Schöpfer, durch sein Beispiel auch ein Anreger der deutschen Literatur, der er erst ihren Stoff gibt; zugleich ist er, wie in Leipzig und Dresden zu erfahren war, ein furchtbarer Zerstörer, dessen die Menschen mit Hass gedenken. Und er spaltet das Reich, dem nicht erst Napoleon den Untergang bereitete. Der Bericht von der Frankfurter Krönung 1764 – erzählerisch für mich das Großartigste, was es von Goethe überhaupt gibt – verklärt das Reich nicht nostalgisch, sondern lässt es in einem faustischen Mummenschanz auferstehen; die kaum verständlichen Zeremonien, bei denen den geladenen, aber nicht erschienenen Fürsten gleichwohl die Gedecke auf- und abgetragen werden, unter seiner viel zu breiten Krone der jugendliche Monarch, dessen Vater schon als »Gespenst Carls des Großen« bezeichnet worden war, eine Maria Theresia, die angesichts der Abläufe in enthemmtes Gelächter ausgebrochen war, und all das erzählt aus der Sicht eines frisch verliebten Jungen, der seine ersten Ausflüge ins Nachtleben macht: Deutlicher konnte man den deutschen Lesern nicht in Erinnerung rufen, dass sie ihr Reich längst verloren hatten, als Napoleon es liquidierte.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.