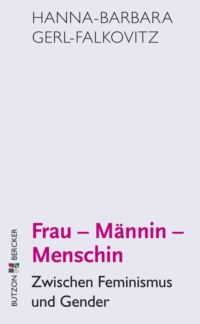Kitabı oku: «Frau - Männin - Menschin», sayfa 4
5. Das Gewinnen der Zukunft. Die noch unbenannte Struktur
Die sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts abzeichnende „Nachneuzeit“ scheint auf eine Überwindung der Neuzeit hinzuweisen, sofern diese in eine sinn-lose Rationalität verflacht ist. Wie es sich anfänglich in der Kunst (im Wort wie im Bild) ausdrückt, kann es als ein Merkmal der beginnenden Neuzeit gelten, Freiheit von der perspektivischen Fixierung an den Raum, also an die „Richtung“ zu gewinnen. In der Nachneuzeit äußert sich bildende Kunst weithin in der überhaupt verlassenen Perspektive, in Aufhebung der einseitigen Ansicht und des fixierenden Auges.65 Stichworte wie „Raum- und Dingzertrümmerung“, durchaus ungriechisch, weisen auf die irritierende, auch zerstörerisch wirkende Freisetzung von der bisherigen geordneten Räumlichkeit hin.
Die vielfältigen Entwicklungen, die hier anzuführen wären, sind durchaus noch nicht in einer adäquaten Weise zu ordnen; gerade die Deutungsversuche seit dem New Age zeigen vielmehr die Widersprüchlichkeit und Unschärfe einer Deutung, die die Phänomene nicht mehr rational kategorisieren will, aber kaum in Ansätzen überzeugend entwickelt ist. Bezeichnend ist am ehesten das Hochkommen, sogar der Rückfall in bereits überholt geglaubte Strukturen, wie es sich in der blühenden Esoterik zeigt; ein solches Hochkommen insbesondere magischer und mythischer Zusammenhänge ist aber kein sinnvolles Überholen unzureichend gewordener Lösungen.
In diesem knappen Versuch sei daher nur auf die deutlicher fassbare Neuordnung der Geschlechterfrage eingegangen. Hier ist eine grundlegende Entdeckung zu kennzeichnen: C. G. Jung hatte in den 1930er-Jahren tiefenpsychologisch die Theorie des gegengeschlechtlichen Anteils in der Seele (anima/animus) erarbeitet. Bei allen kritischen Einwänden gegen diese Theorie: Damit ist insofern der Grundzug einer neuen Anthropologie gewonnen, als es um das Freiwerden des Menschen in Mann und Frau geht. Überhaupt ist mit der Freilegung der Psyche im 20. Jahrhundert der Schritt zur Ergänzung einer bloß einseitig rationalen Männlichkeit als Prototyp des Menschlichen getan. Sigmund Freud hatte mit der unausgewogenen Geschlechterzuordnung den unheilvollen Zug der Neuzeit seit der Renaissance charakterisiert: Wie Ödipus den Vater erschlug und die Mutter heiratete, so habe der neuzeitliche Mensch den Vater(-Gott) getötet und die Mutter, die Erde nämlich, ausgebeutet. Ohne sich der Interpretation Freuds in Bezug auf den „Ödipus-Komplex“ des Einzelnen anzuschließen, so besitzt der benutzte Mythos doch trotz seiner Unschärfe eine Warnung, der sich die Neuzeit weithin verweigert hatte.
Positiv gewendet und um in diesen symbolischen Übertragungen zu bleiben: Es geht darum, ein neues Verhältnis zur Frau zu gewinnen und damit ein seiner Einseitigkeit und zerstörerischen Durchsetzungskraft enthobenes Verständnis des Mannes.
Diese psychischen und symbolischen Einsichten sind deutlicher zu bewahrheiten an der konkreten „Frauenfrage“. Denn seit dem 19. Jahrhundert zeichnet sich ein bisher nicht bekanntes Bewusstwerden der Frau ab, die das Ungleichgewicht der Geschlechter als ungerecht begreift. Diese Bewusstwerdung entwickelte sich in bedenkenswerten Anläufen. Wenn man die einflussreichen Frauengestalten des Mittelalters einmal nicht berücksichtigt, so ist die erste größere Bewegung dieser Art in der frühen Neuzeit, der Renaissance nämlich, anzutreffen; dort kann die Frau erstmals teilhaben an der männlichen Bildung, freilich nur als Aristokratin.66 Diese Bildung ist ausdrücklich die rationale; alte Sprachen und neue Wissenschaften werden auch von Frauen beherrscht. Erasmus von Rotterdam schreibt dazu ein aufschlussreiches Zwiegespräch zwischen einem ungebildeten Abt, dem Vertreter des Mittelalters, und einer hochgebildeten Humanistin, Vertreterin der Neuzeit.67
Hier entdeckt die Frau die taghelle Seite ihrer selbst; sie macht sich zu eigen die neuzeitliche Rationalität, auch im Sinne der Vermessung und Beherrschung der Natur und des Selbst. Im Unterschied zu den fast ausschließlich klösterlich gebundenen, der Mystik zugeneigten Denkerinnen des Mittelalters entwickelt sich hier eine Lust am Individuellen und die Möglichkeit eigener Lebensgestaltung. Die Fürstin als Patronin der Künste und des Wissens, die Politikerin, die Gelehrte, nicht zuletzt die Dichterin zeigen den persönlichen Ton, die Eigenheit des Ego, die grundsätzliche Freude an der Aktivität, die hier auch an Frauen sichtbar wird.
Ein weiterer geistesgeschichtlicher Schub vollzieht sich in der Romantik, d. h. um die Wende von 1800. Ab hier datieren neuerdings die Lexika die Ursprünge der Emanzipation, an der hervorragenden Reihe von Frauengestalten, die – hinausgehend über die Tagesklarheit der frühen Neuzeit und über die mündige Vernunft der Aufklärung – das „Geheimnis“, die Nachtseite des Lebens einbeziehen. Nacht und Tod werden hier nicht entdeckt als Gegensatz, sondern als Einheit mit dem Leben. Von hier an reißt die Kette nicht mehr ab: Annette von Droste-Hülshoff beschreibt realistisch und nicht geträumt die Abgründe der Vorzeit und der eigenen Seele („Die Mergelgrube“), wie sie wohl nie zuvor beschrieben wurden. Anschließen lassen sich die verschiedenen Frauenbewegungen des 20. Jahrhunderts, deren Spuren sogar bis in die islamische Welt reichen, und diese Bewusstwerdungsvorgänge sind in der Tat nicht mehr umkehrbar.
Hinzu kommt etwas, was nicht unterschätzt werden darf: die biologische Klärung von Zeugung und Empfängnis. So sehr in der mütterlichen Welt der Mensch gleichsam eigentätig der Mutter entstammt und keines „Vaters“ bedarf, so sehr hat die Vaterwelt, von Aristoteles angeleitet, bis zur Entdeckung der weiblichen Eizelle 1827 geglaubt, der neue Mensch werde vom Mann gezeugt und in die Frau wie in einen Brutkasten übergeben. Diese irrige Behauptung ist nicht zuletzt in die Ethik der Geschlechter eingeflossen. Wie die Psychologie, so hat mittlerweile auch die Biologie den tiefen Graben zwischen Mann und Frau beseitigt, denn eine Bewertung oder Hierarchisierung ihres biologischen Unterschieds ist gar nicht mehr möglich.
Für die Theologie zeigen sich vergleichbare Anzeichen einer neuen Wahrnehmung Gottes; der Satz von Johannes Paul I. (1976), Gott sei noch mehr Mutter als Vater, brachte mittlerweile eine Fülle von weiteren Einsichten zutage. Damit ist eine Überlegung aufgebrochen, die längst noch nicht am Ende ist; Genaueres dazu wird ja auch in diesem Buch gesagt. Auf jeden Fall zeigen sich heute nicht nur Bestrebungen, die Identität von Frau und Mann aus dem Spannungsfeld der Geschichte neu zu begreifen, sondern, um es ungewöhnlich zu formulieren, auch die Spannweite Gottes neu wahrzunehmen. Gerade hier erweist sich, dass Theologie und Anthropologie aneinander gültig werden. Im Sinne Goethes: Wir dürfen von Gott anthropomorph sprechen, weil wir selbst theomorph sind.
Seit dem Aufblühen der feministischen Theologie finden sich Überlegungen über den Geist als das „weibliche“ Element in Gott, was in der alten Sophialehre, der Lehre von der ungeschaffenen Weisheit, besonders in der orthodoxen Kirche vorgebildet war. Wichtig scheint jedoch und immer erneut der religiösen Balance aufgegeben, in Gott nicht eine Art geschlechtlicher Spaltung anzunehmen, sondern seinen übergeschlechtlichen Grundzug wahrzuhaben (dies allerdings auch in „Vater“ und „Sohn“).
Hinzu kommt, dass der Bezug von Gott und Schöpfung philosophisch gesprochen nicht mehr derjenige einer Transzendenz des Diesseits durch das Jenseits ist. Die dualistische Vorstellung „zweier Welten“ hat, wie bei Feuerbach, Marx, Nietzsche religionskritisch herausgestellt, die „Hinterwelt“ als das Entscheidende verstanden und das „Irdische“, Materielle auf die Seite des Unwerten, Vorläufigen gedrängt, jene Seite, auf der sich die Frau als Gattungswesen und stofflich-sündhafte befand. Als neuer Begriff bietet sich „Transparenz“ an: das Durchscheinen des Ursprungs in allem Vorfindlichen, des Himmels in der Erde. Eine solche Transparenz war tatsächlich theologisch schon vorgedacht: im Entwurf der verklärten Leiblichkeit etwa oder im Entwurf der kommenden Welt, wie ein Text des 12. Jahrhunderts über das himmlische Jerusalem sagt:
„Sie ist in Goldschöne
Wie durchsichtiges Glas
Alldurchschaubar
Durchaus lauter. (. . . )
Die bedarf nicht der Sonne
Noch des Mondenschimmers
Je zur Erleuchtung.
In ihr ist Gottesschimmer
Der sie ganz durchleuchtet
Zu gemeinem Frommen.“
Die heutige Aufgabe wäre noch drängender darin zu begreifen, dass diese „Durchleuchtung“ der Welt mit Gott bereits jetzt statthat, allein schon kraft des Ernstes seiner Fleischwerdung. Ganz in der Welt, aber ganz selbstvergessen in ihr – diese Balance Gottes zur Welt, frei von jedem Pantheismus und ebenso frei von jedem abgedankten, abgerückten Welten-Mechaniker, der sein Geschäft mittlerweile dem in der Tat geschäftigen Menschen übertragen hat, diese Balance hat das Denken neu und tiefer zu zeichnen. Gebunden ist dieses Denken der Transparenz Gottes in seiner Schöpfung zweifellos an ein neues Wahrnehmen der Schöpfung selbst, wie es schon bei Teilhard de Chardin, der sich selbst als „Sohn der Erde“ bezeichnete, und in Goethes Wort von der „Andacht zur Erde“ anklingt. Im Hintergrund steht, die Theologie herausfordernd, die Zeile Rilkes: „Erde, du liebe, ich will. Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her.“68
Sollte eine Schöpfungstheologie darauf Antwort geben, so wird auch die Gestalt der Frau als ein neu ernst zu nehmendes Ebenbild ihres Schöpfers, in besonderer Transparenz auf ihn, gewahrt werden müssen. Ebenso wird sich zeigen, dass eine neu ausgelegte Mariologie erforderlich wird, die den Gedanken des „integren Menschen“ erstmals an einer Frau einsichtig macht. Unter dieser drängenden Frage sind die Mariendogmen tiefer zu lesen: Wie das alte Dogma von der Jungfrau-Mutter die Unabhängigkeit von einer Definition und Sinngebung der Frau durch den Mann aufzeigt, so wird in der „leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel“ die Erde auf den Himmel zu geöffnet, nicht mehr durch ihn abgewiesen: Die aufgehobene Zweideutigkeit des „Fleisches“ wird an der integren Frau erfahren.
Die Kirche hat bei allem noch zur Sprache kommenden Zögern und einer spürbaren Unsicherheit als Zeichen der Hoffnung seit 1970 mehrere Kirchenlehrerinnen ernannt: Teresa von Avila, Caterina von Siena und Therese von Lisieux; dazu 1999 drei Patroninnen Europas: Birgida von Schweden, nochmals Caterina und Edith Stein. Jedes Zögern, selbst jedes Verbot, bewirkt ja außer einer Stauung der Kräfte auch ihre Klärung und Verdichtung. So mag das bisher nicht zugelassene Diakonat der Frau noch in einer letzten Sammlung der Kräfte stehen. Zugleich ist es die nicht delegierbare Aufgabe der Frauen, weiterreichende Einsichten zu formulieren. Die Beziehung Frau und Kirche wird nicht an der Klagemauer über das (vermeintlich) Vorenthaltene gelöst. Diese Beziehung bleibt so lange fruchtbar, wenigstens offen, solange die Vorarbeit, das Vor-Denken, das Leben mit dem Geist von den Frauen selbst wahrgenommen und der Anstrengung der Klärung unterzogen wird.
Das historische Erwachen der Kultur beginnt mit der Erdhaftigkeit, der Bindung und schließlich dem Verfallensein an das Magische der Erde, deren symbolische Entsprechung die Frau ist. Nach Phasen der Zweitrangigkeit der Frau zeichnet sich eine Rückkehr zu ihr ab: transparent auf den Schöpfer. Das gelingt nur, indem die Frau nicht als Gattungswesen, sondern als Mensch durchsichtig wird. Es würde der Kirche zur Ehre gereichen, diesen kommenden Vorgang mit den ihr besonderen Kräften zu stützen, wie ihr das ja zu Beginn des Christentums mit den „Vätern“ und „Müttern“ so befreiend gelang. Ließe sich dieser Inspiration nicht heute gleichermaßen befreiend auf neues Terrain folgen?
Das heißt aber für die Frau, dass sie in der Fülle ihrer Anlagen – ihrer Mütterlichkeit, in ihrer erotischen Kraft, aber auch in jenem rationalen Aufwachen, das mit dem Stichwort „Emanzipation“ eher unglücklich besetzt ist – nicht eine Anlage gegen die andere ausspielt. Sie ist nicht einfach zu einer Rückkehr zu den Müttern aufgefordert, aber auch nicht zu einem bloßen Vorpreschen zu der nichtmütterlichen Frau. Vielmehr geht es um ein Gewinnen eines Menschseins, das intensiv von der Frau mit vorbereitet und von ihr gelebt werden will. Von Robert Musil stammt der nachdenkliche Satz: „Die neue Frau ist eiliger ans Licht getreten als die neue Mutter.“ Dies mag wahr sein aus dem Grund, weil das Muttersein einfach das „Normale“ war. Die „neue Frau“, sollte so etwas angezielt werden (denn hier wird eher das Gesetz des absichtslos Erreichten wirksam sein), wird sich aber nicht durch Abgrenzen gegen das Normale auszeichnen. Ganzheit meint Einbeziehen. Die wechselseitige Durchsichtigkeit aller fraulichen Anlagen verhindert gerade Einseitigkeit, auch einseitige Aggression. Alle bisherigen Qualitäten bleiben dabei bestehen und sollten gleichzeitig wirken. Alle Kräfte wollen gelebt sein, in der Zuversicht, dass sie damit nicht verschwimmen, sondern in höchster Differenzierung einer Mitte dienen. Diese Mitte ist freilich eine zugelassene und nicht eine gemachte. Eben deshalb: Frauen sind aufgefordert, dieses Zulassen vorzubereiten, die Transparenz auf die Mitte einzuleiten. Um ihr einen Namen zu geben: Sie ist das Menschliche in der Gestalt des Weiblichen.
II. Es lebe doch der Unterschied!?
Zum Spannungsfeld Christentum und Feminismus
1. Horizonte, heute
Die Frauenfrage spielt sich heute weithin im areligiösen Feld ab, fernab von irgendwelchen christlichen Vorgaben. Oder, falls sich die Theorie auf die Vergangenheit einlässt und auf deren jüdisch-christliche Bausteine, so bestellen die Forschungen überwiegend ein religionskritisches, auch bibelkritisches Feld. Der herkömmliche Glaube, gestützt auf viele Bibelstellen, sei – von einigen „positiven Anstößen“ abgesehen – dem Thema Frau eher abträglich gewesen, habe Unterordnung, Dulden, Sich-Einfügen gelehrt. „Wie vormals gegen ihre Feinde muss sich die Kirche heute zuweilen vor ihren eigenen Kindern verteidigen. Hamlet, der seiner Mutter das Gewissen erforscht, ist die Rolle Tausender auf offener Szene, Zehntausender hinter den Kulissen geworden.“ So Joseph Bernhart 1935, so die Lage heute. Besonders wer heute über das Thema „Frau“ schreibt und das Ganze in die Helle des Christentums stellt, gerät ohne weiteres Dazutun stattdessen ins Zwielicht: in die Abrechnung mit dem Christentum in einer unduldsamen, oft gehässigen Variante. Geschichte lässt sich herrlich ungeschichtlich unter den Leitlinien heutiger Emanzipation abfragen. Nicht ohne meine Vorurteile! Hier stehen die Väter in der Mutter Kirche, aber auch die gläubigen Frauen in der Männerkirche vor einem eigentümlichen Tribunal, das in den letzten Jahren scharf zu einer anschwellenden Kirchenschelte überging. Wer als Frau heute zur Kirche gehört, kann das nur „trotzdem“ – meinen viele (auch Frauen). Leiden an der Kirche ist in, Kirche selbst ist mega-out – meinen viele (auch Frauen).
Dabei bleibt jedoch – so die These – in der Regel die reiche, vielgesichtige Frauengeschichte auf der Strecke. Vor allem bleibt auf der Strecke, wie sich die Frauen der jüdisch-christlichen Lebenswelt selbst verstanden. Die gelebten, geglückten oder misslungenen Leben werden nach dem ersten tatsächlichen Vergessen nun ein zweites Mal auch theoretisch begraben. Sofern die zum „Atheismus“ erzogenen Generationen ihr kulturelles Gedächtnis verlieren, ist es entscheidend, das Flussbett mit dem Strom des Geschehenen zu füllen, es gegen die massiv-unwirkliche Einebnung – die doch so wirksam ist – zu verlebendigen. Freilich war auch in der Frauenfrage die Kirche selbst ihr eigenes Problem. Anstelle des Leuchtfeuers, das sie in ihren Ursprungsschriften bei sich trägt, kennzeichnet manche Ereignisse und Aussagen ein zähes Widerstreben gegen die eigenen Frauen. Sehr wohl könnte die Kirche im Spiegel ihrer Testamente das Gesicht der Freiheit auftauchen sehen, ja den Freien selbst. Die Unterscheidung der wirklichen Emanzipation von der faulen Frucht der Willkür wird ihr niemand abnehmen, denn dazu hat sie den Geist als Prüfer der Geister erhalten. Nicht selten verschenkt und vergrämt sie aber in ihrer langen Geschichte die eigenen Erzeugnisse, denn Emanzipation ist ein altes christliches Erbe, und das weiß sie sehr wohl. Nur kam zuweilen der Mut abhanden, sich dieser eigenen Schätze, des eigenen Pulvers aus der Pulverkammer zu bedienen. So läuft heute ein Vorgang der Enterbung, der die Ergebnisse und Leistungen dieser christlichen Geschichte wie eine Beute unter sich verteilt, häufig auch nur mit deren Bruchstücken um sich wirft.
Trotzdem bleiben Frauen nicht nur – gerade noch – in der Kirche, viele sind in ihr und wollen in ihr sein, nicht am Rand und mit einem Fuß, sondern in der Mitte. Und es wäre gut, es würde jenseits von Verteidigung und Angriff gelingen, die Gründe dafür aus der Sache heraus darzustellen. Sofern die Sache Bestand hat, bedarf sie keiner Verteidigung. Sie bedarf einer Augenöffnung, und auch diese soll sich im Folgenden nicht erstrangig auf Glaubensaussagen abstützen (die nicht alle teilen), sondern zunächst auf Geschichte, Daten, Erfahrungen.
2. Ein Blick in andere religiöse Kulturen: Die Asymmetrie der Geschlechter
Das schwierig gewordene Verhältnis Frau und Mann scheint zunächst ein Sonderproblem des 19. und 20. Jahrhunderts zu sein, mehr noch der Nachkriegsentwicklung seit 1945. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass die heutige Forderung nach Freiheit und Gleichheit der Frau mit dem Mann vielmehr ein moderner Ausschnitt aus einem auch sonst interkulturell und interreligiös nicht befriedigend gelösten Feld der Geschlechterzuordnung ist. Denn die Geschlechter stehen in allen Kulturen und Religionen asymmetrisch zueinander. Ihre Vorgaben und Aufgaben („Natur“ und „Kultur“) sind unterschiedlicher Art und waren daher bis ins 20. Jahrhundert nicht austauschbar aufeinander bezogen.
Drei solcher Zuordnungen von Mann und Frau lassen sich skizzieren. Sie treten durchgängig durch die bekannten Kulturen als Grundmuster auf; ihre Entwicklung, aber auch Gleichzeitigkeit sind für den alteuropäischen Kulturraum (Mesopotamien, Ägypten, Griechenland, Rom) gut erforscht. Judentum und Christentum haben beide an den drei Grundmodellen Anteil, verändern aber jede der Zuordnungen in bedenkenswerter Weise. Die Darstellung dieser drei Zuordnungen schließt bereits ein tieferes Verständnis auf, da auch in diesem Fall die Geschichte nicht einfach „hinter“ uns, sondern „in“ uns liegt. Zu beachten ist, dass es sich um Typologien handelt: Nicht jede Frau und jeder Mann verhält sich gleichermaßen; das Einzelschicksal ist und bleibt das Reizvolle.
a) Die Macht der Mütter. Typik der Fruchtbarkeit
Die Gleichsetzung von Frau = Mutter ist eine erste grundlegende kulturelle Konstante. In manchen Sprachen gibt es nur das Wort „Mutter“, aber kein eigenes Wort für „Frau“.69 Und hier setzt bereits die erste Asymmetrie ein: Der Mutterschaft entspricht kaum eine vergleichbare Vaterschaft, beides biologisch betrachtet. Im Lebensgefühl dieser frühen Zeit übernimmt die Frau als Fruchtbare (aber eben nur als Fruchtbare) eine bestimmende Aufgabe: Nur über die Geburten ist die Lebensfähigkeit eines Stammes zu erhalten. Unfruchtbare Frauen gelten daher in der Regel als verflucht. In der Mutter (oder auch in der Großen Mutter = Großmutter, die die Töchter und Schwiegertöchter „verwaltet“) wird die geheimnisvolle Tatsache verehrt, ja als „göttlich“ empfunden, dass die Frau das Leben aus sich heraus weitergibt. Lange Zeit hindurch ist der Vater – oder ein bestimmter Vater – wohl nicht einmal als zugehörige „andere Hälfte“ im Bewusstsein, auf jeden Fall nicht in der unmittelbaren Verantwortung für das Kind. In dieser naturhaft-autonom empfundenen Fruchtbarkeit der Frau ist auch die Wiedergeburt verankert: Es sind die Mütter, die die verstorbenen Mitglieder des Stammes zu neuem Leben erwecken (müssen). Ebenso weiblich betont ist die Verabschiedung in den Tod und das Versorgen oder Ernähren der Verstorbenen auch nach dem Tod. Ahnenkulturen sind grundsätzlich weiblich konnotiert. In bestimmten Tempeln in Japan besuchen und „pflegen“ die Mütter ihre „Wasserkinder“, die abgetrieben wurden, bringen Geschenke, Spielsachen, Süßigkeiten, je nach „mitwachsendem“ Alter.
In diesem „weiblichen“ Netz von Leben und Tod sind die vielfachen religiösen Rituale angesiedelt, die gerade die Mütter zu besorgen haben. Als Trägerin numinoser (= naturhaft göttlicher) Fruchtbarkeit garantiert die Gebärerin in den alten Kulturen das Leben der Sippe. So wirkt die Frau in der rituellen Erweckung der Fruchtbarkeit, auch indem sie tötet: Häufig wird ein Kind, etwa die Erstgeburt, geopfert, was heißen will: dem numinosen Kreislauf der „heiligen Naturkräfte“ zurückgegeben. Erschreckend für das heutige Bewusstsein sind in der Regel gerade die Fruchtbarkeitsriten, sofern sie entweder Tier- und Menschenopfer oder auch Sexualverkehr anonymer Art einschließen; dazu gehören etwa jahreszeitliche „heilige Hochzeiten“, Tempelprostitution, Verehrung von Genitalien als Gottheiten.70 Mit solchen Riten wurde (auch in Kanaan als dem Nachbarland Israels) die mütterlich-göttliche Fruchtbarkeit auf die Erde herabgerufen; das Göttliche war vielfach ausdrücklich sexuell besetzt und wurde im Geschlechtsakt verehrt.
„Mutterkulturen“ bedeuten in der Regel allerdings keine moderne „politische“ Wirksamkeit der Frau; „nach außen“ repräsentieren meist Männer die Gruppe, nicht selten kraft der Verwandtschaft zu einer bestimmten hochrangigen Frau, bei der die Sippenverbindungen blutsmäßig zusammenlaufen.71
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.