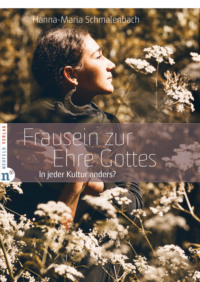Kitabı oku: «Frausein zur Ehre Gottes», sayfa 3
1.1.1 Die Einbettung der Aussagen in das Gesamtanliegen der Schrift
Zunächst fällt auf, dass die Heilige Schrift insgesamt nur wenige grundsätzliche Aussagen und konkrete Anweisungen zur Rolle der Frau enthält und dass diese nicht in einem einheitlichen Lehrabschnitt zusammenstehen, sondern in verschiedene Zusammenhänge des Heilshandelns Gottes in der Geschichte der Menschen eingebettet sind.15 Kombiniert man solche Aussagen nun losgelöst von diesen Zusammenhängen miteinander, um ein umfassendes Bild über Gottes Willen zur Stellung und Rolle der Frau zu bekommen, so lassen sie sich nicht spannungsfrei nebeneinanderstellen, sondern wirken widersprüchlich. Das kann den Ausleger zu willkürlichen Entscheidungen über ihre Bedeutung und Zuordnung veranlassen. Viele Hinweise zum Thema sind nur indirekt aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, am Verhalten Jesu oder aus dem Erleben der frühen Gemeinde abzulesen. Ein ausgesprochenes Gottesgebot zur Rolle der Frau gibt es weder im Alten Testament noch in den Lehren Jesu. Konkrete Anweisungen diesbezüglich finden sich nur in den neutestamentlichen Briefen. Insgesamt wird deutlich: Die Rolle der Frau ist kein isolierbares Hauptanliegen der Heiligen Schrift, sondern die Aussagen dazu müssen aus ihrer Gesamtbotschaft sorgfältig erfasst und bewertet werden.
1.1.2 Zeitlose und situationsgebundene Aussagen
Dass die Aussagen der Schrift, vor allem ihre ethischen Anweisungen, den ewigen Willlen Gottes zum Ausdruck bringen und dabei zunächst an Menschen in spezifischen kulturellen und geschichtlichen Situationen gerichtet waren, schafft für den heutigen Leser ein Spannungsfeld, das bei der Suche nach einem an der Bibel ausgerichteten Frauenbild besonders stark empfunden wird. Dies ist umso mehr der Fall, je weiter die kulturelle Situation des heutigen Lesers oder Hörers von derjenigen der ursprünglichen Hörerschaft abweicht. Da das Mann- oder Frausein einerseits dem Schöpferwillen Gottes entstammende unveränderliche Wesensmerkmale sind, die aber andererseits in den Sozialstrukturen menschlicher Kulturen definiert und ausgelebt werden, ist es in der Frage nach der Stellung der Frau besonders schwer, in den biblischen Texten den ewigen Willen Gottes von praktischen Anweisungen in eine bestimmte Kultur hinein zu unterscheiden. Die „Spannung zwischen der ewigen Relevanz der Heiligen Schrift als Wort Gottes und ihrer historischen Eigenart“ (Fee 1996, 16) hat also in dieser Frage eine besondere Brisanz und ist eine große Herausforderung für heutige Ausleger. Das macht die Vielfalt der Auslegungen von Bibeltexten zur Frauenthematik verständlich.16
1.1.3 Die „inspirierte Doppeldeutigkeit“ der Aussagen
Insgesamt finden sich in den Aussagen der Heiligen Schrift zum Verhältnis zwischen Mann und Frau zwei Hauptstränge, die unvereinbar nebeneinander zu stehen scheinen und dementsprechend für sehr unterschiedliche Auslegungen Raum lassen. R. P. Stevens beschreibt sie als „radical sexual equality“17 einerseits und „radical sexual differentiation“ andererseits (Stevens 1992, 20) und spricht von einer „inspired ambiguity“, die von Gott genau so zugelassen sei (Stevens 1992, 20), allerdings den menschlichen Auslegern viel Kopfzerbrechen verursache.18
Im Folgenden soll nun das weite Spannungsfeld der hermeneutischen Diskussion beleuchtet werden. Dabei kann ich dem französischen Theologen Alfred Kuen nur zustimmen, wenn er angesichts dieser Diskussion schreibt: „Das vertiefte Studium einer unter Christen kontroversen Frage erzeugt Demut und Hochachtung für Andere“ (Kuen 1998, 18). Lakey mahnt dabei zur Geduld: „Eine angemessene hermeneutische Praxis schließt die geduldige Hingabe ein, Schwierigkeiten mit der Zeit zu lösen, während man dem Drang widersteht, zu voreiligen Schlussfolgerungen zu kommen, die die Heilige Schrift ‚retten‘, indem man sie zum Schweigen bringt“ (Lakey 2010, 5).
1.2 Das Spannungsfeld hermeneutischer Entscheidungen
Angesichts der beschriebenen „inspirierten Ambivalenz“ der Schriftstellen zur Rolle der Frau verwundert es nicht, dass im Zentrum der Diskussion hermeneutische Entscheidungen stehen, die allerdings nicht immer bewusst getroffen werden. Der amerikanische Theologe David M. Scholer, der sich 20 Jahre lang mit der Frage nach der Rolle der Frau im Neuen Testament beschäftigt hat, stellt dazu fest: „Auch in den hochgeachteten Kreisen der Evangelikalen sind es hermeneutische Fragestellungen, die letztlich unserem gemeinsamen Anliegen zu Grunde liegen“ (Scholer 1987, 407) und W. Liefeld erklärt: „Die Antworten, zu denen wir im Blick auf die Frau kommen…, sind unweigerlich beeinflusst von der Art und Weise, wie wir die Fragen stellen“ (Liefeld 1989, 127).19
1.2.1 Der gewählte Zugang zu den biblischen Aussagen
Der traditionelle Zugang zum Thema ist ein systematisch-theologischer, bei dem Aussagen der Schrift, die zur Rolle der Frau Stellung nehmen, in einem logischen System geordnet und analysiert werden (Conn 1984, 225), beginnend bei den entsprechenden Anweisungen in den Paulusbriefen. Diesen wird als „direkt anwendbaren Lehrtexten“ Priorität eingeräumt gegenüber „historischen Texten“ (Larkin 1988, 94). Dabei gilt das hermeneutische Prinzip, dass „klare Stellen“ zum Thema weniger klare Aussagen erhellen (Foh 1989, 71). Die konkreten Anweisungen des Apostels Paulus, zum Beispiel in 1. Timotheus 2,11–12 und 1. Korinther 14,34, gelten dabei als die „klarsten Stellen“ zum Thema (Knight III 1977, 45),20 wobei davon ausgegangen wird, dass sie, zumindest in ihren Grundlinien, zeitlos und nicht kulturell gebunden sind (Larkin 1988, 94; Foh 1989, 70). In ihrem Licht werden nun alle anderen Aussagen der Schrift über die Frau, insbesondere auch Genesis 1–3, interpretiert. Ergebnis dieser Verfahrensweise ist die Betonung einer durchgängig hierarchischen Geschlechterordnung als Schöpfungsordnung und leitendes biblisches Prinzip für die Beziehung zwischen Mann und Frau, wie sie unter anderen von den Vertretern des Council on Biblical Manhood and Womanhood (Piper und Grudem 1991)21 postuliert wird.
Dieser hermeneutische Zugang ist in den letzten Jahren vielfach grundsätzlich in Frage gestellt worden. So verwirft G. Bilezikian ihn generell als „hodgepodge“-Methode, die Bibeltexte wie eine Collage zusammenfüge (Bilezikian 1985, 18); G. Keener hinterfragt die Berechtigung des Auslegers, bestimmte Texte als „Lehrtexte“ über andere zu stellen (Keener 1993, 111); A. Mickelsen und W. Liefeld sehen in der Auswahl der paulinischen Anweisungen als Schlüsseltexte eine subjektive hermeneutische Entscheidung, die der ursprünglichen Absicht des Apostels bei ihrer Formulierung nicht gerecht werde (Liefeld 1989, 113; Mickelsen 1989, 117). Eine zunehmende Zahl von Auslegern bevorzugt deshalb einen biblisch-theologischen, ganzheitlichen Zugang zum Thema. Sie benutzen die fortschreitende Offenbarung der Schrift als hermeneutischen Bezugspunkt (Bilezikian 1985, 15–18) und achten besonders darauf, dass die Aussagen zur Frau sowohl in ihrem heilsgeschichtlichen als auch in ihrem kulturellen Kontext ausgelegt werden. Auf diese Weise soll die ursprüngliche Absicht der Texte möglichst genau erfasst werden, die G. Fee als „die einzig angemessene Kontrolle für hermeneutische Aussagen“ bezeichnet (Fee 1996, 26; 2005, 372). Dabei wird argumentiert, dass dieser Zugang dem Wesen der Schrift grundsätzlich mehr entspreche, die nicht ein „dogmatisches Handbuch“, sondern ein geschichtliches Buch sei (Conn 1984, 225). Dieser hermeneutische Ansatz führt, anders als der traditionelle, zu einer Betonung der Gleichrangigkeit von Mann und Frau als durchgehendes biblisches Prinzip, zurückgeführt auf die Schöpfung, die zwar durch den Sündenfall zerstört, aber durch die Erlösung in Christus wiederhergestellt worden ist. Die Anweisungen des Paulus werden dann als kultur- und zeitspezifische Anleitung für ein geordnetes Miteinander der Geschlechter auf dem Weg zu einer praktischen Gleichrangigkeit gesehen, die in ihren Prinzipien wegweisend sei für zukünftige Generationen (Longenecker 1984, 88).
Beim Vergleich der beiden hermeneutischen Ansätze wird besonders deutlich, dass „… Faktoren der Interpretation in der Methodik selbst stecken“, wie M. J. Erickson in seinem Lehrbuch der Dogmatik sagt (Erickson 1998, 70).
1.2.2 Die Zuordnung der biblischen Aussagen zu den Abschnitten der Heilsgeschichte
Da die Rolle der Frau in der Heiligen Schrift eng mit den grundlegenden „Konzepten“ (Bilezikian 1985, 15–17; Felker Jones 2017, 21–30) der Heilsgeschichte – Schöpfung, Sündenfall und Erlösung – verknüpft ist, beeinflusst die Zuordnung der entsprechenden biblischen Aussagen zu einzelnen Abschnitten der Heilsgeschichte das Ergebnis der Auslegung. So ist es nicht unbedeutend, ob man eine Unterordnung der Frau unter den Mann und eine dementsprechende Festlegung ihrer Stellung und Rolle in Ehe, Gesellschaft und Gemeinde als Schöpfungsordnung in Genesis 2 findet (Strauch 2001, 30; Neuer 1993, 66–67; Piper 1991, 35; Ortlund 1991, 98; Hamilton Jr. 2007, 32–52; Neuenhausen 2018, 40–44; Hardmeier 2013, 32–36),22 oder ob man diese aufgrund von Genesis 3,16 als Folge des Sündenfalls ansieht, die grundsätzlich bekämpft werden darf wie die Disteln und Dornen des verfluchten Ackers (Smith und Kern 2000, 42; Hess 2005, 79–95).23 Auch welche Texte ein Ausleger mit der Erlösung in Christus verbindet, beeinflusst seine Ergebnisse entscheidend: So ist es nicht gleichgültig, ob man aufgrund von Galater 3,28 davon ausgeht, dass das Erlösungswerk Christi an den Folgen des Sündenfalls für die Stellung der Frau etwas Grundsätzliches geändert hat, wie einige Ausleger dies tun (Spencer 1985, 26–42; Smith und Kern 2000, 22–25; Grenz und Kjesbo 1995, 99–107; Fee 2005, 172–185; Payne 2009, 79–104; Westfall 2016, 166–176; Felker Jones 2017, 24–30),24 oder ob man damit rechnet, dass Genesis 3,16 als „Notverordnung unter Sündenfallbedingungen“ (Martin Luther), als „Gesetz“ (Hempelmann 1997, 40–41.46) oder als Wiederherstellung der Schöpfungsordnung (Neuenhausen 2018, 42–43) weiterhin das Verhältnis zwischen Mann und Frau bestimmt und von der Erlösung in Christus nicht grundsätzlich berührt wird.
1.2.3 Die Wertung und Gewichtung einzelner biblischer Aussagen
Aus dem oben Gesagten lässt sich auch bereits erkennen, dass nicht nur die Einordnung von Schriftstellen an ihren heilsgeschichtlichen Ort, sondern auch ihre Gewichtung in der Gesamtschau das Ergebnis stark beeinflussen können. Es ist zum Beispiel ein wichtiger Unterschied, ob man 1. Korinther 11,8–9 als umfassende theologische Interpretation von Genesis 1 und 2 wertet (Strauch 2001, 30; Neuer 1993, 66; Piper 1991, 35), die Paulus auch in einer systematisch-theologischen Abhandlung zur Stellung der Frau so geschrieben hätte, oder als pointierte kurze, treffende Begründung seiner Argumentation im Rahmen einer spezifischen Anweisung an die Korinther (Keener 1992, 21–22.31; Fee 1996, 81–82).25 Ebenso bedeutend ist es, ob man bei Fragen nach dem Dienst der Frau in der Gemeinde die Aussage des Paulus in Galater 3,28 als klarste Stelle und grundsätzlichen Wegweiser wertet (Bruce 1982, 190; Groothuis 1997, 31–36, Fee 2005, 172–185) oder seine konkreten Anweisungen an die Korinther und Epheser (Piper 1991, 35; Neuer 1993, 107). Sogar innerhalb eines Abschnitts macht oft die Wertung einzelner Gedanken einen großen Unterschied: So betonen manche Autoren bei der Auslegung von 1. Korinther 11,13–16, dass Frauen in Korinth sehr wohl im Gottesdienst beten und weissagen durften und dabei lediglich ein Zeichen ihrer eigenen Autorität auf dem Kopf tragen sollten (Cunningham und Hamilton 2000, 177–179; Fee 2005, 142–160),26 von anderen dagegen wird die grundsätzliche Autoritätskette zwischen Mann und Frau als Schwerpunkt der Argumentation hervorgehoben (Neuer 1993, 104; Strauch 2001, 104–108)27 und das damalige Weissagen der Frauen im Gottesdienst als untergeordnete Bemerkung eingeordnet oder übergangen (Neuer 1993, 109; Strauch 2001, 104–112). D. Scholer mahnt diesbezüglich zu einer genuinen Ausgewogenheit (Scholer 1987, 416).
1.2.4 Die Unterscheidung zwischen überkulturell-normativen und kulturgebunden-deskriptiven Aussagen
Unter den bibelgläubigen konservativen Auslegern gibt es an dieser Stelle gleichzeitig eine grundsätzliche Übereinstimmung und eine unübersehbare Vielfalt der Meinungen im „exegetischen Bürgerkrieg“ um die Stellung der Frau: Übereinstimmung herrscht in der Einschätzung, dass die Heilige Schrift zur Rolle der Frau sowohl allgemein gültige, zeitlose als auch kultur- und zeitgebundene Aussagen enthält (Mickelsen 1989, 119) und dass es eine wichtige Aufgabe des Auslegers ist, zeitlose Wahrheiten von ihren kulturbezogenen Formen zu unterscheiden (Erickson 1998, 76). Die Vielfalt der Meinungen zeigt sich bei der konkreten Umsetzung dieser Aufgabe (Groothuis 1997, 41), und die Frage nach angemessenen hermeneutischen Leitlinien für diesen Prozess bewegt das theologische Denken unter Auslegern, die die Schrift als Autorität bewusst ernstnehmen, wie nie zuvor, ja ist zu einem „fundamentalen Anliegen der Hermeneutik“ geworden (Larkin 1988, 104–107).
Dies trifft in besonderer Weise auf die Anweisungen des Paulus zur Rolle der Frau in Ehe und Gemeinde zu. Im Spektrum der hermeneutischen Vorgehensweisen zu ihrer Auslegung steht auf der einen Seite die Auffassung, dass grundsätzlich alle Anweisungen, in denen nicht selbst eine Einschränkung formuliert ist, wörtlich übertragen und angewandt werden sollten (Foh 1989, 70).28 Folgt man dieser Auslegungsart, so führt das zu dem Ergebnis, dass die von Paulus betonte hierarchische Ordnung der Geschlechter mit der Unterordnung der Frau unter den Mann in Ehe und Gemeinde mitsamt ihren praktischen Konsequenzen für das Gemeindeleben bis hin zur geschlechtsspezifischen Kleiderordnung als zeitlos normativ festgelegt wird. Folgerichtig werden dann alle entsprechenden Anweisungen als „Frage von So spricht der Herr“ gesehen (Strauch 2001, 18), die schlichten und uneingeschränkten Gehorsam fordert und für weitere Diskussionen nicht offen steht. Gegen diese Sichtweise wird von anderen Auslegern vor allem die Schwierigkeit der Konsequenz in der Anwendung ins Feld geführt (Larkin 1988, 105; Johnston 1986, 35). In der Tat zeigt ein Blick auf verschiedene Auslegungen, dass die Grenzen der wörtlichen Anwendung sehr unterschiedlich gezogen werden. Die hauptsächliche Kritik an dieser Stelle richtet sich gegen die Willkürlichkeit und fehlende Konsistenz solcher Grenzziehung (Liefeld 1989, 129; Scholer 1986, 214; Westfall 2016, 206–207; Neuenhausen 2018, 17–19).
Auf der anderen Seite des hermeneutischen Spektrums unter „bibeltreuen“ Auslegern steht die Ansicht, dass Galater 3,28 die überkulturell und zeitlos gültige Aussage des Apostels Paulus zur erlösungsbedingten Beziehung zwischen Mann und Frau sei, die grundsätzlich eine Aufhebung aller sozialen Unterschiede zwischen ihnen impliziere (Longenecker 1984, 74–75; Smith und Kern 2000, 72–74; Johnston 1986, 31; Fee 2005, 172–185; Husbands 2007, 143–145). Alle spezifischen Anweisungen des Apostels an einzelne Gemeinden werden nun im Licht dieses Prinzips ausgelegt als praktische Anweisungen in einer konkreten Situation. Ergebnis einer solchen Auslegungsweise ist dann eine Betonung der grundsätzlichen Gleichrangigkeit zwischen Mann und Frau aufgrund der Erlösung. Die hierarchische Ordnung, die in den Anweisungen des Paulus zum Ausdruck kommt, wird als Spiegel der gesellschaftlichen Situation seiner Zeit gesehen, in die der Apostel sie hineingibt, ohne dabei sein grundsätzliches Anliegen der Gleichrangigkeit zwischen Mann und Frau preiszugeben.29 Der Haupteinwand gegen diese Art der Auslegung ist die Furcht vor einer Relativierung von biblischen Texten und infolgedessen der Unterminierung der Autorität der Heiligen Schrift (Liefeld 1989, 112).
Zwischen diesen beiden hermeneutischen Grundpositionen gibt es viele Zwischenstufen. Nach dem derzeitigen Stand der Diskussion scheint Susan Foh recht zu haben, wenn sie es für unwahrscheinlich hält, dass es unter den Auslegern zur „Frauenfrage“ je eine Einigung geben wird (Foh 1989, 162). Der Weg dorthin kann nur über ein weiteres ehrliches Ringen um „die ursprüngliche Absicht der Texte“ gehen, die „die einzig angemessene Kontrolle für hermeneutische Aussagen“ (Fee 1996, 26) darstellt.
1.3 Das Spannungsfeld theologischer Entscheidungen
Wie bereits angedeutet, stehen im Hintergrund der beschriebenen hermeneutischen Entscheidungen theologische Fragestellungen, die zum Teil sehr grundsätzlich in das Verständnis der Heiligen Schrift und ihrer Auslegung hineinreichen. Da die „Frauenfrage“ in manchen Kreisen geradezu als „Testfall“ angesehen wird, an dem das Verhältnis eines Auslegers zur Heiligen Schrift gemessen wird, hängt ihr diesbezüglich ein besonderes Gewicht an.30 Aber auch andere theologische Vorentscheidungen stehen im Hintergrund der Diskussion in dieser sensiblen Frage. Ein Blick auf diesen Hintergrund soll die Reichweite der Problematik aufzeigen.
1.3.1 Die Autorität der Heiligen Schrift bei der Auslegung ihrer Anweisungen
Hinter dem Ringen um den hermeneutischen Zugang zum umstrittenen Frauenthema steht bei vielen bibeltreuen evangelischen Theologen eine tiefe Sorge um die Unversehrtheit der „unabhängigen“ Autorität (McQuilkin 1984, 230) der Heiligen Schrift als Wort Gottes angesichts des zunehmenden kulturellen Relativismus in der Hermeneutik.31 Robertson McQuilkin brachte diese Sorge auf dem zweiten internationalen Kongress des International Council on Biblical Inerrancy 1982 in Chicago stellvertretend für viele zum Ausdruck (McQuilkin 1984, 219–240).32 Er stellte dabei die These auf, dass die volle Autorität der Schrift nur dann bewahrt bleibe, wenn jede Anweisung in ihr als universal gültig angesehen werde, solange die Schrift selbst sie nicht begrenze (McQuilkin 1984, 228). Dabei ist für ihn „the plain meaning“, also die offensichtliche, wörtliche Bedeutung eines Textes wegweisend (McQuilkin 1984, 221; Larkin 1988, 118). Eine entgegengesetzte Sorge äußerte Alan F. Johnson in seiner Antwort an McQuilkin, die ebenso stellvertretend für die Meinung einer großen Zahl bibeltreuer evangelischer Theologen steht (Johnson 1984, 257–282). Er verwarf die These McQuilkins als zu „reduktiv“ und nicht schriftgemäß. Aus seiner Sicht wird die Bedeutung eines Textes, entsprechend dem Wesen der Heiligen Schrift als Gottes Wort und Menschenwort, erleuchtet und mitbestimmt durch sein gesamtes literarisches, kulturelles und geschichtliches Umfeld. Die ursprüngliche Absicht des Textes könne dementsprechend nur im engen Zusammenhang mit diesem ermittelt werden. Er bezeichnete es seinerseits als Unterminierung der Autorität der Heiligen Schrift, wenn eine ihrer spezifischen Anweisungen an Glaubende in der Welt des Hellenismus im ersten Jahrhundert zu einem universal gültigen Prinzip erhoben werde und die Schrift deshalb in einem anderen Kontext an Glaubwürdigkeit und Relevanz verlöre (Johnson 1984, 277). In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Diskussion um die schriftgemäße Rolle der Frau, wenn es um die Auslegung der Anweisungen des Apostels Paulus geht.33 G. Fee und J. Stott weisen darauf hin, dass dieses Spannungsfeld dem Wesen der Heiligen Schrift entspreche und seinen Grund in der Beziehung zwischen ihrer Inspiration und Inkarnation habe. Beide warnen vor dem Versuch, diese Spannung nach der einen oder anderen Seite auflösen zu wollen (Fee 1990, 24–25; Stott 1981, viii).
Erweitert wird dieses Spannungsfeld noch durch die kontroverse missiologische Debatte um die Bedeutung, die im hermeneutischen Prozess der Zielkultur zukommt, in die hinein die Schrift ausgelegt wird. Diese Diskussion wird vor allem in missionsorientierten Kreisen seit dem Lausanner Kongress für Weltmission 1974 intensiv geführt (Stott 1981, vii). Während die meisten evangelischen Missionare die große Bedeutung erkennen, die das kulturelle Umfeld der Hörer für die Auslegung der Schrift, vor allem in ihren ethischen Anweisungen, hat und haben sollte (Kraft 1979; Padilla 1981, 65; Hiebert 1985, 54–55; Inch 1982, 18), wird gleichzeitig auch hier immer wieder auf die Gefahr der Relativierung der biblischen Botschaft durch kulturelle Elemente hingewiesen (McQuilkin 1984, 222–223; Nicholls 1979, 53–56). Für den Übersetzungsprozess des unveränderlichen Evangeliums in spezifische kulturelle Formen, die für die Hörer verständlich und relevant sind, hat sich der Begriff Kontextualisierung durchgesetzt.34
Da die Rollenverteilung von Mann und Frau ein Kulturmerkmal ist, wird jede Volksgruppe an dieser Stelle eigene Fragen an die biblischen Aussagen herantragen, die zum Beispiel in einer vorwiegend muslimischen Gesellschaft anders lauten werden als in einer westlich geprägten Kultur. Die Auslegung der Schrift zur „Frauenfrage“ ist also auch von diesem Ringen um die Treue zum Inhalt der Heiligen Schrift bei gleichzeitiger Relevanz in der Kultur der Hörer in besonderer Weise betroffen, das P. Hiebert so beschreibt: „Eine christliche Theologie hat einen Fuß in der biblischen Offenbarung und den anderen im historischen und kulturellen Kontext der Menschen, die die Botschaft hören“ (Hiebert 1985, 19). Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Frauenthematik auch im Rahmen der „Lausanner Konsultation“ 1978 in Willowbank/Bermudas zur theologischen Standortbestimmung über das Verhältnis von Evangelium und Kultur immer wieder präsent war (Kraft 1981, 228–229; Taber 1981, 90–91; Krass 1981, 251), obwohl man eine Diskussion dieses kontroversen Themenkomplexes dort bewusst ausgespart hatte (Willowbank Report 1981, 315).