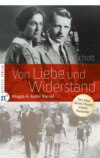Kitabı oku: «Von Liebe und Widerstand», sayfa 2
3
Angst
FLORENZ 1910–1911
Oscar Grilli di Cortona war ein Mann, der sein Herz nicht auf der Zunge trug. Vielleicht gehörte es nicht zu seinem Charakter und Temperament, Gefühle zu zeigen und zu benennen, vielleicht waren sie auch unter dem Panzer verschlossen, den die Erziehung in seinen Kreisen jedem jungen Mann um die Brust legte, damit er ein brauchbarer Offizier und würdevoller Repräsentant seines Standes wurde. Nur eine Regung seines Herzens blieb seiner Umwelt nicht verborgen: seine Liebe zu Elena Wissotzky Poggio, genannt Nelly. Nelly war die Liebe seines Lebens. Sie war es als Lebende, und sie blieb es als Tote. Daran änderte sich auch nichts, als Oscar noch einmal heiratete. Jahrelang hatte er der geballten Übermacht seiner Freunde und Ratgeber Widerstand geleistet. Ein Mann, zumal einer in seiner Stellung, müsse verheiratet sein, und so wie bisher gehe es einfach nicht weiter, fanden sie. Oscar hätte gerne so weitergelebt wie bisher, beruflich erfolgreich, privat jedoch einsam und zurückgezogen. Aber schließlich kapitulierte er und ließ sich nach neun Jahren als Witwer zu einer zweiten Ehe überreden.
Er wählte Marguerite, eine Italienerin, Katholikin, Florentinerin, nichts lag näher. Am 1. Dezember 1910 wurde Hochzeit gefeiert, anschließend bezog das Paar ein Haus in der Via Leone X°, nicht weit von der Fortezza – und übernahm Magda in den neu gegründeten Hausstand, jedenfalls für die Sonntage. Tatsächlich war die Zehnjährige für Marguerite so etwas wie eine Altlast ihres Gatten. Nicht, dass sie Kinder nicht gemocht hätte; sie wurde in der Folgezeit selbst Mutter von drei Kindern und war in dieser Rolle nicht unglücklich. Doch Magda war die wandelnde Erinnerung an die erste Ehe ihres Mannes und – weit wichtiger – an die große Liebe ihres Mannes. Dass diese Liebe fortbestand und fortbestehen würde, war Marguerite bald klar. Oscar trug ein Foto von Nelly im Portemonnaie, ihren Ring am kleinen Finger, eine Locke in einer Kette um seinen Hals … dieser Mann, der alles andere als ein Romantiker zu sein schien! Es wurde eine Ehe, die Magda später als Tragödie beschrieb. Marguerite war buchstäblich krank vor Eifersucht. Ihre finsteren Gefühle bezogen sich dabei auf Nelly wie auf Magda, auch wenn das Kind niemals einen sichtbaren Beweis väterlicher Zuwendung oder gar zärtlicher Gefühle erhielt. Und sie ließen im Lauf der vielen Jahre ihrer Ehe niemals nach. Marguerites ängstliches Wachen über ihren Mann machte wiederum Magda eifersüchtig – und konnte doch Oscars Bindung an Nelly nie aus der Welt schaffen. Auch als alter Mann las er noch die Briefe, die seine Verlobte ihm vor Jahrzehnten geschrieben hatte, mehr noch: Er schrieb sie alle von eigener Hand ab. Wieder und wieder versuchte er Nellys Unterschrift zu kopieren – wenigstens das letzte Wort sollte wie von ihr geschrieben aussehen. Nach seinem Tod gingen alle Briefe und das Medaillon mit der Locke in Magdas Besitz über.
Wer fast acht Jahre alt war, den hielt man in den besseren Florentiner Kreisen für alt genug, um das Haus zu verlassen und der höheren Bildung den notwendigen Tribut zu entrichten. Und so kam Magda in eine Internatsschule, die von deutschen Diakonissen geleitet wurde, das Istituto delle Diaconesse di Via Santa Monica auf der anderen Seite des Arno. Die aus der Nähe von Düsseldorf stammenden Kaiserswerther Schwestern hatten im Jahr 1860 ein »Lehr- und Erziehungshaus« gegründet, in dem sie toskanischen Kindern – Florenz gehörte noch nicht zum Vereinigten Italien – eine elementare Schulbildung vergleichbar den heutigen Grundschuljahren boten. Sie endete mit einer Prüfung an einer staatlichen Schule, und für die meisten der Schüler war die Schullaufbahn damit auch schon abgeschlossen.
Als Magda 1909 hier Schülerin wurde, waren fast alle Diakonissen alt, einige kannten sogar Magdas Großmutter, Nonna Grilli, noch als Schülerin. Magda war die Jüngste der Elevinnen, und ihr Bett im großen Schlafsaal war so hoch, dass sie mit Anlauf hineinspringen musste. Am Morgen musste dieses Bett sorgsam gemacht werden und durfte keinesfalls an den Kanten Betttuch-»Würstchen« aufweisen. (Das deutsche Wort »Würstchen« vergaß Magda nie wieder.) Jeden Donnerstagabend durften die Kinder Besuch empfangen, und zwar im kühlen, dunklen »Saal der Kaiser«, deren Porträts streng von den Wänden blickten. – »Vielleicht bin ich deshalb Republikanerin geworden?«, notierte Magda später.
Immer zuverlässig und pünktlich erschien hier donnerstags Grand-Maman, erkundigte sich nach diesem und jenem und vertröstete das heimwehkranke, unglückliche Kind dann auf den Sonntag, an dem sie sich wiedersehen würden – vorausgesetzt, Magda verhielte sich bis dahin tadellos. Am Sonntag nicht nach Hause zu dürfen, war die übliche Strafe für unerlaubtes Verhalten.
Aber auch der Sonntag begann erst einmal bei den Diakonissen, denn es war Grand-Maman, die zur Sonntagschule ins Internat kam, um den Gesang der Kinder auf dem Harmonium zu begleiten.
Damit war die sonntägliche Pflicht jedoch noch längst nicht abgearbeitet. Nach der Sonntagschule ging es nämlich keineswegs gleich zum Mittagessen in Papas Haus. Erst besuchte Grand-Maman zusammen mit der Enkelin den Gottesdienst der sogenannten Schweizer Kirche, der Waldensergemeinde, in der die beiden nahezu eine Stunde lang einer französischen Predigt lauschten beziehungsweise deren Ende herbeisehnten. Spätestens jetzt wurde Magda unruhig, denn sie wusste, dass die Zeit drängte: Zum Abendessen musste sie wieder im Internat sein. Schon bald nach dem Essen mit Papa und Marguerite »überkam mich ein Gefühl, als würde sich mein Herz zusammenziehen, meine Hände fühlten sich kalt an und verkrampften sich. Gleich musste ich zurück in die enge Gasse Santa Monica!«, schrieb sie später.
»Denk am Dienstag an mich«, sagte Grand-Maman, wenn sie Magda gegen Abend zurückbrachte, »dann bin ich ganz in deiner Nähe«.
Einmal in der Woche verteilte Grand-Maman Lebertran an die Kinder des angrenzenden Armenviertels San Frediano. Es war eine wohltätige Aktion der Heilsarmee – wie gerne wäre Magda eins der armen Kinder gewesen, die in Grand-Mamans Nähe sein durften! Stattdessen saß sie in einem finsteren Palazzo und dachte intensiv an ihre Großmutter, die nur einige Schritte entfernt war, ohne dass sie das Recht hatten, einander zu sehen.
Das Istituto delle Diaconesse war eine protestantische Insel im katholischen Florenz. Wer sein Kind nicht »tiefkatholisch« erziehen lassen wollte, hatte nicht gerade die Wahl. Oscar hatte eine englische Großmutter und gehörte deshalb zur Anglikanischen Kirche. Grand-Maman war in der russisch-orthodoxen Kirche aufgewachsen, dann aber in Italien evangelisch geworden und gehörte zur Waldenserkirche. Der Pfarrer der Waldensergemeinde war es auch, der Nelly beerdigt und nach der Beerdigung gefragt hatte: »Ist das Neugeborene eigentlich schon getauft?« Natürlich hatte niemand bei all der Sorge um die schwerkranke Mutter an eine Taufe des Kindes gedacht, also taufte der Pfarrer Magda noch am Tag der Beerdigung, so dass Magda nun auch Protestantin war.
Nicht so wie die anderen zu sein, gehörte für Magda zu den grundlegenden, prägenden Erfahrungen ihres Lebens. Nicht wie das Volk, sondern adelig, nicht wie alle anderen katholisch, sondern protestantisch, nicht nur aus einer Florentiner Familie, sondern auch aus einer russischen – all das machte aus ihr etwas Besonderes, legte aber auch eine schwere Last auf die kindlichen Schultern. Das Leben der Florentiner Normalbürger schien ihr keineswegs uninteressant oder gar minderwertig zu sein, sondern gerade, weil sie es kaum kannte, oft geheimnisvoll und voller wundersamer Möglichkeiten.
Da war zum Beispiel das Gebet für die Toten: »Ada Gay (eine Mitschülerin, die beide Eltern verloren hatte) und ich hatten während der Zeit bei den Diakonissen entdeckt, dass es ein Gebet für die Toten gab. Die Toten kamen entweder in die Hölle oder ins Paradies, meistens jedoch ins Fegefeuer. Dieses Gebet konnte ihnen helfen, aus dem unbequemen Ort zu Gott aufzusteigen. Was für ein Glück! Jetzt konnten wir unseren Mamans helfen, in den Himmel zu kommen! Wir waren nicht katholisch, aber wir rezitierten doch einen Teil des Gebets in einem selbsterdachten Fantasie-Latein.«
Bald darauf hörte Magda, dass alle Protestanten für die Hölle bestimmt seien. War Maman also doch nicht im Fegefeuer, und konnten die Gebete ihrer Tochter gar nichts mehr bewirken? Magda erkundigte sich und erfuhr, dass diejenigen, die in ihrem Erdenleben niemals Die Wahrheit (Mit großem D) gehört hätten, doch ins Fegefeuer und nicht direkt in die Hölle kämen. Hatte ihre Mutter Die (katholische) Wahrheit gehört? Magda wollte lieber gar nicht darüber nachdenken.
Neben der tröstlichen Einrichtung des Fegefeuers hatten die Katholiken auch Feiertage, die den Protestanten nicht vergönnt waren. Bei den Diakonissen waren die ganz im deutschen Stil gefeierten und von den Kindern geliebten Nikolaus- und Weihnachtsfeste die Höhepunkte des Jahres. Am 15. August dagegen – an Mariä Himmelfahrt – musste Magda mit Grand-Maman mitten in den Ferien und in der größten Hitze für die Schule lernen. Dabei gefiel ihr dieses Fest ganz besonders, auch wenn sie wusste: Für die Evangelischen ist Jesus in den Himmel aufgestiegen, für die Katholischen tat es die Jungfrau Maria.
»Sie schien mir sehr anziehend, diese Jungfrau Maria! Ein Kind auf dem Arm haltend, lächelte sie. Sie war eine Mutter. Sie war interessanter als Jesus. Mir fehlte eine Mutter und nicht ein Mann, ein Jesus am Kreuz mit schrecklichen Wunden. In den katholischen Kirchen waren auch viele dieser blutenden Gekreuzigten zu sehen, aber der kleine Jesus auf dem Arm seiner Mutter, das war gut, das war schön, das war so sanft. Die Jungfrau, die Mutter zertrat mit ihren kleinen Füßen aus rosa Wachs eine Schlange. Die Schlange war schrecklich, Angst einflößend und gefährlich, aber die Mutter von Jesus trat das Böse tot, zwang seinen Kopf in den Staub. Das gefiel mir!
Die evangelischen Kirchen waren trist und streng, die katholischen Kirchen waren schön, bunt, vergoldet, voller leuchtender Kerzen. Da gab es Blumen, die gut dufteten, und Weihrauch, der den Geruch der Kirche bestimmte, auch wenn kein Gottesdienst war, ein geheimnisvoller Duft, den es nirgendwo sonst gab. Reichte das aus, um katholisch werden zu wollen? Die Angst vor der Hölle und die Schönheit der Kirchen – war das Grund genug?«
Marguerite, der katholischen Stiefmutter, war Magdas Zuneigung zu allem Katholischen jedenfalls sehr recht, und sie war es auch, die dafür sorgte, dass Magda nach dem Abschluss bei den Diakonissen in das Istituto Frascani Signorini kam, eine katholische Privatschule. Und tatsächlich reifte in Magda der Wunsch, wie alle anderen Kinder die Kommunion zu feiern, ein weißes Kleid zu tragen, einfach richtig dazuzugehören. Zu Hause, wenn man denn Papas Wohnung ein Zuhause nennen konnte, gehörte sie weniger denn je dazu. Marcella, die erste Halbschwester, war geboren, und die Amme und das Baby hatten Magdas Zimmer übernommen. In ihrem neuen Zimmer, einem kleinen, dunklen Raum am Ende des Flures, der zum Hof hin führte, stand Magda noch größere Ängste aus als die, unter denen sie ohnehin von klein an gelitten hatte.
»Die Angst nahm zu. Nachts lag ich lange Stunden mit weit geöffneten Augen auf dem Rücken, weil ich sowohl die rechte als auch die linke Seite meines Bettes überwachen musste. Ich wünschte mir so, das Bett würde wenigstens mit einer Seite an der Wand stehen, dann hätte ich mich auf die Seite legen und etwas entspannen können, weil ich nur noch eine Seite zu überwachen gehabt hätte. Aber nein, das ginge wegen des Putzens nicht, sagte man mir, und überhaupt sei das alles Blödsinn.
Ich hatte zwei elektrische Drähte am Bett festgemacht, einen, der zum Licht führte, und einen, der zur Klingel führte, mit der man damals ›la Bonne‹ herbeirief. Im Dunkeln machte ich mir Sorgen: Waren die beiden Drähte noch an ihrem Platz? Ich musste noch einmal nachgucken, und beim Nachgucken lösten sich die Drähte, also musste ich sie wiederfinden, nehmen und neu festmachen.
Als ich klein gewesen war, hatte ich mir gesagt: ›Ich habe Angst, aber jetzt schläft die Gouvernante neben mir, und später wird mein Ehemann neben mir schlafen.‹ Doch wie viele unruhige, schreckliche Nächte lagen zwischen der Gouvernante und dem Ehemann!
In manchen Nächten, den schlimmsten, stand ich auf und ging, den Rücken immer an der Wand, bis zur Toilette. Dabei musste ich das Stück Wand rechts und links und den Raum vor mir beobachten. Was gab es da zu beobachten? Genau das war das Problem, diese Angst vor allem und vor nichts, die Angst vor dem Unerklärlichen.«
Ob ein Wechsel zum katholischen Glauben diese Ängste aus der Welt schaffen konnte? Magda hoffte es. Grand-Maman sagte angesichts all der Konflikte, die es in der Familie ohnehin schon gab, lieber nichts dazu. Und Papa Oscar hielt es, wenn er es genau bedachte, eigentlich für eine gute Idee: Eine katholische Tochter war sicher leichter zu verheiraten.
4
Dazugehören
FLORENZ 1911–1918
Wann beginnt der spirituelle Weg eines Menschen, seine »geistliche Biografie«? Und wodurch wird sie bestimmt? Durch den Ort der Geburt, durch Familie, Erziehung, Begegnungen, Zufälle – oder vielleicht sogar durch das göttliche Eingreifen selbst?
Dass eine Zehn- oder Zwölfjährige ein ausgeprägtes Gespür für Spirituelles hat, hält auch ein moderner Leser für gut möglich. Dass sie ihren Weg in Sachen Glaube und Kirche selbst bestimmt, war vor hundert Jahren genauso erstaunlich, wie es uns heute erscheint. Vielleicht war Magda ein besonders intelligentes Kind, ein vielseitig interessiertes, auch sensibles. Vor allem aber war sie ein verlassenes und verzweifeltes Kind.
Nun also wollte und sollte sie von der »Irrlehre« zur »Wahrheit« vordringen, wie Padre Magri es ausdrückte. Der Pater, der mit der Führung der jungen Seele betraut wurde, war nicht irgendein Priester aus der Nachbarschaft, er war ein angesehener Theologe und zugleich berühmter Kommentator von Dantes Göttlicher Komödie. Ausgerechnet der Pastor der Waldensergemeinde, zu der Grand-Maman gehörte, hatte Padre Magri für diese Aufgabe vorgeschlagen. Er, der selbst ein intellektueller Kopf und Theologieprofessor war, wollte wohl auf keinen Fall konfessionell beschränkt wirken. Magdas Wunsch sollte, so befand der für die damaligen Verhältnisse ungemein tolerante evangelische Pastor, mit einer soliden theologischen Bildung durch die »Gegenseite« beantwortet werden. Was dieses Kind wirklich umtrieb, seine Sehnsucht und seine Ängste, sah er ebenso wenig wie alle anderen.
Nicht nur der Lehrer, auch der Ort der Lehre war nicht irgendeiner, sondern ein ganz besonderer. Or San Michele ist vermutlich die ungewöhnlichste Kirche von Florenz. Wo Römer in antiker Zeit die Göttin Isis anbeteten, traf man sich Jahrhunderte später zum Getreidemarkt. Als die Pest das mittelalterliche Florenz bedrohte, flehten die Menschen hier zum heiligen Michael, dessen Statue auf dem Platz stand. Wenn sie dann wirklich verschont worden waren, spendeten sie seinen Vertretern auf Erden, den Michaelbrüdern, so reichlich, dass diese aus dem bis dahin lediglich überdachten Markt eine mit großer Kunst ausgestattete Kirche machten. Auch wer heute mitten in der Stadt vor dem rechteckigen Gebäude ohne Turm steht, erkennt erst beim genauen Hinsehen, dass es sich um eine Kirche handelt.
An diesem Ort voller Historie, umgeben von prächtigen Kunstschätzen, sollte Magda also ihre religiöse Umschulung erleben. Grand-Maman bat darum, dabei sein zu dürfen. Padre Magri lehnte ab. Katholische Lehre unter russisch-orthodox-waldensischer Aufsicht schien ihm das Ganze dann doch zu kompliziert zu machen.
Statt im hellen Kirchenraum fand der Unterricht in einer düsteren, kleinen Sakristei statt. Der feuchte Raum roch muffig, etwas säuerlich, und Padre Magri ergänzte dieses Aroma abwechselnd durch den Duft von Schnupftabak und Pfefferminzbonbons. Der große, gut aussehende Pater sprach freundlich und höflich mit seiner Schülerin, unterbrochen nur von heftigen Niesattacken, wenn der Tabak wirkte. Dann nahm der Pater das große Taschentuch in seine großen Hände und putzte lautstark seine große Nase. Magda machte das alles Angst. Noch mehr Angst.
In diesem düsteren Ort fand auch Magdas erste Beichte statt, eine sogenannte Ohrenbeichte, also ein Sündenbekenntnis im Beichtstuhl, bei dem man den anderen nur hört und nicht sieht. »Und damit begann die Zeit meiner Skrupel«, schrieb sie im Rückblick. »Wie macht man alles richtig und gut? Wirklich gut? Wo ist die Grenze zwischen dem Guten und dem Bösen? Unglaublich, wie viele Sünden es gab! Welche davon hatte ich tatsächlich begangen?«
Die Familie bereitete schon das Fest zur Erstkommunion vor, als ein unerwartetes Hindernis auftauchte. Magda sollte »nicht mit dem gemeinen Volk«, sondern in einer vom Florentiner Erzbischof selbst zelebrierten Messe das heilige Sakrament empfangen. Sowohl Padre Magri als auch der Erzbischof hielten Magda für gut präpariert – da kamen einem einfachen Priester, der an der Vorbereitung der Messe mitwirkte, Zweifel: War dieses Mädchen überhaupt gültig getauft? Grundsätzlich galt die evangelische Taufe als gültig, aber wer konnte denn belegen, dass Magda auch mit reinem Wasser getauft worden war und – nur zum Beispiel – nicht mit Rosenwasser? Das konnte tatsächlich niemand nachweisen. Und so wurde Magda am Vorabend ihrer Erstkommunion noch einmal getauft, diesmal »sub conditione«, sozusagen für alle Fälle. Und tatsächlich sagte der Priester (natürlich auf Latein): »Für den Fall, dass du nicht getauft bist, taufe ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.« Und damit diese Taufe nicht auch irgendwann für ungültig erklärt werden konnte, musste Magda zuvor und ebenfalls auf Latein ihrem alten Glauben abschwören: »Renuntio!« Wem oder was genau schwor sie da ab? Sie hätte es nicht sagen können, aber der Klang dieses feierlichen und irgendwie unheimlichen Wortes blieb ihr ein Leben lang im Ohr. »Renuntio!«
Am nächsten Morgen empfing Magda ihre erste heilige Kommunion. Jedoch nicht in Or San Michele, sondern an einem noch exklusiveren, intimeren Ort: in der Privatkapelle des erzbischöflichen Palastes. Eine Nacht voller Ängste war der Feier vorausgegangen. Immer wieder hatte Magda Sünden bekannt, alle Sünden, die sie im Unterricht gelernt hatte, lässliche und Todsünden. »Wenn man mehr als fünf Lire stiehlt, ist das eine Todsünde!«, hatte ein Kind ihr erzählt. Sie hatte zwar noch nie etwas gestohlen, aber es gab ja auch Sünden, die man selber gar nicht bemerkt hatte! Kindersünden und Erwachsenensünden ging sie durch, auch wenn sie bei Letzteren nicht immer wusste, was die Worte bedeuteten, die sie beschrieben. Und dann stellte sie sich noch einmal den Moment vor, in dem der Bischof ihr die Hostie auf die Zunge legen würde. Sie durfte sie auf keinen Fall mit den Zähnen berühren und zerbeißen. Die Hostie war doch Jesus selbst, und sie durfte Jesus nicht in Stücke teilen! Mit einer ungeweihten Hostie hatten sie es geübt. Aber was, wenn es ihr jetzt doch passierte?
Der Morgen kam, die Messe begann, und auch der gefürchtete Moment rückte näher. Jetzt legte der Bischof Magda die Hostie auf die Zunge; ein Tuch unter ihrem Kinn sollte für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich ein Krümel löste, verhindern, dass er zu Boden fiel. Es ging alles gut, die geweihte Hostie war leicht unzerkaut zu schlucken. »Aber … ich spürte nichts. Gar nichts. Der Himmel öffnete sich nicht. Kein Schauer durchfuhr meinen Körper. Mein Geist blieb, wie er war, unruhig, voller Erwartung … enttäuscht. Und jetzt? – Jetzt? Nichts.«
Ein ganz normales, katholisches Mädchen zu sein, keine Angst mehr vor der Hölle haben zu müssen und nicht über den anderen zu stehen, sondern einfach dazuzugehören, das war Magdas Wunsch. Bald nach ihrer Erstkommunion zog ihr Vater mit seiner neuen Familie nach Verona. Magda blieb in Florenz und kam mit dem Schuljahrsbeginn 1914 in ein Internat. Es war die Klosterschule der Mantellate, der Dominikanerinnen des »dritten Ordens«, die ihren Namen den langen schwarzen Umhängen verdankten, an denen man sie erkannte. Hier nun war Magda endlich Katholikin unter Katholikinnen und betete viele Stunden lang das »Ave Maria«, das »Pater Noster« und das »Gloria Patris« – allerdings nicht als Frömmigkeits-, sondern als Bußübung. Ihr Beichtvater war streng, und Magda war noch strenger mit sich selbst. Während ihre Klassenkameradinnen aus dem Beichtstuhl kamen, schnell etwas murmelten und die Kirche sündenfrei, erleichtert und sorglos verließen, quälte sich Magda Tag und Nacht mit grüblerischen Gedanken: Gab es Sünden, die sie nicht gebeichtet hatte? Sollte sie das letzte Gebet lieber noch einmal wiederholen? Sie hatte sich versprochen, und jetzt war es sicher nicht gültig.
Als Konvertitin hatte sie eine besondere Gnade erfahren, jetzt musste sie sich ihrer würdig erweisen, so jedenfalls empfand sie es. Magda war also wieder anders als die anderen, keine schon immer Erwählte, sondern eine zum rechten Weg Bekehrte, die dankbar sein musste.
Doch schon bald drängte sich ein ganz anderes Thema in den Vordergrund. Der Sommer 1914, der Europa verändern sollte, begann für Magda mit einer vielversprechenden, aufregenden Reise: Endlich würde sie den geheimnisvollen Unbekannten, ihren Großvater Vladimir Wissotzky kennenlernen! Der lebte inzwischen nicht mehr »im tiefen Russland«, sondern in Wirballen, einer wichtigen Zollstation an der deutsch-russischen Grenze, die heute die Grenze zwischen Litauen und Russland ist. Grand-Papa war als General und Chef des Zolls hier stationiert. Grand-Maman machte sich mit ihren drei Enkelinnen – Lalli, Lallis Schwester Dudy und Magda – auf die Reise über die Alpen und dann vom äußersten Süden in den äußersten Norden Deutschland. Es war eine schier endlos lange Zugreise, und sie bot der Großmutter Zeit genug, um den Kindern zu erklären, weshalb sie den sagenumwobenen Grand-Papa noch nie gesehen hatten. Als Immigranten hatten Grand-Maman und er mit drei kleinen Kindern erst in Genf und dann in Florenz gelebt, erzählte die Großmutter. Aber während sie selbst sich an das neue Leben schnell gewöhnte, als Russisch- und Französischlehrerin Geld verdiente und andere Immigranten in Pension nahm, blieb Grand-Papa ein Fremder. Er habe nicht begriffen, erzählte Grand-Maman, dass adelig zu sein allein noch kein Beruf ist, ja, schlimmer noch, dass sie beide zwar aus bester Familie kamen, nun aber unbekannt und finanziell schlecht gestellt waren. »Er war unglücklich. Er gab Geld aus, das er nicht besaß … Ja, und dann beschloss er eines Tages, in unsere alte Heimat zurückzukehren«, beendete Grand-Maman ihre Erzählung mit einem Seufzer.
Sie hatte ihn ziehen lassen und fortan ein weit ruhigeres Leben geführt. Nun würde sie ihn wiedersehen, mit drei Enkelkindern an der Hand, von denen er nur aus Briefen wusste.
Der Empfang bei Grand-Papa war eine beeindruckende Inszenierung. In Magdas Memoiren finden sich dennoch nur wenige Zeilen dazu, weil das, was dieser Begegnung folgte, den Eindruck offensichtlich gleich wieder überlagerte. Dabei hätte die Uniform des Generals es mit der des italienischen Königs aufnehmen können, genauer noch: sie übertraf die des Königs. Denn nachdem der Großvater die angereisten jungen Damen mit Handkuss begrüßt hatte, erklärte er, dass er die Orden und Abzeichen, die ihm verliehen worden waren, leider nur im Wechsel tragen könne, weil sie nicht alle gleichzeitig auf seiner Brust Platz hätten. Und dann zeigte Grand-Papa seine goldene Uhr, die ihm vom Zar selbst überreicht worden war! Doch um die kleine Reisegesellschaft weiter zu beeindrucken, blieb wenig Zeit – die Nachricht vom Ausbruch des Krieges erreichte Wirballen. Grand-Maman und ihre Schutzbefohlenen machten sich unverzüglich auf den Rückweg. Wenn die umsichtige Großmutter nicht zufällig einige Österreichische Kronen im Gepäck gehabt hätte, die sie am Berliner Bahnhof vorzeigen konnte, wären sie wohl schon in Berlin an der Weiterreise gehindert worden. So aber gelangten sie über Österreich nach Lindau, von dort über den Bodensee in die Schweiz und zurück nach Florenz.
Eine weite Reise war zu Ende, und nicht nur das: Die Zeit des Reisens, die für Magda gerade erst hätte beginnen sollen, war damit auch schon vorbei. Der Krieg machte die Grenzen unüberwindlich, und das Internat der Mantellate, das mit seinen hohen Mauern ohnehin wie eine Festung aussah, wurde für Magda zu einem Ort, an dem sie sich vier Jahre wie eine Gefangene fühlte. Dreimal im Jahr hatte sie das Recht, elterlichen Besuch zu bekommen, doch selbst zu diesen seltenen Terminen kam Oscar, ihr Vater, nur unregelmäßig. Hatte er – vielleicht gerade während des Kriegs – andere Sorgen? Sollte er seine älteste Tochter wirklich so gut wie vergessen haben? Oder warf er ihr – bewusst oder unbewusst – tatsächlich vor, seine über alles geliebte erste Frau umgebracht zu haben? Viele Gedanken um Magda kann er sich jedenfalls nicht gemacht haben, denn die Jahre, die sie bei den Mantellate eingeschlossen, unterfordert und gelangweilt absaß, wurden durch ein Jahr zur Vorbereitung auf ein Leben als Dame ergänzt: Auf der Haushaltsschule für höhere Töchter lernte Magda, wie man Spitze bügelt, dazu die lateinischen Namen aller Pflanzen, die als Tischdekoration dienen können. Auf die Idee, dass diese Jugendliche ganz andere Interessen haben könnte und auf einem Lyzeum, dem damaligen Mädchengymnasium, viel besser aufgehoben und endlich auch intellektuell gefordert worden wäre, kam weder Oscar noch sonst jemand.
Fünf Jahre lang fühlte sich Magda wie abgestellt. Was sie lernen sollte, interessierte sie nicht, und was sie interessierte, ließ man sie nicht lernen. Dazu kam das Leben der Internatsschülerinnen, das wie in einem Internierungslager organisiert war. Und doch lernte Magda in diesen Jahren Entscheidendes: Sie lernte, aus der ängstlich-depressiven Haltung ihrer Kinderjahre herauszufinden. Magda wurde erst frech und dann froh.
Vielleicht begann alles mit einem samstäglichen Gang zur Beichte.
»Hochwürden, ich möchte nicht beichten«, begann Magda ihre »Beichte«.
Der Pater auf der anderen Seite des »Fensters«, unsichtbar gemacht durch einen Vorhang aus schwerem, rotem Stoff, blieb einen kurzen Moment stumm.
»Wa…, warum?« In seiner Stimme schwang eine Mischung aus Überraschung und Empörung.
»Weil ich nicht daran glaube«, sagte Magda und wollte schon aufstehen.
»Warte!«, bat sie der Beichtvater. »Bleib noch einen Moment sitzen. Ich möchte nicht, dass die anderen sehen, dass du nicht … Du verstehst schon, das wäre kein gutes Vorbild für die anderen.«
»Wollen Sie mich zum Lügen auffordern?« Jetzt war Magda die Empörte. »Meinen Klassenkameradinnen brauche ich nichts vorzumachen. Denen hab ich schon gesagt, dass ich nicht mehr beichte. Wegen so was werde ich doch nicht lügen!«
»Ich regte mich auf, dabei machte der arme Priester doch nur seine Arbeit«, notierte Magda später. »Er wollte die Seelen meiner Mitschülerinnen retten. Ich sollte sie nicht anstecken! Er tat, was er konnte, und mir bereitete es eine boshafte Freude, ihn wie die Fliege im Netz der Spinne zappeln zu sehen. – Eine Diktatur ist immer gefährdet, egal ob sie sich auf politische oder religiöse Ideen stützt.«
Dass Magda sich wieder der evangelischen Kirche annäherte, sich »heimlich« zu Gesprächen mit dem Waldenserpastor traf und schließlich auch offiziell aus der katholischen Kirche austrat, das alles erlebte Grand-Maman nicht mehr. Dabei zahlte Magda noch Jahre nach deren Tod ihren Mitgliederbeitrag weiter. Sie wollte, dass der Name Varia Wissotzky auf der Gemeindeliste blieb – und sie selbst anonym. »Freiheit, Freiheit – nach all diesen Schwierigkeiten!«, notierte sie.
»Der Beginn meines Lebens war, was die Religion betrifft, bizarr. Orthodox? Protestantisch? Katholisch? Ohne Religion? – Die Zukunft würde darüber entscheiden.«
Doch wohin sie sich auch wenden würde: Niemals würde »Mutter Kirche« die Mutter ersetzen, die Magda niemals kennengelernt hatte.