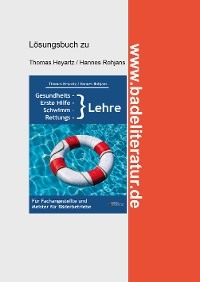Kitabı oku: «Gesundheits-, Erste Hilfe-, Schwimm- und Rettungslehre Lösungsbuch», sayfa 2
www.badeliteratur.de

Gesundheitslehre und Erste Hilfe
8
Wirbelsäule. Sie gleicht wie ein Wasserkissen die Druckunterschiede aus, die entstehen, wenn zwei Wirbel gegeneinander bewegt werden.
Knochen profitieren von Muskeltraining: Sie werden dichter und stabiler. Muskeltraining schützt daher vor Knochenschwund (Osteoporose). Eine kräftige Muskulatur an Rücken, Brust und Schulterblatt unterstützt und sta-bilisiert zudem die Wirbelsäule und beugt Rückenschmerzen vor.
Scharniergelenk: Gelenkfläche in Rollenform mit entsprechender gegen-überliegender Gelenkfläche. Beispiele: Finger und Zehenglieder, Ellenbo-gen, Knie, oberes Sprunggelenk.
Eigelenk: eiförmiger Gelenkkopf mit Gelenkpfanne. Beispiel: Handgelenk zwischen Speiche und Handwurzelknochen.
Sattelgelenk Gelenkflächen ähneln einem Reitsattel. Beispiel: Grundge-lenk des Daumens (Daumenwurzelgelenk).
Kugelgelenk kugelförmiges Gelenk mit Gelenkpfanne. Beispiele: Schul-ter- und Hüftgelenk.
Etc.
Stabilisierung des Gelenks. Verhinderung einer Luxation (Auskugelung).
Das Zwerchfell
Merkmale der Skelettmuskelatur:
Vorkommen: Skelett
Willentlich beeinflussbar: Ja
Innervation: Motorisch
Ermüdbarkeit: Schnell
Krämpfe: Ja
Für jeden Muskel existiert ein Gegenspieler. Er macht die ausgeführte Be-wegung wieder rückgängig. Beispiel: Der Bizepsmuskel beugt das Ellenbo-gengelenk, der Trizepsmuskel als dessen Gegenspieler streckt es wieder.
Skelettmuskulatur (oder quergestreifte Muskulatur), Herzmuskulatur, glatte Muskulatur.
Die Skelettmuskulatur. Einen akuten nächtlichen Krampf löst am besten eine starke Dehnung, indem der Betroffene an dem Muskel zieht, bzw. zie-hen lässt. Manchmal hilft es auch, den Muskel zu massieren und so wieder zu lockern, oder ihn mit einem warmen Wasserguss in der Dusche zu ent-krampfen. Ständige, chronische Muskelkrämpfe sollten medizinisch abge-klärt werden.
Übungsfragen
www.badeliteratur.de
Gesundheitslehre und Erste Hilfe

9
Der Herzmuskel ist nicht ermüdbar und autonom gesteuert (d.h. kann nicht vom Willen gesteuert werden). Die Anpassung an Belastungen erfolgt daher ausdauernd und umgehend.
Herzklappen sind Ventile. Sie sorgen dafür, dass das Blut nur in eine Rich-tung transportiert wird.
Herzkranzgefäße nennt man die ersten Abgänge aus der Aorta. Sie ver-sorgen das Herz mit Blut und somit mit Sauerstoff. Ein Verschluss führt zum Absterben des Gewebes (Herzmuskulatur) in dem Areal, das durch das Herzkranzgefäß versorgt wird. Dieses Ereignis nennt man Herzinfarkt.
Die Herzschlagphase und die Erschlaffungsphase (Systole und Diastole). Unter der Diastole versteht man die Entspannungs- bzw. Erschlaffungspha-se eines Hohlorgans, im engeren Sinne die Dilatationsphase des Herzmus-kels. Unter der Systole versteht man die Kontraktionsphase eines Hohlor-gans, im engeren Sinne die Kontraktionsphase des Herzmuskels.
Wichtige Stichpunkte des Referates: Sinusknoten, AV-Knoten, HIS-Bündel, Tawara Schenkel, Purkinje Fasern, Frequenzen, Überleitungszeiten. Zei-gen Sie Videos und Lehrfilme aus dem Internet.
Arterien sind Gefäße, die das Blut in Richtung vom Herzen weg transpor-tieren. Venen sind Gefäße, die das Blut in Richtung zum Herzen hin trans-portieren.
Aorta g Große Körperarterien (Kopf oder Rumpf) g Arterien g Arteriolen g arterieller Schenkel des Kapillarsystems (Sauerstoffabgabe) g venöser Schenkel des Kapillarsystems (Kohlendioxidaufnahme) g Venolen g Ve-nen g Vena cava inferior oder superior (untere oder obere Hohlvene) g rechter Vorhof des Herzens g rechte Herzkammer g Arteria pulmonalis (Lungenarterie) g Lungenarterien g Lungenarteriolen g arterieller Schen-kel der Lungenkapillaren (Kohlendioxidabgabe) g venöser Schenkel der Lungenkapillaren (Sauerstoffaufnahme) g Pulmonalvenen g linker Vorhof des Herzens g linke Herzkammer g Aorta.
Sauerstoffarmes, venöses Blut.
Die Erythrozyten (rote Blutkörperchen). Der Sauerstoff ist an das Molekül „Hämoglobin“ gebunden.
Rote Blutkörperchen (Erythrozyten), weiße Blutkörperchen (Leukozyten), Blutplättchen (Thrombozyten).
Die Blutgerinnung. Thrombozyten sind wichtig für die Blutgerinnung, wenn beispielsweise die Gefäßwand verletzt ist. Sie kleben aneinander und bil-
www.badeliteratur.de

Gesundheitslehre und Erste Hilfe
10
den einen Pfropf auf der Gefäßwandöffnung. Sie verhindern damit, dass Blut verloren geht und Keime in den Körper gelangen. Gleichzeitig setzen sie Stoffe frei, die die Blutgerinnung in Gang setzen. Thrombozytenaggre-gationshemmer wie Aspirin verlangsamen oder behindern die Verklebung.
Über die Pulmonalvene (Lungenvene) zurück in die Lunge.
Der Lungenkreislauf ermöglicht den lebensnotwendigen Gasaustausch zwi-schen Blut und Atemluft.
Rechte Herzkammer g Arteria pulmonalis (Lungenarterie) g Lungenarte-rien g Lungenarteriolen g arterieller Schenkel der Lungenkapillaren (Koh-lendioxidabgabe) g venöser Schenkel der Lungenkapillaren (Sauerstoff-aufnahme) g Pulmonalvenen g linker Vorhof des Herzens.
Nachdem das Blut den großen oder Körperkreislauf durchflossen hat, tritt es durch eine Aktion des rechten Herzens in den kleinen oder Lungenkreis-lauf ein. Der Lungenkreislauf wird ebenfalls von Arterien, Kapillaren und Venen gebildet. Im Lungenkreislauf verzweigen sich die anfänglich recht großen Arterien zu immer feineren Gefäßen bis in den Bereich der Kapil-laren, welche die Lungenbläschen netzförmig umspannen. Die Lungenka-pillaren ermöglichen den lebensnotwendigen Gasaustausch zwischen Blut und Atemluft. Dann sammelt sich das Blut in den durch Zusammenschluss immer größer und weiter werdenden Lungenvenen. Die Lungenvenen mün-den schließlich als zwei große Lungenvenen in das linke Herz.
An Arterien.
Sie messen den Blutdruck an Arterien des Körperkreislaufs. Die Messwerte sind die Druckschwankungen in einer Arterie. Blutdruck ist der Druck, mit dem unser Herz das Blut durch die Gefäße drückt. Er wird durch zwei Wer-te, den systolischen und den diastolischen Blutdruck, gekennzeichnet.
Der Blutdruck ist am höchsten, wenn sich das Herz zusammen zieht (Dauer ca. 0,15 Sekunden) und das Blut in die Arterien presst, die sich dadurch ausdehnen. Diese Aktion wird Systole genannt. Den dabei entstehenden Druck nennt man systolischen Blutdruck.
Der Blutdruck in den Gefäßen ist am niedrigsten, wenn das Herz wieder erschlafft (Dauer 0,7 Sekunden) und die Gefäße durch Zusammenziehen wieder ihren Normalzustand erreichen. Diese Phase wird Diastole genannt. Den dabei entstehenden Druck nennt man diastolischen Blutdruck. Ge-nannt wird immer zuerst der systolische, dann der diastolische Wert des Blutdrucks.
Systolischer Blutdruck = maximaler Druck im Gefäß (entsteht während der Herzkammersystole).
www.badeliteratur.de
Gesundheitslehre und Erste Hilfe

11
Diastolischer Blutdruck = minimaler Druck im Gefäß (entsteht während der Herzkammerdiastole und ist Maß für die Dauerbelastung der Gefäß-wände.
Aktive Impfung: Ziel der aktiven Impfung ist der Aufbau eines langfristig wirksamen Schutzes. Hierzu werden abgetötete oder auch nur Bruchstü-cke der Erreger verabreicht. Das entspricht der in den oberen Abschnitten beschrieben Präsentation eines Antigens, ohne den Körper zu infizieren. Der Körper reagiert wie beschrieben mit der Bildung von Antikörpern und so genannten Gedächtniszellen.
Passive Impfung: Bei der passiven Impfung werden direkt Konzentrate von Antikörpern gespritzt. Im Unterschied zur aktiven Impfung bietet die passive Impfung einen sofortigen Schutz, der jedoch nur für kurze Zeit - ungefähr drei Monate - anhält.
Übungsfragen
Das lymphatische System setzt sich aus den Lymphgefäßen und den lym-phatischen Geweben zusammen. Dazu gehören die Lymphknoten, die Thymusdrüse (Thymus), die Milz (Lien) und die Mandeln (Tonsillae).
Lymphknoten: finden sich überall im Körper.
Thymus: liegt unmittelbar hinter dem Brustbein. Er wächst bis zur Pu-bertät, in der er seine größte Ausdehnung erreicht, und bildet sich da-nach kontinuierlich zurück.
Milz: liegt unter dem linken Zwerchfell im Oberbauch.
Mandeln: liegen als mandelförmige Gewebeinseln am Beginn des Luft- und Nahrungsweges (Rachenring)
Weil die Lymphe im Darmbereich die aus dem Darm resorbierten Fette enthält.
Die Gedächtnisfunktion der Lymphozyten ermöglicht das Impfen. Durch Impfen können Erkrankungen am Ausbrechen und an ihrer Verbreitung gehindert werden.
Die Lymphknoten haben die Funktion einer biologischen Filterstation. Sie reinigen die Lymphe (1), bilden Lymphozyten (2) und ermöglichen den Kontakt ausgereifter Abwehrzellen mit in der Lymphe befindlichen Anti-genen (3).
Das HI-Virus kann nur an Zellen „andocken“ die auf ihrer Zelloberflä-che bestimmte Erkennungsmerkmale bzw. Bindungsstellen aufweisen. Das wichtigste Erkennungsmerkmal ist ein Protein, das CD4 genannt
www.badeliteratur.de

Gesundheitslehre und Erste Hilfe
12
wird. Davon betroffen sind hauptsächlich die für das menschliche Immun-system wichtigen Abwehrzellen (T-Helferzellen u.a.) sowie einige Gehirn-, Darm- und Hautzellen. All diese Zellen besitzen die CD4-Proteine an ihrer Oberfläche. Die Immunzellen aber sind unsere Schutztruppen gegen krank-machende Organismen wie z. B. Viren, auch gegen das HI-Virus. Somit zerstört HIV - durch die Infektion dieser T-Helferzellen - die Verteidigung des menschlichen Körpers gegen HIV.
Übungsfragen
Atmung ist der Gasaustausch der Gase Sauerstoff (Aufnahme) und Kohlen-dioxid (Abgabe)in den Alveolen oder an den Zellen der Gewebe und Orga-ne. Die Ventilation ist ein Teilaspekt der äußeren Atmung und beschreibt die aktive, durch die Atemmuskulatur betriebene Bewegung der Luft durch die Atemwege in und aus den Lungen. Ventilation wäre demnach die Kombina-tion aus Einatmen und Ausatmen.
Als innere Atmung oder Gewebsatmung bezeichnet man den Gasaustausch auf Zellebene (an den Zellen). Dazu zählen die Sauerstoffabgabe aus dem Blut (Erythrozyten, Hämoglobin) an die Zellen und die Aufnahme von Koh-lendioxid aus den Zellen in das Blut.
In der Nase wird die Atemluft angefeuchtet und durch die Flimmerhärchen der Nasenschleimhaut grob gereinigt. In die Nasenhöhle münden die Gän-ge der Nasennebenhöhlen und der Tränenabflusskanal der Augen (Nase laufen beim Weinen). Die Nase ist auch Sitz des Geruchssinns.
Wichtigster Atemmuskel ist das Zwerchfell (Diaphragma), ein quergestreif-ter (willkürlicher) Muskel. Er kontrahiert bei der Einatmung und erschlafft bei der Ausatmung. Darüber hinaus ist an der Atmung die Zwischenrippenmus-kulatur beteiligt, die den Brustkorb bei der Einatmung erweitert. Bei vertief-ter Atmung wird zusätzlich die Atemhilfsmuskulatur eingesetzt. Einatmung: Durch Kontraktion der Zwischenrippenmuskulatur erfolgt eine Hebung des Brustkorbes und durch Anspannung des Zwerchfelles eine Zwerchfellab-flachung. In beiden Fällen vergrößert sich das Thoraxvolumen (Brustkorb-volumen). Durch die Volumenvergrößerung entsteht ein Unterdruck in der Lunge, der durch einströmen von Luft ausgeglichen wird. Die Einatmung ist ein aktiver, von Muskelarbeit abhängiger Vorgang. Die Ausatmung verläuft passiv. Die Zwischenrippenmuskulatur erschlafft, der Brustkorb sinkt durch seine Eigenspannung in sich zusammen und geht in seine Ruhelage zu-rück, und das Zwerchfell wölbt sich ebenfalls in seine Ruhelage nach oben zurück. Die damit verbundene Volumenverringerung bewirkt ein Ausströ-
www.badeliteratur.de
Gesundheitslehre und Erste Hilfe

13
men der Luft über die Atemwege.
Obere und untere Atemwege werden als luftleitendes System bezeichnet. Das luftleitende System nimmt nicht am Gasaustausch teil. Es stellt phy-siologisch einen Totraum dar. Das Totraumvolumen beträgt ca. 300 ml. Der Gasaustausch findet lediglich in den Alveolen statt.
Residualvolumen (RV): nicht ventilierbares Volumen, das auch nach max. Exspiration (Ausatmung) noch in der Lunge verbleibt; Normalwert: 1-2 l.
Nein, die Gaszusammensetzung der Ausatemluft und Einatemluft sind nicht identisch. Ein Teil des in der Einatemluft vorhandenen Sauerstoffs (21%) diffundiert in das Blut und wird in den Zellen verbrannt. Die Ausatemluft enthält daher nur noch ca. 17% Sauerstoff. Bei der Verbrennung in der Zelle entsteht das Gas Kohlendioxid, das über die Ausatemluft an die Umgebung abgegeben wird. Die Ausatemluft ist daher reicher an Kohlendioxid (ca. 5%) als die Einatemluft (0,03%).
Obere Atemwege: Nasenhöhle und Nasennebenhöhlen, Nasenschleim-haut, Nasenhaare, Flimmerhärchen, Mundhöhle, Pharynx (Rachen). Untere Atemwege: Larynx (Kehlkopf), Trachea (Luftröhre), Bronchien, Alveolen
Der Schluckreflex setzt während dem Schluckakt ein. Wird das zu schlu-ckende Material (Speise, Wasser etc.) zur Rachenhinterwand transportiert, verschließen sich reflektorisch die Stimmlippen und der Kehldeckel (Epi-glottis) legt sich über den Kehlkopfeingang. Somit sind die Atemwege vor dem Eindringen von fremdmaterial geschützt.
Die Muskulatur der Zunge erschlafft. Die Zunge fällt „nach hinten“ und legt sich auf die hintere Rachenwand. Die Atemwege sind somit verschlossen. Es besteht Lebensgefahr!
In den Lungenbläschen (Alveolen) der Lunge findet der eigentliche Gasaus-tausch zwischen Atemluft und Blut statt. Die Alveolen sind von einem dich-ten Gefäßnetz (Kapillarnetz) überzogen. Die dünne Wand der Kapillaren „verschmilzt“ mit der dünnen Wand der Alveolen. An dieser dünnen Barriere kann der Gasaustausch normalerweise problemlos stattfinden. Veränderun-gen dieser Wand führen zu Behinderungen des Gasaustausches.
Der Thorax besteht aus insgesamt etwa siebzig einzelnen Strukturen. Er wird nach hinten durch die Brustwirbelsäule, nach vorne durch das Brust-bein (Sternum) und seitlich durch je 12 Rippen begrenzt. Die ersten 7 Rip-penpaare sind direkt mit dem Sternum verbunden (echte Rippen). Die ande-ren Rippen erreichen das Sternum nur indirekt über eine Knorpelverbindung oder gar nicht (falsche Rippen).
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.