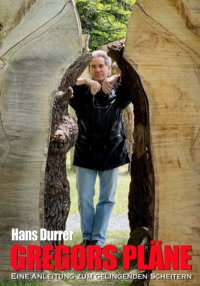Kitabı oku: «Gregors Pläne», sayfa 2
***
„Was für Eigenschaften halten Sie bei einem Menschen für wesentlich?“
Die Personalbereichsleiterin ist Mitte vierzig, sportlich-elegant gekleidet und attraktiv. Sympathisch ist sie mir nicht; mir sind Leute, die beim Fernsehen arbeiten, grundsätzlich nicht sympathisch, ich halte sie für eitel und aufgeblasen. Wieso ich mich beworben habe? Aus Eitelkeit. Das sage ich natürlich nicht.
„Verlässlichkeit“, sage ich. „Und Aufrichtigkeit.“
„Ist Aufrichtigkeit wichtig, wenn man vor der Kamera steht?“
„Aufrichtig zu wirken halte ich für entscheidender.“
Sie lacht. „Haben Sie sich schon einmal vor einer Kamera ins Szene gesetzt?“
„Ja, vor einer Fotokamera, vor einer Filmkamera hingegen nicht.“
„Wirkten Sie da fotogen?“
„Schon, ja, doch es hängt auch von der Person hinter der Kamera ab.“
„Mit welchem ihrer Charakterzüge haben Sie am meisten Mühe?“
„Mit meiner Ungeduld.“
„Das kennen wir glaube ich alle.“
„Persönlicher möchte ich nicht werden.“
„Sagten Sie nicht, dass Sie Aufrichtigkeit für wesentlich halten?“
„Doch“, sage ich. „Dass ich diesbezüglich nicht persönlicher werden will, ist meine aufrichtige Meinung.“
„Okay. Werden wir konkret. Bei einer Diskussionssendung geht es darum, ganz unterschiedlichen Meinungen eine Plattform zu geben, also auch Leuten, deren Meinung sie nicht teilen, ja, sie geradezu verabscheuen. Haben Sie ein Problem damit?“
„Grundsätzlich nicht.“
„Und im Speziellen?“
„Beim denen, die ich als notorische Lügner, empathielos und menschenverachtend einschätze, habe ich klar ein Problem.“
Sie grinst. „Wenn wir darauf Rücksicht nehmen, können wir die Sendung einstellen. Doch im Ernst: Die Frage ist natürlich auch, ob ihre Einschätzung richtig ist. Sie könnten sich schliesslich täuschen.“
„Sowieso. Doch die meisten Leute erkennen einen Lügner, wenn sie einem gegenübersitzen.“
„Dann können Sie ihn ja in die Sendung einladen und den Zuschauern die Beurteilung überlassen.“
„Ich denke nicht, dass man Lügnern eine Plattform geben sollte.“
„Wenn wir nur die einladen, die uns passen, können wir die Sendung vergessen, denn so eine schaut niemand.“
„Aha, die Einschaltzahlen.“
„Das ist doch klar. Was glauben Sie, warum wir Fernsehen machen? Natürlich wollen wir auch aufklären. Doch vor allem: Wir sind hier keine Richter, wir sind mehr so eine Art Theater oder Zirkus, wo sich die Leute unterhalten sollen.“
„Damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen?“
„Was meinen Sie damit?“
„Paul Valéry hat einmal gemeint, die Politik sei dazu da, die Menschen davon abzuhalten, sich mit dem zu beschäftigen, was sie wirklich angehe. Das gilt auch für die Medien, würde ich sagen.“
„Ablenkung und Unterhaltung ist oft nicht das Dümmste.“
„Das sehe ich auch so.“
„Lassen Sie uns konkret werden: Würden Sie einen empathielosen, menschenverachtenden Lügner in die Sendung einladen?“
„Denken Sie an den Golfer im Weissen Hauses?“
„Zum Beispiel.“
„Nein, würde ich nicht.“
„Viele Zuschauer würden den aber gerne sehen.“
„Viele sehen auch gerne Pornos. Und trotzdem zeigen Sie keine.“
„Politik abzubilden gehört zu unserem Kernauftrag.“
„Politik. Nicht Politiker. Zeigen Sie nicht die Politiker, sondern die Auswirkungen der Politik.“
„Sie haben sich beworben als Moderator einer Debatten-Sendung. Das meint, Sie bringen Leute miteinander ins Gespräch. Und zu diesen Leuten gehören nun mal Politiker. Und jetzt sagen Sie, man solle Politikern nicht das Wort geben?“
„Anstatt Politikern eine Plattform für ihr Ego zu geben, wäre es meines Erachtens sinnvoller, den von den Auswirkungen der Politik Betroffenen eine Plattform zu geben.“
„Glauben Sie, dass das viele vor den Bildschirm bringen wird?“
„Vor Jahren, in Japan, wurde heftig darüber gestritten, ob eine Philosophie-Sendung, die sich mit Fragen von Leben und Tod auseinandersetzte, zur Hauptsendezeit ausgestrahlt werden sollte. Die Medienfachleute fanden die Idee absurd, das Publikum sah das anders – die Einschaltquoten waren erstaunlich hoch.“
„Ich habe viel Sympathie für Ihr Argument. Nur eben: Wir sind hier in der Schweiz, nicht in Japan.“
***
Am nächsten Tag befindet sich in meiner Post der Brief eines Buchverlags, der auf Recht und Geschichte spezialisiert ist. Ich bin in die engere Auswahl für den Verlagsleiterposten gekommen und werde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
Der Eigentümer ist ein jugendlicher Mitvierziger und mir sympathisch. Dass ich über keine Verlagserfahrung verfüge, sei ein Vorteil, lacht er, denn so sei ich formbar. Nach den ersten paar Monaten merke ich dann, wie formbar er ist. Jedenfalls lerne ich schnell wie ich meine Projekte bei ihm durchbringen kann. Sind eigentlich Aussagen, die man über andere macht, jemals etwas anderes als Selbstcharakterisierungen?
Das Buch ist für mich das ultimative Kulturgut, gierig mache ich mich über Herstellung, Gestaltungsfragen und Marketing kundig. Besonders gut verstehe ich mich mit dem Buchhersteller, einem Mann von Mitte fünfzig, belesen und von grossem Sachverstand. In seiner Gegenwart spüre ich, dass Büchermachen gleichzeitig Handwerk wie auch Kunst ist.
Ich treffe Autoren, die mich beeindrucken, doch die meisten sind eitle Wichtigtuer. Zu meinen Lieblingen gehört ein emeritierter Geschichtsprofessor, der mir jeweils am Telefon Gedichte deklamiert und Lieder vorsingt, sowie ein Alt-Bundesrat, der mich beim Durchgehen meiner Anmerkungen zu seinem Manuskript unterbricht und grinsend bemerkt: „Sie erinnern mich an meinen ehemaligen Staatssekretär, der hat auch dies und das bemängelt, allerdings mit einem Unterschied: Er entschuldigte sich dann immer, obwohl er doch dafür gar nicht bezahlt wurde.“
Akademische Bücher zu verlegen finde ich schon nach kurzer Zeit wenig interessant. Meldet sich ein Professor mit einem Manuskript kann man als Quasi-Universitätsverlag eigentlich kaum Nein-Sagen, wie mich ein von mir wenig geschätzter Professor wissen lässt. Als sich dann unverhofft die Gelegenheit bietet, das Nein-Sagen zu üben, lehne ich ein Referat von ihm ab: Dieses, ein Ja zur Konkordanzdemokratie, die in der Schweiz von niemandem bestritten wird, war nämlich bereits publiziert worden und sollte nun, so der Professors Wunsch, in neuem Gewand noch einmal präsentiert werden.
In dieser Zeit bin ich vom Journalismus angefressen. Angefangen hatte dies in Jugendjahren mit der amerikanischen Fernsehserie Lou Grant, die auf einer Zeitungsredaktion spielte, wo die Helden der Wahrheit verpflichtete Journalisten waren. Reporter wollte ich damals werden. So einer wie Jack Nicholson in Michelangelo Antonionis Profession Reporter, obwohl, ich erinnere mich bei diesem Film nur noch an Bilder von der Wüste, und vor allem an Maria Schneider. Als ich auf Wikipedia lese, dass sie sich aufgrund von Alkohol- und Drogenproblemen in psychiatrische Behandlung begeben musste und mit 58 an Krebs gestorben sei, macht mich das betroffen. Schon eigenartig, meine Empfindungen für diese Frau, die ich nur von Filmen und Fotos kenne, und die mir in diesem Moment gefühlsmässig gerade näher steht als eine frühere Freundin, nach der ich einmal süchtig war (sexuell natürlich, was denn sonst?) und von der ich eben eine Email gelesen habe.
Ich frage den Korrespondenten einer Deutschschweizer Tageszeitung in Lausanne an, ob er sich vorstellen könne, ausgewählte Artikel von ihm zu einem Buch mit dem Titel Notizen aus der Westschweiz zu machen. Die Antwort erfolgt prompt: Ja, das würde ihm gefallen und übrigens verstehe er seine Arbeit genau so wie es der von mir vorgeschlagene Titel ausdrücke, als Notizen. Er schickt mir seine gesammelten Arbeiten, ich treffe eine Auswahl, gliedere sie und lege sie ihm vor, in der Hoffnung, er sei davon genauso angetan wie ich. So bin ich auch bei anderen Journalisten, drei von ihnen Frauen, vorgegangen. Zwölf solche Bücher habe ich herausgegeben, die ich sowohl als Zeitdokumente wie auch Autorenporträts verstand.
Er habe schon mit vielen Verlegern zu tun gehabt, sagt der Mann aus Lausanne eines Tages, doch einen idealeren als mich habe er noch nie erlebt. Mir ist klar, woran das liegt: An meiner Begeisterung für meine Arbeit. Es tut mir gut, mich für jemanden einzusetzen, jemanden fördern zu können.
Da ich auch in Lausanne wohne, besuche ich ihn und seine Frau von Zeit zu Zeit. Er habe letzthin seine fiche einsehen können, erzählt er mir eines Tages (Der Schweizer Geheimdienst führte während Jahren Dossiers über Personen, die umstürzlerischer Ideen verdächtigt wurden, sogenannte fiches). Man hätte meinen können, bei seiner Frau habe es sich um eine veritable Mata Hari gehandelt, lacht er. Als ich mich bei meinem nächsten Besuch nach ihr erkundige, erwidert er, Mata Hari sei gerade in der Migros beim Einkaufen.
Auch von anderen Autoren erhalte ich viel Lob. Nein, nicht von allen, von den meisten höre ich gar nichts. Ich hätte seine Texte nicht einfach zusammengestellt, sondern komponiert, schrieb ein Chefredakteur im Vorwort; ein anderer, der sich als Politiker-Porträtist einen Namen gemacht hatte, behauptete, er habe sich durch mein Porträt von ihm besser kennengelernt. Ich schwebte auf Wolke sieben.
Sie finden das eitel, dass ich das erwähne? So richtig wohl ist mir selber nicht dabei. Doch wieso gilt es eigentlich als vornehm, zu schweigen, wenn man sich darüber freut, dass die eigene Arbeit geschätzt wird, Anerkennung findet?
Mein Lieblingsautor war übrigens der Junior. Ein von mir hoch geschätzter Redakteur der Süddeutschen Zeitung, den ich als Autor zu gewinnen hoffte (was mir auch gelang), hat uns zusammen geführt. Zwei Bücher habe ich von ihm herausgegeben; bis zu seinem Tod im Alter von 96 Jahren sind wir miteinander freundschaftlich verbunden gewesen. Ein bis zweimal die Woche liessen wir „den Draht spielen“, wie er das Telefonieren bezeichnete, das er oft mit „Wollte mich nur erkundigen, was mein lieber Privatgelehrter so treibt“ einleitete. Seine launigen Bemerkungen begleiten mich heute noch. Beglückwünschten ihn Bekannte auf der Strasse dazu, wie geistig und körperlich rüstig er noch sei, erwiderte er wahlweise mit „Ich simuliere nur“ oder „Ja was soll ich denn, vielleicht zum Probe-Liegen auf den Waldfriedhof?“ Als er einmal beim Einkaufen lange warten musste und dabei ausgiebig Gelegenheit hatte, den Unterhaltungen der Leute im Laden zuzuhören, kommentierte er. „Mir scheint, der Mensch ist tagaus tagein allein damit beschäftigt, sich selber zu rechtfertigen.“
***
Meine Begeisterung für den Journalismus hat sich gelegt. Mittlerweile nehme ich die Medien fast ausschliesslich als profitgetriebene Unterhaltungsindustrie wahr. Natürlich gibt es Journalisten, die gute, notwendige und spannende Aufklärung betreiben, doch die meisten der Themen, die in den Medien Platz finden, halte ich für einfaltslos. Sie lenken meine Aufmerksamkeit auf für mich Unwesentliches, bestenfalls Interessantes. Doch interessant ist vieles, auch das Liebesleben der Bienen, hörte ich einmal Ajahn Sumedho, einen amerikanischen Theravada-Mönch bei einem Meditationsnachmittag in Bangkok sagen, doch darum gehe es nicht. Es gehe darum, ob etwas hilfreich sei. Hilfreich, um ein qualitativ gutes Leben zu führen, nicht um davon abzulenken, dass wir die Langeweile nicht aushalten.
***
Nach fünf Jahren als Verlagsleiter hatte ich das Gefühl, bewiesen zu haben, was ich geglaubt hatte, beweisen zu müssen. Erst viele Jahre später habe ich realisiert, dass das Mich-Beweisen-Müssen eines meiner Muster ist, das man nicht mit Universitätsabschlüssen und einem angesehenen Job hinter sich lassen kann. Ich denke übrigens generell nicht, dass man irgendetwas überwindet, bewältigt oder hinter sich lässt. Sicher, vorstellen kann ich es mir schon. Schliesslich ist das unsere gewohnte Art zu denken. Doch meine Erfahrung ist anders. Schaue ich etwa ein Foto meiner vor Jahren verstorbenen Eltern an, so sind sie immer noch da, in meinen Träumen sowieso. Zunehmend kommt es mir vor, es geschehe alles gleichzeitig, Vorher und Nachher seien Illusionen. Ziemlich beständige, zugegeben.
Eine private Universität in China zeigt Interesse an meiner Bewerbung als Dozent für Medien und Kommunikation. Ob ich bereit sei, das erste Semester 'Spoken English' zu unterrichten?, fragt der Vertreter der Universität, der mich am Flughafen vom Xiamen abholte, sie hätten da nämlich gerade einen Engpass (einer der Dozenten war offenbar Hals über Kopf abgereist, wie ich später erfahre).
„'Spoken English'? Was ist denn das? Englisch lernen ohne Lesen und Schreiben?“ Also die Studenten hätten gute Englisch-Kenntnisse, allerdings nur passiv, bei 'Spoken English' gehe es darum, sie zum Sprechen zu bringen, was aus kulturellen Gründen (die Chinesen seien scheu), nicht so einfach sei. Nun ja, kulturelle Gründe müssen meist dann herhalten, wenn man den Tatsachen nicht ins Gesicht sehen will – meine Studenten jedenfalls können mehrheitlich kein Englisch, auch nicht passiv. Und scheu sind sie definitiv nicht, eher stur und hartnäckig.
C aus Vancouver ist chinesischer Abstammung, spricht jedoch kein Mandarin, was ihm von den lokalen Chinesen den Vorwurf der Arroganz einträgt. Wir würden ständig überwacht, sagt C. Die anderen Dozenten finden ihn leicht paranoid, ich nicht. „Denk daran, einer in der Klasse versteht dich und wird dem Vizepräsidenten rapportieren, wie du dich verhältst und was du sagst.“ Es wimmle hier von agents provocateurs, genau wie während der Kulturrevolution. Ich habe zwar wenig Ahnung von chinesischer Geschichte, doch ich nehme mir Cs Rat zu Herzen.
Montagabend müssen wir uns jeweils für zwei Stunden 'English Corner' zur Verfügung stellen. Dabei werden wir von Studenten aller Studienrichtungen umlagert, die uns Fragen stellen. 'English Torture' trifft es besser, denn die Fragen sind von einer derart stereotypen Einfaltslosigkeit (Where do you come from? How do you like China? ....), dass selbst ausgeglichene Seelen rasch an ihre Grenzen stossen. Wie üblich werden wir kontrolliert. Als ich einen Mann, der gut Englisch spricht, frage, was er denn studiere, antwortet er 'Chemie', ein Fach, das an dieser Business-Universität gar nicht unterrichtet wird. C hat eindeutig recht mit seinen agents provocateurs, denkt es so in mir.
Sie habe gehört, sagt eine chinesische Dozentin, ich fände meine Studenten blöd. Sie will mich offenbar provozieren. Und so provoziere ich zurück: Einige seien in der Tat in Sachen Englisch eher suboptimal unterwegs, aber nicht alle, natürlich nicht.
Wie viele pro Klasse dürfen durchfallen? Gibt es da Vorgaben? Der zuständige Mann windet sich, ringt sich dann aber zu 10 Prozent durch. Da ich selber alle durchfallen lassen würde (niemand in meinen Klassen kann Englisch, ausser den Englisch Hauptfach Studenten), beschliesse ich. alle bestehen zu lassen, die zeigen, dass sie sich minimal angestrengt haben.
Ob ich wisse, was 'das Gesicht verlieren' bedeute?, fragt mich der Klassensprecher der Englisch-Hauptfach Studenten, der mir nach der Schulstunde abpasst. Ja, erwidere ich, jemanden nicht blöd hinzustellen, da das Wichtigste sei, was die Nachbarn denken könnten. Ich hielte es hauptsächlich für ein Disziplinierungsinstrument. Dem linientreuen Klassensprecher passt meine Antwort ganz und gar nicht. Es sei viel komplizierter, sagt er, und habe mit der chinesischen Geschichte zu tun. Da ich mir auf gar keinen Fall langfädige Geschichts-Ausführungen antun will – so in etwa der dritte Satz jeder chinesischen Konversation lautet: Wir sind stolz auf unsere 5'000 Jahre alte Geschichte – , frage ich ihn, ob er den chinesischen Dozenten auch solche Vorträge halte? Nein, natürlich nicht. Dann solle er doch auch mir gegenüber etwas respektvoller sein, damit ich nicht mein Gesicht verlöre, informiere ich ihn und lasse ihn stehen.
Drei Notizen aus dieser Zeit:
L'homme propose, Dieu dispose.
Das hier ist nicht die Vorbereitung aufs Leben, das hier ist das Leben.
Can you make a sentence with „slightly“? When I slightly opened the window, I saw a pig.
Nach einem Semester habe ich genug und kündige. Zurück in der Schweiz, trete ich kurz darauf eine Anstellung als Programmleiter in einem wissenschaftlichen Buchverlag an, die ich jedoch nach gerade mal zwei Monaten bereits wieder aufgebe – ich kann ganz einfach nicht für Leute arbeiten, die wesentlich blöder sind als ich. Sie wollen es konkreter? Ein Beispiel: Der Geschäftsführer zeichnete ständig Organigramme (mit Buntstiften), mittels derer er herauszufinden versuchte, was für einem Betrieb er eigentlich vorstand – wer wann Geburtstag hatte war ihm geläufig, das hatte er fein säuberlich in seinem Kalender notiert. Und noch ein Beispiel: Bei einem gemeinsamen Mittagessen fragte ich ihn nach seiner Lieblingslektüre. Dass ich das überhaupt fragen könne, wunderte er sich, „Management-Bücher selbstverständlich“. Ein geistiger Kretin, dachte es automatisch in mir. Sie finden es übertrieben, dass ich deswegen kündige? Sie haben recht, ich finde es selber übertrieben.
Nur eben: Ist man mitten drin in einem Prozess, weiss man ja so recht eigentlich nicht, was mit einem geschieht. Die Erklärungen folgen erst im Nachhinein. Und ob diese dann wirklich erfassen, was los gewesen ist, ist einigermassen fraglich. Da war nämlich noch was ganz anderes: Ich konnte die zwei Monate, die ich dort arbeitete nicht schlafen, war jeden Morgen völlig zerschlagen. Für mich ist das ein überzeugender Kündigungsgrund.
Als ich meinem Freund A, Psychiater von Beruf, davon erzähle, lacht er: Seit ich Dich kenne, bist Du auf der Suche nach einem Job. Doch kaum hast Du einen, gibst Du ihn auch bereits wieder auf.
Mein Studienkollege H, aufstrebender Anwalt in einer renommierten Kanzlei, reagiert weniger freundlich, ja aggressiv: Ich verstehe dich nicht. Du macht Dein Studium in Rekordzeit, ergatterst Dir einen Super-Job als Verlagsleiter eines renommierten Hauses. Und dann, Knall auf Fall, schmeisst Du hin, ohne auch nur die geringste Ahnung, was Du machen willst. Kein Plan, kein Gar Nichts. Wo lebst Du eigentlich? Ich weiss, ich weiss, dann hast Du noch einen Magister angehängt, ja, ich weiss, mit Auszeichnung, Du hast es mir oft genug gesagt. Doch was machst Du damit? Ein Semester China! Ein Semester! Bist Du eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Weisst Du, wie das in Deinem Lebenslauf aussieht? Du rast auf einen Abgrund zu und merkst es nicht einmal. Wach auf! Sofort!
H übertreibt. Und überhaupt: Seine Weltsicht und meine (habe ich eigentlich eine?) könnten verschiedener kaum sein. Er interessiert sich für Scheidungsrecht! Nein, ich will seinen Standpunkt deswegen nicht abtun. Ganz und gar nicht. Für jemanden wie ihn, der eine konventionelle Laufbahn eingeschlagen hat, ist mein bisheriger Werdegang schon ziemlich suboptimal. Für mich selber übrigens auch. Sich durchzuwursteln sei keine Option in einem Business-Plan, hat der letzte britische Gouverneur von Hongkong in seinem Bericht über seine Amtszeit geschrieben. Aber eben, die Realität, jedenfalls meine, ist definitiv ein Durchwursteln. Nein, ich bin darüber nicht glücklich, doch mir fällt einfach nichts Besseres ein. Unglücklich darüber bin ich allerdings auch nicht.
Als ich mich kurz darauf in Berlin um eine Stelle als Geschäftsführer einer interkulturellen Stiftung bewerbe, fragt die Stiftungsgründerin:
„Gesetzt den Fall, Sie kriegen die Stelle, dann wäre ich Ihre Vorgesetzte. Haben Sie ein Problem damit, einer Frau, die drei Jahre jünger ist als Sie, unterstellt zu sein?“
„Selbstverständlich“, erwidere ich. „Ich habe generell Mühe, jemandem unterstellt zu sein, ob Frau oder Mann. Doch habe ich gelernt, mich damit zu arrangieren, das wäre also kein Problem.“
Sie guckt irritiert, Chefs erwarten Untertänigkeit und vorauseilenden Gehorsam. Mir ist klar, die Stelle kann ich vergessen. Und so kommt es denn auch.
Jemanden nicht riechen können, gehört zu den Sätzen die ganze Psychologie-Bibliotheken ersetzen. Vor allem erfolgreiche Menschen haben einen Riecher für Leute, die sie für geeignete Mitarbeiter halten. Diese Stiftungsgründerin in Berlin wusste instinktiv, dass ich keiner war, der sich für die Vermehrung ihres Glanzes einsetzen würde.
Wir alle haben so einen Riecher. Wen ich selber nicht alles riechen kann, vermag ich gar nicht zu zählen, da ich mich generell von Idioten umzingelt wähne. Sogar aus der Distanz mag ich Leute nicht. Haben Sie schon einmal den obersten Wetterfrosch beim Schweizer Fernsehen gesehen? Nicht in natura, auf dem Bildschirm, das reicht völlig. Dem sein autoritärer Charakter lässt sich fast mit Händen greifen. Sie wissen nicht, wen ich meine? Also gut, dann eben ein anderes Beispiel, auch vom Schweizer Fernsehen. Kennen Sie die Frau, die den Club moderiert? Furchtbar. Die hat Preise gewonnen, auch internationale, sagen Sie? Das meine ich doch gerade. Einen Preis von CNN! Selbstgefälliger kann man doch gar nicht sein! Neidisch? Ich? Nicht in dem Sinne, dass ich diesen Leuten ihren Job neide, doch in dem Sinne, dass ich der Meinung bin, die falschen Leute besetzen die falschen Stellen. Doch ist das Neid? Ich befürchte allerdings, dass mich mit Menschen, die ich instinktiv ablehne, mehr verbindet als mir lieb ist. Sogar wenn ich sie nur aus dem Fernsehen „kenne“.
***
Ich habe von Nicolas Sarkozy geträumt, der mir auf den Stufen eines Herrschaftsgebäudes, das in einem Park angesiedelt war, aus einer Thermosflasche Kaffee in eine Porzellantasse kredenzte. Auch eine blonde Frau, die ich jedoch nicht zuordnen kann, war dabei; auch sie behandelte er zuvorkommend – ganz der Typ des leicht schmierigen kultivierten Kellners.
Nein, ich frage mich nicht, wie ich von Sarkozy träumen kann. Doch ich wundere mich, staune und bin verblüfft, was mein Hirn so alles mit mir macht. Es nimmt mich auf Reisen mit, die ich weder geplant habe noch hätte planen können. An Fantasie fehlt es mir übrigens nicht. Ich kann mir Sarkozy als Kellner mit Gel im Haar ohne weiteres vorstellen, doch dass ich mich jemals freiwillig mit diesem hyperaktiven, ständig angespannten Grössenwahnsinnigen (Wie ich zu dieser Einschätzung komme? Ich habe Augen im Kopf!) beschäftigen würde, Nein, das dann doch nicht.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.