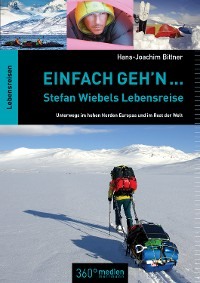Kitabı oku: «Einfach geh'n: Stefan Wiebels Lebensreise», sayfa 3
Kapitel III: Der unfreundliche Vulkan – Absturz I – Mexiko

Xalapa am Citlaltépetl (Pico de Orizaba).
Kapitel III: Der unfreundliche Vulkan – Absturz I – Mexiko
Der Vulkan ließ ihn liegen. Zeigte kein Mitleid mit seinem Schicksal. Ließ ihn allein, in seinem Elend. Das zerfetzte Sprunggelenk, rechts unten, tobte und pochte.

Stefan verlor sich fast in der weiten Landschaft unter dem Orizaba, der ihm so unfreundlich begegnete.
Dezember 1991: Ein Gringo steigt auf einen Berg. Oben Eis und Schnee, wie am Kilimandscharo. Das ganze Jahr. Keine Erhebung wie gewohnt, in den heimischen, oberbayerischen oder Salzburger Bergen. Schwarz das poröse Gestein, rau und scharfkantig die erkaltete Lava. Keine Wege, kaum Pfade. Geröll und Schutt stellen sich hartnäckig in den Weg, hier und da lästiger Schwefelgeruch. Wie auf dem Popocatépetl, dem Berühmten, wenige Wochen zuvor. Dort, auf fast 5.300 Metern, ging alles gut. Jetzt ist Stefan auf dem Citlaltépetl (auch Pico de Orizaba) unterwegs. Mit 5.636 Metern (Mexiko preist ihn natürlich mit 5.700 Metern an) der höchste Vulkan Nordamerikas und damit gleichzeitig der Berg-König Mexikos. Die jüngste bekannte Eruption datiert aus dem Jahr 1846. Im letzten 1991-Monat bewegt sich ein großer farbenfroher Rucksack langsam nach oben, schwer, bedächtig fast, aber stetig an Höhe gewinnend. Ein paar Bauern staunen. Das machte hier bislang niemand sonst, zwischen den Bundesstaaten Puebla und Veracruz.

Kurz vor dem Absturz: Start am Pico de Orizaba.
Es war Winter. Kalt auch in Mexiko, aber trocken. Niederschläge sah er noch nicht. Und er war allein. Der Himmel wirkte fahl, in blasses Blau gehüllt. Stefan atmete tief, der Puls arbeitete schlagkräftig im Schläfen- und Halsbereich, pumpte den Lebenssaft im Eiltempo durch seinen Körper. Kopfschmerzen. Trockene Kehle. Ein Brennen, irgendwo zwischen Hals und Bauch. Er trank zu wenig, hatte kaum Wasser dabei. Der Schichtvulkan forderte ihn, forderte sein ganzes Ich, außen und innen, die gesamten 182 Zentimeter Stefan Wiebel. Er packte es, kam an, wo es nicht mehr weiterging. Gipfelglück ohne Kreuz. Er legte ihn aus, seinen Schirm, ausgeliehen von der Mama, so leuchtend, so Gelb, so Rot, ein wenig Lila und Blau war dabei. Für die fantastische Aussicht hatte er keine Muse, so frei, so grenzenlos rundherum. Er ordnete die Leinen, 100 Meter unter dem Höhepunkt, prüfte nochmal alle Gurte, ein kurzer Blick zurück, minimale Routine, wenig Vorsicht, ganz viel Risiko. Das wusste er nicht, ahnte es nicht, dachte nicht daran. Der Stoff lag gut, wartete hinter ihm. Ein paar ausladende Schritte, in seinem knallroten Bergwacht-Anzug, auf einem grauen Schotterfeld, große Steine, kleine Steine, Kies und Sand – weg war er, der Wiebei, und der Bodenkontakt. Der Vulkan verlor ihn. Gleißend schien es ihm ins Gesicht, leichter Wind blies erfolgreich gegen jegliche Versuche der Sonne an, ein wenig Wärme in Erdnähe zu erzeugen.
Stefan haute sich raus, mit jedem Gramm, das er hatte. Er war schmächtig. Schlagartig nur noch eisige Luft um ihn. Er sank sofort, mit seinem bunten 927er-Nylon. Bedrohlich schnell. Es ging bergab, zu rasant. Rasch wurde ihm klar: Das ist kein Sinken, es ist ein Abstürzen. Die 23 Kammern reichten nicht, nie und nimmer. Schlagartig kam die Gewissheit: Es geht nur noch ums Überleben. Später, lange nach dem Absturz, folgte die Erkenntnis: Stefan war zu Beginn der 1990er-Jahre mit einem Gleitschirm aus den ersten Paraglider-Generationen unterwegs, Baujahr 1988. Die „Flugeigenschaften“ dieser Schirme tendierten in einer Höhe von 4.000 bis 6.000 Metern gegen Null. „Und wir dachten damals, wir hätten das Nonplusultra über unseren Köpfen.“
„Ich wollte nicht auf einem Baum sitzen“
Der Wind kam energisch von der flachen Küste, vom riesigen Golf von Mexiko herüber. Gut 100 Kilometer entfernt. „Ich war davon überzeugt, trotz des raschen Höhenverlustes, bis ins sichere Tal zu kommen.“ Dort, wo jene heimische Familie wohnte, die ihn einige Tage zuvor so herzlich aufnahm, am Fuße des Vulkans. Ein Irrtum, ein fataler, ein fast lebenszerstörender. Auf der windabgewandten Leeseite verlor Stefan so schnell an Höhe, dass nie von einem Schweben, schon gar nicht von einem Fliegen die Rede sein konnte. „Ich sank brutal“, erinnert sich der damals 21-Jährige, noch eher unerfahrene Pilot. Unter ihm war nur noch Wald. Föhren. Riesige Bäume, dicke Stämme, kräftiges, dichtes Astwerk. „Da wollte ich wenigstens noch drüber.“ Er hatte keine Chance, die Wipfel schossen auf ihn zu, ohne Unterlass, immer näher kamen die Spitzen. Und Stefan donnerte frontal zwischen die grünen Kiefern, schlug ungebremst auf den noch härteren Lavaboden auf. Nach nicht einmal einer Viertelstunde in der Luft, über eine halbe wollte er oben bleiben, zu dieser einsamen Mittagsstunde. Schon oft verfingen sich abstürzende Gleitschirme in den Baumkronen, die Piloten blieben darin hängen. Er wollte das nicht, wollte nicht auf einem Baum sitzen und vergeblich warten – denn Retter wären hier nie und nimmer erschienen. Kaum jemand wusste von seinem Tun oder wo er sich befand. Mit einer „Landung“ im dichten Astwerk hätte er womöglich sein Todesurteil unterschrieben. Er fand den Spalt, die Lücke, die kleine, lebensrettende Lichtung, so viel Steuergewalt hatte Stefan noch.
Sein Inneres schrie nach Wasser
Schemenhaft erkannte er das Umfeld. Das Wissen um das Passierte kroch langsam in ihm hoch. Wie der Schmerz. In höllischem Ausmaß. Er erreichte sein Gehirn. Das funktionierte bestens. Ein Glück. Er spürte noch. Spürte noch Schmerz, Unbehagen, Ungewissheit. Stefan hob quälend den Kopf. Und er prüfte: Alles war noch dran, aber war da noch mehr als das brutale Schlagen dort unten, rechts, zwischen Schienbein und Fuß? So blau, so angeschwollen. Nein, nur noch ein paar Schrammen, Prellungen, Kopfschmerzen, unsägliche Kopfschmerzen hinter der Stirn, den Augenhöhlen, unter der zentralen Schädeldecke, Nordhirn. Es gab kein Wasser, nirgends ein Bach, ein kleiner See, nicht mal mehr ein wenig Schnee. Jetzt rächte sich sein Lapsus vom Aufstieg. Sein Inneres schrie nach Flüssigkeit.
Der Schock verging, der Plan reifte: Runter vom Berg, runter von den rund 4.500 Metern, der Höhenluft, so schnell wie möglich. Er schlief ein, sein Körper forderte jetzt diese Ruhe. So wie Wasser. Das alles war doch zu heftig gewesen, der Aufprall zu intensiv. Ein paar Schmerzmittel hatte er dabei, ein First-Aid-Paket. Es half über das schlimmste Pochen hinweg. Nur kurz. Er nahm mehr, zu viel, viel zu viel, statt „25 bis 30 Valeron-Tropfen empfohlen“ fast die doppelte Menge. „Die beamte mich komplett weg“. Die Höhe leistete ihr Übriges.
Nachtkälte riss ihn hoch. Sie kam schleichend. 1.000 Höhenmeter musste er abwärts überwinden, mindestens, schleppend, keuchend, schmerzhaft, anders ging es nicht. Stefan erreichte geschwächt Sandboden, immerhin, ein paar Holzhütten. Dort haben sie ihn angeschaut, als käme er direkt vom Mond. Arme Bauern, die hier oben ein wenig Ackerbau und Viehzucht betreiben. Sie ließen ihn schlafen, bei sich, im Warmen. Essen gab es kaum. Sie hatten selbst so wenig. Ein wenig Trinken, wenigstens. Verstanden haben sie sich nicht. Und sein Tun schon gar nicht.
Stefan trennte sich. Jedes Gramm war ihm jetzt zu viel. Er ließ seinen Schirm in einem hohlen Baumstumpf voller Harz verschwinden. In der Hoffnung, ihn irgendwann dort wieder abholen zu können. Das Loch schloss er mit umherliegenden Ästen. Ein paar wichtige Accessoires behielt er: Die Steigeisen, den Schlafsack, die Isomatte, den Esbitkocher, die Teleskopstecken, die er als Ersatzkrücken einsetzte, für den verletzten Fuß.
Steigeisen-Zaun
Wieder musste er schlafen, in der Ferne hörte er die Wildhunde heulen. Wieder war es kein Schlaf, nur ein Dämmern, kurz, keine Erholungschance. Unbarmherzige Minusgrade rüttelten ihn einmal mehr wach, und das monotone Heulen. Beides rettete ihm das Leben. Lange vor jeglichen Handy-Zeiten musste er sich jetzt endlich und entscheidend selbst helfen, die Schmerzmittel richtig einsetzen, Schritt für Schritt absteigen, langsam, aber doch stetig und gleichmäßig Höhe verlieren. Noch eine Eisnacht unter freiem Sternenhimmel, zum Glück kein Regen. Die Steigeisen stellte er rings um sich herum als schützenden „Zaun“ auf, gegen den möglichen Angriff der Heuler, der Kojoten. So dachte er, er wusste es nicht. So viele Gedanken, so viele Ängste, so lange zum praktischen Handeln verurteilt. Als der Bayer nach drei Tagen wieder ins Dorf seines Aufbruchs humpelte, endlich den Vulkan hinter sich gelassen hatte, empfing ihn die mexikanische Familie, die ihn zuvor bewirtet hatte, im Tal erleichtert, ja überschwänglich.
Jetzt war Stefan gefesselt. An ein schmales mexikanisches Bett. Zum Arzt wollte er nicht, es würde alles wieder von selbst heilen, war er sich sicher. So oder so: Er musste sich schonen. „Ich hatte keine Wahl.“ Seine Sachen hatte er noch in einer kleinen Pension, doch seine neue Gastfamilie holte ihn zu sich, sie hatte genug Platz. Und einen Stock zum Aufstützen, zum Entlasten des kaputten Fußes. Ihrem Drängen konnte er irgendwann nicht mehr standhalten. Das Mountainbike kam an einen trockenen Platz im Hof, sicher verwahrt. Stefan bezog sein neues Zimmer.
Er bewies Geduld, schonte sein lädiertes Sprunggelenk, legte es hoch und ließ es dort. Der Plan, Mexiko zu durchradeln, war vorerst auf Eis gelegt. Der Abgestürzte und Durchgekommene wartete auf Besserung. Die Familie „Medico“ besorgte Salben, „mit etwas Kühlem drin“. Weihnachten kam, Silvester und Neujahr gingen. 9.500 Kilometer von daheim, dort wussten sie lange nichts von seinem Tun, seinem Unfall, seiner neuen Bleibe, seinen Plänen. Damals gab es noch keinen Mailverkehr, keine Handys. „Ich hab mal eine Postkarte geschrieben, aber die war wochenlang unterwegs.“ Mit den Eltern hatte er in all den Monaten in Lateinamerika – am Ende sollten es acht sein – höchstens dreimal telefoniert.
Mexiko begrüßte das Jahr 1992 mit einer großen bunten Feier. Auch das Dorf, in dem Stefan stark lädiert gelandet war. Alle waren auf der Straße, alle jubelten, sangen, tanzten. Es sprach sich rum, dass da ein Gringo, noch so jung und unerfahren, seine Wunden leckte. Alle wollten mit dem Verrückten, der immer besser Spanisch lernte, anstoßen. Trinken mit dem Deutschen, der vom Citlaltépetl gesprungen und von ihm gefallen war. Ohne Rettungsschirm. Weit abseits vom Gringo-Trail, zeigte Mexiko seine ganz andere Seite: „Da ging’s rund, unbeschreiblich.“
Es wurde ihm zu heiß
An jeder Ecke dampfte es und roch nach vielerlei. Fremde Gerüche für eine europäische Nase. Er machte seine Runde um den Zócalo, spazierte um den kreisrund angelegten Stadtpark, das Zentrum einer jeden mexikanischen Stadt. Hier, wo die großen und kleinen Metropolen des mittelamerikanischen Staates pulsieren und tausende Dämpfe wabern. Stefan trieb sich am Markt herum, sah sich viel an, war beeindruckt von den tollen Geschäften, die alles und nichts hatten. Und Stefan verliebte sich. Ganz langsam. Ihm selbst war das zunächst noch gar nicht bewusst. Nadia (Name geändert) war es, eine der drei Töchter der Familie, die sich um ihn kümmerte. „Alle drei waren hübsch, sehr hübsch, aber die eine …“. Sie war vergeben, eigentlich. An einen Polizisten, der immer am Wochenende kam. Und sie war schwanger, vom Ordnungshüter, zweifelsfrei. Der Bruder wachte über das Schwestern-Trio, die Mutter durfte von alledem noch nichts wissen. Stefan war das alles zu heiß, er musste weiter. Vorerst.
Der ursprüngliche Traum war dahin: Radeln ja, vielleicht, fliegen nein, ganz sicher. Er hatte ohnehin keinen Schirm mehr, der war oben, in einem Föhren-Baumstumpf. Gut versteckt, am Pico de Orizaba. Stefan suchte ihn vergeblich, als er später auf seinen Unglücksvulkan zurückkehrte. „Vermutlich haben sie mich dabei beobachtet, die Bauern, wie ich ihn in dieser Stammhöhle versteckte. Ich stand davor, da war ich mir sicher. Es war der richtige Baum.“ Sie konnten ihn gebrauchen, zu was auch immer. Zum Fliegen keinesfalls. Das Material war neu für sie, es hat sie garantiert fasziniert. Das Fluggerät war verschwunden.
Der Vulkan, der ihn einfach liegenließ, brachte Stefan schon wieder kein Glück. Nicht einmal danach.

Kapitel IV: Schon wieder ein Leben kaputt

Unterwegs in Lateinamerika.
Kapitel IV: Schon wieder ein Leben kaputt

Er wollte Spanisch lernen. So richtig, mit allem drum und dran. Jetzt, auf der Stelle. In Guatemala, einem landschaftlich einzigartigen Land, das nach vielen Bürgerkriegen in Korruption und Armut versank. Die Sprachschule war in Quetzaltenango, auf 2.234 Meereshöhenmetern. Für einen Monat schrieb sich Stefan ein. Er wohnte drei Wochen bei einer Familie, und er lernte Spanisch, in einer Stadt, die für ihre Sprachschulen bekannt ist und eine Partnerschaft mit dem norwegischen Tromsø pflegt, der nördlichsten Universitätsstadt der Welt. Jener Metropole im so weit entfernt liegenden Europa, etwas nördlich des Polarkreises, zu der Stefan sehr viel später ebenfalls eine Verbindung aufbauen sollte. Heute spricht er fließend Castellano. Es hat sich gelohnt, die Mühe in Lateinamerika. Manchmal fallen ihm die deutschen Begriffe für spanische nicht ein, wenn er erzählt.

Nach seinem Sprachkurs wollte Stefan wieder „rumdeifen“ („rumteufeln“ – eine hochdeutsche Erklärung für „rumdeifen“ ist schwierig. Ich beschreibe es mal mit „frei und ungezwungen umherreisen und bleiben wo man will“, also sowohl spontan, am Ende aber auch durchaus zielgerichtet/Anmerkung des Autors). Er spürte es ja schon lange, dass das Reisen „sein Ding“ ist. Er ging durchs Dorf, abends, ging spazieren. Voller Gedanken, voller Pläne und Träume, Gefühlswirrwarr durch und durch. Plötzlich eine leichte Berührung, im Gesicht, von hinten: „Es war der Schorsch“. Unglaublich, ein alter Bekannter aus Bad Reichenhall, sie kannten sich vom Gleitschirmfliegen. „Georg?“ Tatsächlich, der Schorsch. „Wahnsinn …“. Stefan war platt, sprachlos zuerst, so ein Zufall. Der BWL-Student, fünf Jahre älter als der Wiebei, wusste, dass der gerade in Lateinamerika unterwegs war. In seinen Semesterferien flog er einfach hin. Die Wahrscheinlichkeit, den Stefan tatsächlich zu finden, in einem riesigen Gebiet, tendierte gegen Null – wenngleich nahezu alle Gringos auf dem gleichen Trail unterwegs waren. Er traf ihn, seinen „alten“ Spezl, das Unmögliche klappte.
Der Schorsch hatte sechs Wochen Zeit zum „rumdeifen“. Aber Stefan musste noch seine Schule abschließen. Da lieh sich Georg Wiebels Rad und fuhr los. Beide hatte längst die Reiseleidenschaft gepackt. Am Lago di Atitlán trafen sie sich wieder, dem zweitgrößten See Guatemalas auf 1.560 Metern. Sie reisten weiter, radelten in den Norden, sahen das Land, fühlten es, erlebten es. Sie schauten sich Ruinen an. Tikal beispielsweise, eine antike Stadt der Maya in den Regenwäldern des gleichnamigen Nationalparks mit bemerkenswerten Stufentempeln. Sie war eine der bedeutendsten Städte der klassischen Maya-Periode (3. bis 9. Jahrhundert) und ist eine der am besten erforschten. In diesem kleinen mittelamerikanischen Land gefiel es Stefan. Mit allen Sinnen bereicherten die beiden ihr Empfinden. Sie reisten viel und intensiv, der Georg und der Stefan. Unter anderem mit dem Bus. Und sie besuchten einen Ausgewanderten aus der Heimat …

Guatemala: Warnung vor einer 200 Meter langen Glatteiszone – bei über 30 Grad im Schatten.
Stefan nannte ihn den „J.R. von Guatemala City“, der dort mit seiner Frau lebte, die ebenfalls aus seiner Heimat stammte. Die feierten, feierten feudal, feierten viel, fast unentwegt. Und wenn der Alkoholpegel einen gewissen Grad erreicht und/oder überschritten hatte, fingen sie an, mit ihren Karabinern und Westernpistolen auf die Palmen im Garten zu schießen, die Reichen der Stadt, der kleine Prozentsatz der Bevölkerung mit Geld. Jene also, die das Land regieren, anschaffen, sich aushalten lassen. Sie stachelten sich in ihrer gegenseitigen Arroganz an, wer die größeren Kugeln hätte und rissen riesige Löcher in die dicken, knallgrünen Blätter. „Leichte Mädchen“ vergnügten sich derweil kitschig „aufgebrezelt“ (hochdeutsch: zu stark geschminkt) am und im Pool und wurden später dazu gerufen. Zu den Waffennarren, den Mächtigen, den Hochnäsigen, den so oft Übergewichtigen. Irgendwann verschwanden sie. In geheimen Zimmern der Lodges. Immer zwei, mal drei. Abgeschlossen. Die braven Ehefrauen warteten daheim, hielten Haus und Hof in Schuss, zogen die meist recht umfangreiche Kinderschar groß – und ahnten bestenfalls, was bei den Partys so alles vor sich ging.
„Die waren nur noch deppert“, erinnert sich Stefan. Die Aktionen „J.R.’s“, der schon mal mit einer Cessna zum Kaffeetrinken an den Golfplatz flog, hielt er für „voll banana“. Wie die Feten am Pool. Er hatte bislang nur den (oberflächlichen) Straßeneinblick bekommen, ahnte nicht, was sich in einigen Gassen und vor allem hinter den Fassaden so alles abspielte. Jetzt erlebte er einmal kurz diese Glitzerwelt und wusste sofort, dass er weg musste. Mal wieder. Mal wieder schnell. Wie hätte er reagieren sollen, fragte er sich, auf den Umgang mit Alkohol und Mädchen, auf die sinnlose Ballerei auf Palmen, das sorglose Hantieren mit Waffen, als wäre es Spielzeug – er, der Kriegsdienstverweigerer.
Cowboystiefelzeit
Hand aufs Herz, Stefan: Wehrdienstverweigerer, da gab es zu Hause, beim Papa, dem Heeresbergführer, schon so manche Diskussion, oder?
Erstaunlicherweise nicht im Geringsten. Ich war bei der Musterung in Traunstein. Es waren die 80er-Jahre, Cowboystiefelzeit. Wir saßen im Flur, in Unterhosen (!) und unseren Angeber-Schuhen. Verrückt. Und ich wurde als „Zweier“ mit sage und schreibe elf Einschränkungen eingestuft. Das Kreiswehrersatzamt diagnostizierte krumme Beine und ein schiefes Kreuz bei mir. Da musste ich lachen. Ich kletterte im 8. Grad – und die bewerteten mich als gebirgsuntauglich (Stefan schüttelt noch heute den Kopf darüber/Anmerkung des Autors).
Sie bescheinigten dir tatsächlich Gebirgsuntauglichkeit?
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und Höhenuntauglichkeit obendrein. Obwohl ich schon mit 17 Gleitschirmflieger war. Ich gebe zu: Da war ich eingeschnappt und habe prompt verweigert. Eigentlich hatte ich mich bereits mit dem Gedanken angefreundet, in den Skizug zu gehen: Bergsteigen, Skitouren gehen, Skifahren, eine richtig gute Gebirgsausbildung, draußen sein. Der Dienst an der Waffe war für mich nie ein Thema, darum dachte ich mir: Wenn schon Bundeswehr, dann in einer Gebirgstruppe, die kraxelt, Ski fährt, in Bewegung ist. Das war nun schlagartig erledigt, aber in Ordnung. Ich musste mich nicht besonders damit abfinden. Ich machte Zivildienst bei den Sanitätern, das ebnete mir meinen späteren beruflichen Weg. Heute habe ich eine noch viel klarere Vorstellung von der Bundeswehr und würde auf jeden Fall verweigern.
In einem Dorf mit ausnahmslos dunkelhäutigen Bewohnern kauften Stefan und Georg einen Einbaum und stachen ohne Vorbereitung kurze Zeit drauf unbedarft in „See“ – die Mangrovensümpfe zwischen dem Rio Dulce („Süßer Fluss“) und dem Lago de Izabal, dem größten See Guatemalas, südlich von Livingston am Golf von Honduras, lagen vor ihnen. Nach wenigen Metern ging das Ding unter, es war viel zu klein, trug die beiden nicht. Stefan schaute seinen Spezl, den selbsternannten Einbaum-Spezialisten, fragend an. Der war verdutzt. Ein neuer, größerer Einbaum musste her. Er wurde geschnitzt, von Einheimischen, extra für sie, die beiden Oberbayern. „Ein echtes Gringo-Boot“, erinnert sich Stefan lebhaft.
Verpaddelt
Langsam tasteten sie sich vor, auf der spiegelglatt gespannten Oberfläche. Einer riesigen Glasscheibe gleich. Eine dünne Spur zeugte hinter ihnen von den bedächtigen Paddelzügen. Ist es so ruhig, wird auch der Reisende ganz still, bedächtig fast. Mückenalarm hin und wieder, drückende Schwüle, gewaltige Schweißperlen auf der schon sonnengegerbten Haut, sie tropften ihnen in die Augen. Übernachten in Hängematten, einmal ohne festes Land, zwischen zwei Bäumen, die im Wasser wachsen. Selbstverpflegung, kein Mensch weit und breit. Das Ziel: El Estor im Westen des 48 Kilometer langen und 20 Kilometer breiten, mächtigen und doch so friedlichen Gewässers.
Sie verpaddelten sich recht ordentlich, in der Einsamkeit, und gerieten in arge Not. Kein Land mehr in Sicht, geschweige unter den Füßen, kein Feuer mehr, kein warmes Essen. Die Hängematten hingen sie zwischen instabile Sträucher, das „war alles andere als beruhigend“. Stefan war schon wieder in eine Lage geraten, die sein Leben massiv bedrohte. So kurz nach seinem Absturz am Vulkan. Sie kamen wieder raus, aber Stefan weiß: „Wir wären heute noch drin, in den Sümpfen, hätten uns die Indios nicht wieder rausgeführt, zum rettenden Hauptfluss.“
Mit ihrem Einbaum kamen sie direkt zu einem Waisenhaus: „Hier hätte ich gern gejobbt.“ Es wurde nichts draus. Obwohl er es gut kann, mit Kindern. Touristen kommen hier nur sehr selten vorbei. Und wenn, erhalten sie keinen Einblick. Die Kinder sollen ihre Privatsphäre behalten. Sehr viel später war Stefan nochmal dort, mit seiner Irmi. Wieder kam er super bei den Kindern an. Doch er konnte nicht bleiben, wie schon 1992. Daheim wartete eine andere Arbeit, zumindest auch eine soziale.
Damals ging auch sein Geld langsam zu Ende. Ein Job hätte für weiteres Reisekapital gesorgt. Mit dem Schorsch ging es noch ein wenig durchs korrupte Land mit Orten im Hochsicherheitslook, streng bewacht. Militär allerorten. Die Reichen bewegten sich außerhalb ihrer Wohnungen lediglich mit gepanzerten Autos, und „wir fuhren dort mit dem Fahrrad rum und dachten uns nichts dabei“. Aus heutiger Sicht ein Himmelfahrtskommando. Sie sind einfach weitergereist. Rein nach Honduras.
Der Sohn von Hitler?
In einem anderen Dorf am Lago de Atitlán, in San Pedro La Laguna, verkrümelte sich Stefan, als er allein unterwegs war. Er wollte einer wilden Schießerei entfliehen. Unbedarft radelte er ins Dorf, fast wie in Trance. Plötzlich der Weckruf. In einem Gefängnis brach eine Rebellion aus. Es gab mehrere Tote, noch mehr Verletzte – wie meist in solch sinnlosen Auseinandersetzungen gerade unter völlig unbeteiligten Bürgern. Irgendwann wusste keiner mehr, wer hier eigentlich gegen wen kämpfte. Das Militär machte Hatz auf die Guerilla, die Guerilla auf die Einheimischen, die Einheimischen schoben alles aufs Militär. Alle wollten das Sagen haben, niemand hatte wirklich etwas zu sagen, es war ein wildes Durcheinander. Bürgerkriegsnah bereits. Und er, der Wiebei aus Bad Reichenhall, mittendrin.
Von Touristen hatte er von solch unfassbaren Geschichten gehört und fragte sich, wie er wohl reagieren würde, käme er in die brenzlige Lage eines Überfalls. Sein gutes Spanisch beruhigte Stefan: „Ich wollte damit imponieren.“ Eigentlich war er hier, um Land und Leute kennenzulernen. Diese Intensität konnte er nicht erwarten und war ihm zu viel. Später, auf einer Bergstraße, begegneten ihm Zahnlücken-Jungs auf einem rostigen Pick-up, vier Reifen ohne Profil, wie seine Insassen. Fünf Zwielichtige mit Mundgeruch. Sie betrachteten es als Gag, den deutschen Gringo zu ärgern und ihre Pistolen zu präsentieren, zielten aber nicht auf ihn. Sie „empfingen“ ihn, in einer Parkbucht, er hatte keine Chance, um auszuweichen. „Ich musste an ihnen vorbei. Hätte ich umgedreht, wären sie mir so oder so gefolgt.“ Er wusste sofort: „Brotzeit werden die nicht mit mir machen wollen.“ Sie fuchtelten mit ihren Knarren herum und zeigten ihm einen Vogel, weil er es „wagte“ bergauf zu radeln. Sie verstanden nicht, dass jemand „so etwas Verrücktes“ tut. „Wo fährst du hin?“, löcherten sie ihn. „Wo kommst du her?“ Deutschland? Ost oder West? Und: „Bist du der Sohn von Hitler?“ Die Wende war zwei Jahre her. Stefan konnte so wenig Bildung auf so „viel“ Hirn nicht fassen.
Griffbereit verweilten – für exakt solche Situationen – ein paar Scheine, Cash, Bares, in seiner Hosentasche. Sie sprachen Slang mit ihm, absichtlich, damit er sie nicht verstehen konnte. Denn Spanisch konnte er mittlerweile, sehr gut sogar. Und wieder war das Hauptaugenmerk auf die Schuhe gerichtet. Hinten am Gepäckträger hatte Stefan richtig feine Camel Boots dabei. Schuhe bedeuten in Lateinamerika puren Reichtum. Natürlich nahmen sie ihm diese, plus seine Kamera. Die Rollei war denen wichtiger als das Fahrrad – letztlich war’s Stefan so herum lieber. Ab jetzt gab es allerdings keine Fotos mehr … – weil er keinen vernünftigen Apparat mehr in den schlecht ausgerüsteten Läden fand. Die Gehäuse dort wirkten, als sei da gar nichts drin, als wären es Attrappen. Wochenlang drückte er schweren Herzens keinen Auslöser. „Das tat so weh, bei all den faszinierenden Landschaften.“ Barfuß machte er sich nach dem Überfallsschreck auf den Weg, radelte schuhlos mit seinen gezackten Pedalen in den nächsten Ort, besorgte sich erst mal ganz einfache Flip-Flops. Vernünftige Schuhe zum Radeln und Bergsteigen fand er erst Tage später.
Sein Spezl Georg erlebte ähnliches: In Mexiko-City, vorm Flughafen, hielt der Schorsch Ausschau nach einem Busbahnhof. Er wollte gleich weiter, nach Guatemala, vermutete dort seinen Freund. Da stand ein Auto, daneben zwei junge Burschen. Sie machten einen gelangweilten Eindruck, sie „chillten“ wohl. Plötzlich hatte der ratlose Deutsche einen Revolver am Kopf. Mit erhobenen Händen musste er losgehen … – bis er merkte, dass sich die beiden einen höchst üblen Scherz erlaubt hatten. Als er nichts mehr hörte, drehte er sich vorsichtig um und sah die Frechen nicht mehr. So schnell wie möglich löste der Schorsch ein Ticket, bestieg einen Bus und verschwand aus dem Moloch Mexiko-City Richtung Quetzaltenango (für die Einheimischen Xelajú, kurz Xela, gesprochen „Schela“): Umgeben von hohen Vulkanen, ein belebter, farbenfroher Ort voller Indios, im Südwesten Guatemalas nahe der berühmten Panamericana, zirka 140.000 Einwohner.
Jetzt war Georgs Urlaub vorbei. Er musste heimfliegen. Stefan wollte ein Jahr wegbleiben, darauf war die Reise ausgelegt. Acht Monate lagen hinter ihm. Zeit war also noch übrig, reichlich, aber das Ende seiner finanziellen Mittel nahezu erreicht. Nach rund 4.000 Kilometer radeln zwischen Mexiko und Costa Rica und Erlebnissen, die für zwei Leben reichten, war kaum noch Geld übrig. Er deponierte sein Rad in einem Hotel am Pazifik, denn er wusste, dass er wiederkommen würde. Er holte es später tatsächlich ab, bei einer erneuten Lateinamerika-Reise.
Stefan jettete zurück nach Mexiko, um seinen Rückflug nach Deutschland umzubuchen. One-Way-Tickets gab es damals nicht. Die Flüge waren unglaublich teuer, 2.200 D-Mark. Alles sollte jetzt locker auf ihn zukommen, das wollte er. Er kam zurück zu Nadia und ihrer Familie, die ihn so herzlich aufgenommen, so sanft (gesund)-gepflegt hatte. Und wo noch eine Herzsache auf ihn wartete. Sie war noch immer schwanger, na klar. Mehr denn je. Ihr Streifenhörnchen hatte Familie und Kinder, die natürlich nichts von ihrem „außertourlich beschäftigten“ Ehemann und Papa wussten. Genauso wenig wie Nadias Mutter samt Schwestern und Bruder, dem Aufpasser, dem Beschützer. Der Polizist ließ Nadia im Stich, ließ sie links liegen. Sie saß in ihrem Dorf, mit 17, knapp 18 – und hatte keine Chance. Andere Männer interessierten sich nicht für sie, nicht in „diesem Zustand“, nicht „derart befleckt“.
Stefan erzählte ihnen alles. In gutem Spanisch. All seine Erlebnisse. Nach drei, vier Tagen war es perfekt, sein Castellano. „Da lernte ich mehr als zuvor in einem Monat. Sie wollten alles wissen.“ Und er musste zusehen zurückzukommen. Die Zeit drängte. „Ich musste abchecken, was in Deutschland los ist, mit der Familie, wie es für mich weiterging, beruflich.“ In Nadias Familie war er längst integriert, ihre Mutter hatte Stefan in ihr Herz geschlossen. Sie zog vier Kinder groß, allein. Mit ihrer kleinen Hühnerbraterei brachte sie alle durch. Harte, schweißtreibende Maloche auf offener Straße, ein Pizzaofen, den die älteste Tochter betrieb, ein kleines Lokal dabei. Als Stefan ein paar Monate zuvor dort ankam, sah er drei hübsche Mädels und einen skeptisch dreinblickenden Bruder, der in der Küche schuftete und ihn gleich mal prüfte: Wo er überhaupt herkomme, was er überhaupt hier wolle. Stefan hatte Hunger, großen Appetit. Das gefiel dem mexikanischen Quartett: Der Mutter, dem Bruder, der einen Schwester und auch der anderen, dem Küken, dem Püppi, die mit ihrem Plingpling-Augenaufschlag irgendwie für nichts zuständig war und nichts tat. Ein „Wienerwald“ mit Sombrero. Das gefiel dem Gringo aus Bayern.
Sie luden „ihren Esteban“ (= spanisch für Stefan) ein. Nach Acapulco, touristisches Mexiko-Highlight. „Ich wollte da nicht hin. 30 Stunden Fahrt, nur um Hotels und Strand zu sehen und Ausflüge zu machen, dorthin wohin die Mexikaner am liebsten reisen. Das war nicht mein Ding. Außerdem konnte ich mir das gar nicht leisten.“ Doch er musste sich gar nichts leisten, er musste mit, ohne Diskussion. Nadias Bruder gab keine Ruhe, er hatte Stefan wohl schon als seinen neuen Schwager auserkoren. Es kostete ihn keinen Peso, sie bezahlten alles. Der Mutter war es egal, ob sie für fünf oder sechs „Kinder“ aufkam. Und es wurde enger, mit Nadia. Sie erzählte Stefan so viel, er gefiel ihr, sie gefiel ihm. Und der Polizist, der Vater, wusste nun auch von der Schwangerschaft.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.