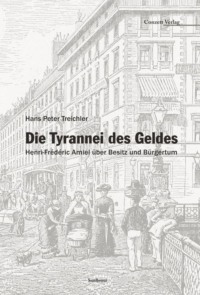Kitabı oku: «Die Tyrannei des Geldes»
| Hans Peter Treichler | Die Tyrannei des Geldes Henri-Frédéric Amiel über Besitz und Bürgertum |
HANS PETER TREICHLER
Die Tyrannei des Geldes
Henri-Frédéric Amiel über Besitz und Bürgertum

Autor und Verlag danken für die Förderung des Werks durch die
STEO-STIFTUNG ZÜRICH
Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck in jeder Form sowie die Wiedergabe durch Fernsehen, Rundfunk, Film, Bild- und Tonträger, die Speicherung und Verbreitung in elektronischen Medien oder Benutzung für Vorträge, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung des Verlags
1. Auflage 2012
© Conzett Verlag by Sunflower Foundation, Zürich
Satz und Gestaltung: Vreni Stoob, St. Gallen
Bildbearbeitung: Meithal AG, Zürich
ISBN 978-3-03760-011-5
Weitere Informationen finden Sie unter
www.conzettverlag.ch und www.sunflower.ch
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
Inhalt
Vorwort
KAPITEL 1 Ein Leben im Rückwärtsgehen
KAPITEL 2 Genf – die magischen Jahre
KAPITEL 3 Der Literat und das Geld oder La tyrannie de l’écu
KAPITEL 4 Liebe und Mitgift
KAPITEL 5 Standesgemäss leben
KAPITEL 6 Les reflets de l’or: Psychologie des Geldes
KAPITEL 7 Der Schweizer Franken: Patenkind des Elysées
KAPITEL 8 Das Geld und die Zeit
KAPITEL 9 Banken und Börsen
KAPITEL 10 Gefahr des Versteinerns: das Bürgertum
EPILOG Ein Liebhaber des Halbschattens
Anhang
Bibliografie
Bildnachweise
Textnachweise
Jahr für Jahr – Zeittabelle
Register
Vorwort
Genf im 19. Jahrhundert: Täglich schreibt der Philosoph Henri-Frédéric Amiel seine Eindrücke nieder und hinterlässt 16’900 Seiten gelebtes Leben. Ein Journal intime mit verblüffenden Gedanken und Ideen. Denn Amiel trifft 150 Jahre vorweg den Kern der Finanz- und Gesellschaftskrise des angehenden 21. Jahrhunderts.
«Die bürgerliche Gesellschaft», mahnt Amiel im Tagebuch, «die sich auf das Geld gründet, geht durch das Geld unter, wenn das Symbol die Sache selbst ersetzt.»
Das schreibt Amiel 1851. Es ist die Zeit der grossen Romane von Victor Hugo und Honoré de Balzac. In Paris. Auch im kleinen Genf sitzt einer, der sich Gedanken macht. Gedanken, die heute so aktuell sind wie damals.
Was spricht Amiel hier an? Wer das Geld mit der Sache selbst verwechselt, erkennt die Beziehungen hinter dem Geld nicht. Alles wird materialisiert. Doch wenn wir auch die menschlichen Beziehungen materialisieren, geht die herkömmliche Gesellschaft unter. Wie ungeheuerlich wirkt seine Prophezeiung erst für eine Zeit, in der wir das Symbol, die Banknote, die Münze nicht mehr anfassen können? Eine neue Gesellschaftsform bahnt sich an.
Gerne verfolgen wir Amiels Gedanken zu Geld, aber auch zu Liebe und Mitgift, zum Bürgertum, zum Genf seiner Zeit.
Jürg Conzett

Henri-Frédéric Amiel in seinen ersten Jahren als Dozent an der Académie (Porträt von 1852). Viele Bekannte merkten seine Ähnlichkeit mit dem Freiheitshelden Garibaldi an. Der Poet und Philosoph Amiel ist aber alles andere als ein Kämpfer. Zurückgezogen lebend, führt er während Jahrzehnten ein Tagebuch voller tiefsinniger Einsichten über das Wesen des Menschen und der Gesellschaft.
KAPITEL 1
Ein Leben im Rückwärtsgehen
Combien un peu d’or de plus ou de moins change la vie!
Cela révolte la fierté de l’âme. La tyrannie de l’écu est avilissante.
Il est ignoble de poursuivre la fortune; il est irritant
de dépendre de Mammon.
Ein paar Goldstücke mehr oder weniger – wie sehr verändern sie doch das Leben! Das empört die Seele in ihrem Stolz. Die Tyrannei des Geldes ist erniedrigend. Es ist würdelos, dem Reichtum nachzujagen; es ist irritierend, vom Mammon abhängig zu sein.
Der Mann, der diese Sätze festhielt, brauchte nicht würdelos dem Geld nachzujagen. Henri-Frédéric Amiel (1821–1881) stammte aus einer gutsituierten Genfer Kaufmannsfamilie, erhielt schon mit 28 eine Professur für Ästhetik an der Genfer Académie und wurde in seinen Kreisen als geistreicher, liebenswürdiger Causeur geschätzt. Frauen liebten seinen sanften, ein wenig melancholischen Blick und seine einfühlende Art; er galt für manche Genfer Familien als begehrter Junggeselle. Zwar trug ihm die Stellung als Dozent nur ein bescheidenes Gehalt ein, aber Amiels Eltern hatten ihren Kindern ein ansehnliches Vermögen hinterlassen. Sowohl Vater wie Mutter verstarben früh; die Familie eines Onkels hatte den 13-jährigen Henri-Frédéric und die beiden Schwestern aufgenommen und ihnen eine «standesgemässe» Erziehung ermöglicht. Für Amiel bedeutete das: Ausbildung an der Académie, daran anschliessend lange Studienjahre im Ausland, vor allem in Berlin, Abschluss in Philosophie und Geistesgeschichte, die Berufung nach Genf.
Trotzdem fand sich Amiel im mittleren Lebensalter in einer unbequemen Zwischenstellung. Zur aristokratisch getönten Genfer Oberschicht der Gelehrten und Bankiers mit Namen wie Pictet, Dufour und de Saussure, die er als «gutes altes Felsgestein» achtete, hielt er Abstand. Noch weniger behagten ihm die dynamischen Kaufleute und Unternehmer radikaler Prägung. Sie hatten in den Mittvierzigerjahren in einem blutigen Putsch die politische Macht erobert und Amiel indirekt zu seinem Posten verholfen. Denn unter dem Diktat des charismatischen Regierungspräsidenten James Fazy entliessen die Radikalen den Grossteil der konservativ gesinnten Dozenten der Académie, sofern diese nicht von sich aus kündigten. Amiel brach, beflügelt von der Aussicht auf einen Lehrstuhl, seine Studien in Berlin ab und erhielt prompt seine Berufung. Die noch ausstehende Dissertation schrieb er in ein paar Wochen herunter; im Oktober 1849 hielt er die erste Vorlesung.
Aber die folgenden Jahre zeigten Amiel seine schiefe Stellung immer deutlicher auf. Weder gehörte er zum «Felsgestein» noch war er Radikaler, vom Temperament her eher ein stiller Gelehrter, doch mit künstlerischem Ehrgeiz. Er veröffentlichte, ohne grossen Erfolg, einige Gedichtbände, die ihn einem Kreis von Literaten, Malern und Musikern nahebrachten. Aber die damit verhakte Welt der Genfer Boheme blieb ihm zutiefst fremd, und die Bohemiens selbst rieben ihm seinen einzigen wahrhaften Publikumserfolg unter die Nase: Amiel hatte unter dem Titel Roulez, tambours! ein reichlich pathetisches Vaterlandslied verfasst. Zahlreiche Studienfreunde von früher waren Theologen und jetzt als Pfarrer oder Dozenten in der Stadt tätig. Aber auch zu ihnen fehlte ihm der rechte Zugang. Sie schienen ihm verkörpert in seinem Schwager Franki Guillermet: rechtschaffen und dabei ehrgeizig, dauernd gemessen an ihren Erfolgen mit «schwungvollen», «mitreissenden» Predigten – ein Graus!
Auch in Amiels Beziehung zu den jungen Frauen seines Kreises zeigte sich eine deutliche Fehlhaltung. Anmutige und gescheite Töchter voller Herzensbildung wurden ihm vorgestellt; sie schieden aus, eine nach der anderen. Sara Cherbuliez, die Tochter eines Dozentenkollegen, hat «tieffarbene meergrüne Augen» und errötet sichtlich, wenn er sich zur Runde im Salon gesellt. Ein reizendes Mädchen, ein grundsolides, gebildetes und sympathisches Milieu ... aber: keine Mitgift! Die Pfarrerstochter Henriette Vaucher zeigt «liebenswerte Ehrlichkeit und bescheidene Güte», ist hübsch und vermögend ... aber: zahlreiche Gebrechen im Familienkreis, beunruhigende Erbanlagen! Im April 1858, nach zahlreichen Bekanntschaften, muss Amiel gestehen: «Ich bin praktisch unverheiratbar (in-mariable), weil ich eine ungeheure Abneigung gegen den Zufall hege.»
Weshalb sollten wir uns befassen mit diesem wenig überzeugenden Dozenten und erfolglosen Poeten? Es war gerade die unbehagliche Stellung zwischen zwei Welten, die aus dem nach aussen hin so umgänglichen Junggesellen einen rabiaten Skeptiker und scharfen Beobachter seiner Umgebung machte, aber auch einen ewigen Zweifler und Zauderer. Ein grösseres kulturgeschichtliches oder philosophisches Werk, wie Amiel es zeitlebens von sich selbst verlangte, gelang ihm nicht. Dafür waren die Selbstzweifel zu mächtig, verschlang die Vorbereitung der Vorlesungen zu viel Zeit und Energie. Kam hinzu, dass er schon vor seiner Rückkehr nach Genf und erst recht von da an die Gewohnheit angenommen hatte, am Abend jedes Tages seine Eindrücke und Überlegungen schriftlich festzuhalten. Obwohl er sich selbst verdächtigte, in dieser Routine «einen Ersatz für das Leben zu suchen» und seine schöpferische Kraft in einen Nebenkanal abzuleiten, hielt er bis kurz vor seinem Tod an den täglichen Einträgen fest. Den Erben fiel ein Konvolut von 170 Heften zu, insgesamt 16’900 dicht beschriebene Seiten. Sie deckten die drei Jahrzehnte von der Jahrhundertmitte bis zu Amiels Tod praktisch lückenlos ab. Amiel selbst hatte die Papiere sorgfältig in Schachteln aufbewahrt, sie nummeriert und datiert und die Titelseiten mit Merksprüchen und Versen versehen. Bemerkungen und Verweise in den Seitenspalten zeugen davon, dass der Autor sein Journal intime immer wieder durchging, in den alten Heften blätterte, auch wenn er sich selbst oft dafür schalt, «ein Leben im Rückwärtsgehen» zu verbringen.
Was ihm vorschwebte, war eine Art Digest, eine Blütenlese, die nach seinem Tod erscheinen würde. Könnte man, so wünschte er, von diesem hüfthohen Stoss von Seiten «deren 500 retten, so ist das viel, vielleicht genug». Genauso sollte es sich abspielen: 1883 brachte der einstige Freund Edmond Scherer, jetzt Redaktor in Paris, die Fragments d’un journal intime heraus. Es waren Tagebuchauszüge in zwei Bänden, über die Einträge von Jahrzehnten hinweg herausgepflückt, dazwischen gestreut Gedankensplitter und Aphorismen aus Amiels vergessenen Gedichtbänden. Die Fragments fanden auf Anhieb durchschlagenden Erfolg, wurden ein Dutzend Mal neu aufgelegt, in viele europäische Sprachen übersetzt. Nietzsche, Hofmannsthal und Gide priesen sie, Leo Tolstoi leitete eine russische Ausgabe in die Wege und fand in den Fragments Passagen «voller Leben, Weisheit, Lehrhaftigkeit und Trost». Sie würden, so Tolstoi im Vorwort, «für immer eines jener besten Bücher bleiben, die uns unverhofft hinterlassen wurden von Menschen wie Marc Aurel, Pascal, Epiktet». In gewissem Sinn erfüllten die beiden Bändchen die Forderung, die der Autor immer wieder an sich selbst gestellt hatte: ein die Generationen überdauerndes œuvre zu schaffen.
Vor allem aber machten sich die Merksprüche selbständig, die Kernsätze und Aphorismen. Sie erschienen auf den Rückseiten von Kalenderblättern und in schmucken Almanachen – grosse Wahrheiten in kleiner Form, viele davon mit mahnendem, warnendem Unterton: «Das Schicksal hat zwei Möglichkeiten, uns zu zermalmen: indem es sich unseren Wünschen versagt – oder sie erfüllt.» «Der Mensch, der alles vollkommen klar sehen will, bevor er sich entscheidet, fasst nie einen Entschluss.» Die Hausfrau, die am Morgen das perforierte Kalenderblatt abtrennte, las vielleicht «Ein Irrtum ist umso gefährlicher, je mehr Anteile an Wahrheit er enthält», sinnierte womöglich über einem Ausspruch wie «Jede Landschaft ist ein Zustand der Seele – Un paysage quelconque est un état de l’âme». Vieles, was uns heute als redensartliche Formel erscheint, stammt aus dem Journal intime, beispielsweise «Man ist so alt, wie man sich fühlt». Ebenso das vielzitierte «Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg», das wir eher einem amerikanischen Manager-Handbuch zuordnen würden (Nothing succeeds like success). Amiel hielt die Einsicht im März 1868 fest, bezeichnenderweise an einem Tag, an dem er sich schlaff und unwohl fühlte: Rien ne réussit comme le succès. Von Amiel stammt auch das von Zivilisationsskeptikern vielfach übernommene und abgewandelte Wort «Tausend Dinge rücken vor, 999 machen einen Schritt zurück. Das nennt man Fortschritt». Selbstverständlich sind seine Aphorismen heute auch auf dem Internet abrufbar, unter Sparten wie Best Quotes Amiel oder Amiel Quotes and Sayings. Aus dem Selbstzweifler, dem schüchtern-charmanten Professor ist eine Art Guru geworden, ein Mann des knappen und präzisen Wortes.
Heute liegt das Journal intime vollständig im Druck vor, in zwölf dickleibigen Bänden, nach einer verlegerischen wie wissenschaftlichen Parforcetour, die 1994 abgeschlossen wurde. Der Index gibt nur einen schwachen Eindruck der Themen, die Amiel im Verlauf der drei Jahrzehnte abhandelte, dies neben den gleichsam gesetzten Einträgen über die praktischen Tätigkeiten, über das tägliche va-et-vient. Ausführliche Passagen handeln von Religion, Philosophie, Politik, von der zeitgenössischen Genfer Gesellschaft, der Psychologie der Nationen, vor allem aber: vom Seelenleben des Autors selbst. Die tägliche Stunde am Schreibtisch erlaubte ihm, «allen Purzelbäumen und Bocksprüngen des inneren Lebens zu folgen», den Menschen zu studieren «anhand eines komplizierten Exemplars der Rasse» – seiner selbst. Dazu gehören Einsichten, die man heute der Tiefenpsychologie zuordnen würde. Amiel hielt zahlreiche Träume fest und interpretierte sie mit erstaunlichem Scharfblick für die Abläufe und Finten des Unbewussten. Manche Einsichten über die Mechanismen des Traums nehmen die Erkenntnisse von Freuds 1900 erschienener «Traumdeutung» vorweg – um Jahrzehnte.
Das einführende Zitat weist darauf hin: Die folgenden Kapitel befassen sich mit Amiels Ausführungen zum Geld, zu Besitz und Besitzdenken, zur Ungleichheit der Güterverteilung und zum Verhältnis von Prestige und Vermögen. Gleichsam von der Seitenlinie aus folgte der Aussenseiter Amiel einer Art Versteinerungsprozess, der sich innerhalb der Bourgeoisie vollzog. Der alte Genfer Kaufmannsgeist, der Leistung und Verdienst betonte, schien ihm im Verschwinden begriffen. Eine Mentalität des Behaltenwollens, der Absicherung schien ihm überhandzunehmen; im Zentrum stand der Besitz, als absolute Grösse. «Die bürgerliche Gesellschaft», mahnte Amiel im Tagebuch, «die sich auf das Geld gründet, geht durch das Geld unter, wenn das Symbol die Sache selbst ersetzt.»
Das war eine Entwicklung, die sich nur schwer in Zahlen fassen liess. Anders die Welle von Spekulation und zügellosem Gewinnstreben, welche die Stadt um die Jahrhundertmitte heimsuchte. 1852 war die Genfer Börse gegründet worden, die erste der Schweiz, vier Jahre später hatte sie sich in der Form der Ringbörse etabliert. Hier trat eine neue Generation von Financiers auf den Plan: Kaufleute und Unternehmer mit dem Ehrgeiz, Genf ans internationale Finanzwesen anzugliedern. Gestandene Geschäftsmänner – so Amiel – trieben sich nun im Börsenvorsaal herum, statt sich ihrem Unternehmen zu widmen: «Was für ein stumpfsinniges und unterwürfiges Metier! Das Sinnen und Trachten des Menschen darauf gerichtet, die Krümel vom Geld einzusammeln, die Goldstücke schwitzen zu lassen, vorne dranzubleiben im Spiel von Kauf und Verkauf, Hausse und Baisse, Terminkauf und freiem Kauf – puuuh!» Die wachsenden Umsätze der Börse zeugten von der Faszination des neuen Instituts, aber auch die zahlreichen Konkurse und Insolvenzerklärungen, Selbstmorde und Skandale. Davon blieb selbst die Banque Générale Suisse nicht verschont. Unter Bürgermeister James Fazy 1853 eröffnet, war sie mit 25 Millionen Gründungskapital für damalige Verhältnisse ein Big Player, engagierte sich für den Bau eines Kanals durch Panama und bei der Bahngesellschaft Chemins de fer de l’Ouest, beide Male mit grossen Verlusten. Nach dreizehn Jahren ging sie in Konkurs. Fazy verlor sein gesamtes Vermögen; zahlreiche Anleger erlitten schwere Einbussen. «La ruine est facile pour les châteaux de cartes», kommentierte Amiel; Kartenhäuser stürzen leicht zusammen.
Was er «Plutolatrie» nannte, die Verehrung oder Anbetung des Geldes, war für ihn auf heillose Weise verknüpft mit den Vereinigten Staaten, mit dem dort herrschenden Ideal des selfmade man. Obwohl überzeugter Anhänger des republikanischen Prinzips, stand Amiel den demokratischen Idealen der absoluten Gleichberechtigung skeptisch gegenüber. «Wenn es einmal nur noch gleichberechtigte Einzelwesen geben wird, ohne Unterschied zwischen jung und alt, zwischen Mann und Frau, Empfängern und Wohltätern, wird der gesellschaftliche Unterschied allein vom Geld ausgehen.» La différence sociale se fera par l’écu.
So wie seine Stellung in der Gesellschaft auf schwankendem Grund ruhte, war Amiel ein nachlässiger Verwalter der eigenen Einkünfte und seines Vermögens. «Diese ganzen Budgetangelegenheiten langweilen mich», meldet das Tagebuch jeweils zu Jahresbeginn, «und ich gestehe zu meiner Schande, dass ich die Flinte ins Korn geworfen und meine Konten das ganze Jahr nicht nachgeführt habe.» «Ich weiss nicht, was ich genau eingenommen habe», heisst es an anderem Ort, «und was ich berechtigterweise ausgeben darf – kurz: meine Geschäfte stehen Kopf und es ist möglich, dass meine Befürchtungen lächerlich sind oder meine Hoffnungen verstiegen.» Und weshalb fehlte ihm «der Instinkt für das Eigentum, das Beherrschen und Besitzergreifen»? Hatte dieser Mangel zu tun mit dem Schicksal seines Vaters? Jean-Henri Amiel hatte sich während Jahren aufgerieben im Kampf um die Erbschaft seiner Gattin, in einem zermürbenden Rechtsstreit mit Vorladungen, Urteilen, Anfechtungen und gehässigen Anschuldigungen. Der Vater, ein Kaufmann, war seinem Instinkt gefolgt, hatte gekämpft. Aber stand es denn einem Philosophen, einem homme d’esprit wie Amiel junior, an, sich in die Niederungen des Feilschens und Prozentrechnens zu begeben oder sich mit seinem Arbeitgeber über die Höhe des Salärs zu streiten?
Auch das sind Fragen, auf welche die folgenden Kapitel eingehen: die Stellung des Literaten in Staat und Wirtschaft, die Psychologie des Geldes ganz allgemein, über die das Tagebuch bemerkenswerte Einsichten liefert. In seiner Gesamtheit bietet das Journal intime Stoff für eine Art Ökobiografie, den finanziellen Lebenslauf eines Einzelnen. Darüber hinaus offeriert es viele Einblicke in die Besitz- und Erwerbsmentalität einer Epoche, die der heutigen in vieler Hinsicht gleicht.
Wie müssen wir uns den äusseren Rahmen vorstellen, in dem dieses Leben abläuft? Spielt die «Tyrannei des Geldes», die der Eingangstext anspricht, darin eine Rolle? Und hält sich der Autor selbst an die Einsichten und Maximen, die seinen Namen weltweit bekanntmachten? Sein Alltag in den Jahren ab 1850 folgt jedenfalls einem geordneten Rhythmus mit Vorlesungen, meist an drei Wochentagen, mit Prüfungen und Benoten von Semesterarbeiten. Gelegentlich übernimmt Amiel eine Vortragsreihe bei den öffentlichen Veranstaltungen im Hôtel de Ville, einer Art Volkshochschule. Aber hier wie dort wird erwartet, dass der Redner frei spricht, weder auf Notizen schaut noch gar vom fertig formulierten Script abliest. Das erschwert Amiel die Aufgabe ungemein. Nur im privaten Kreis kann er im Gespräch überzeugen und mitreissen. Vor Publikum fühlt er sich unsicher und gehemmt. «Dreissig Ideen genügen mir nicht, um eine Stunde zu füllen», heisst es so oder ähnlich immer wieder, «so wenig weiss ich meine Exposition zu entwickeln, auszufüllen und zu polstern. Auch stelle ich fest, dass ich überhaupt nichts zu meiner intellektuellen Verfügung habe, keine Manövriermasse, keinen Grundstock.»
Der Sommerurlaub führt Amiel gelegentlich ins Ausland, 1851 beispielsweise an die Weltausstellung in London, meist aber in die Gegend rund um Montreux, die er über alles liebt. Hier läuft er im ungezwungenen Kreis der Pensionsgäste gelegentlich zu grosser Form auf, trägt an regnerischen Nachmittagen ganze Bühnenstücke vor, gibt au vol, aus dem Stand, jeder Rolle ihre eigene Stimme. Manche Gäste sind den Tränen nahe und vergleichen ihn mit den besten Vorlesern auf Europas Bühnen, stellen ihn noch über den berühmten Mimen Eduard Devrient.
Ein vielseitiger Mann – wenn man ihn lässt. Aber der Alltag in Genf kennt kaum solche Sternstunden. Wenn nach der Vorlesung ein Student mit einer Frage an der Tür zum Hörsaal wartet, wird dieser kleine Erfolg bereits im Tagebuch vermerkt. Nach der Verheiratung seiner Schwester Fanny mit Pastor Franki Guillermet, einem hageren Geistlichen, schliesst sich Amiel der Familie an, als eine Art Pensionär. 1859 zieht der Haushalt in eine geräumige Stadtwohnung an der Cour Saint-Pierre, dem Kathedralenplatz im Herzen der Stadt. Amiel übernimmt zwei Mansardenzimmer, stattet sie aus mit seiner umfangreichen Bibliothek von 2500 Bänden. Das ist alles idyllisch, gemütlich, mit knisterndem Kaminfeuer und dem Blick über die Dächer der Altstadt – aber kein Raum zum Vorzeigen. Stattet ihm ein auswärtiger Student seine Antrittsvisite ab, muss er ihn im Salon von Fanny und Franki empfangen. Hier ist womöglich nicht aufgeräumt, brennt kein Feuer im Kamin ... ein unbefriedigender Zustand!
Auf die Dauer lässt sich der gemeinsame Haushalt mit der Pfarrersfamilie nicht aufrechterhalten: «Zehn Jahre haben den Vorrat an gutem Willen aufgebraucht, und ich sollte auf eigenen Füssen stehen.» 1869 – als 48-Jähriger – bezieht Amiel erstmals eine eigene Wohnung. In die gleiche Zeit fällt sein erster und letzter ernsthafter Versuch, eine Familie zu gründen; er verlobt sich mit der Pastorentochter Anna Droin. Aber nach wenigen Wochen geben sich die beiden ihre Briefe und Geschenke zurück. Zu unterschiedlich sind die Erwartungen: Amiel hat die stille Art der Verlobten als Tiefsinn und Abgeklärtheit interpretiert, Anna ihrerseits fühlt sich vom Anspruch auf gehaltvolle Gespräche und Briefe völlig überfordert.
Es bleibt ein Kreis anteilnehmender und bewundernder Freundinnen, von Aussenstehenden als les amiélines belächelt. Man trifft sich im Sommer und Herbst in den Kurorten am Léman zu gemeinsamen Ausflügen und Gesprächen, man wechselt Briefe. Als besondere Gunstbezeugung wertet es der Musenzirkel, wenn eine der Anhängerinnen ein Heft des Journal intime ausgeliehen erhält. Besonders die Lehrerin Fanny Mercier ist von der überragenden literarischen Bedeutung des Tagebuchs überzeugt. Sie ist es denn auch, die eine Auswahl markanter Passagen und Merksprüche zusammenstellt und nach Paris übermittelt, dies in den Monaten nach Amiels Tod. Denn in den späten 1870er-Jahren verschlechtert sich seine Gesundheit zusehends: Atemnot, Hustenkrämpfe, allgemeine Schwäche. Die Vorlesungen, an denen er bis Februar 1881 festhält, erschöpfen ihn immer mehr. Die letzten Monate verbringt er, kaum je das Haus verlassend, in der Pension von Berthe Vadier, einer weiteren Freundin, die er ma filleule nennt – seine Patentochter. Sie und ihre Mutter pflegen ihn aufopfernd; der letzte Eintrag im Journal ist denn auch ein Dank an ihre Hingabe. Er stammt vom 29. April; zehn Tage später stirbt Amiel. Das Krankenzimmer ist vollgestellt mit Blumen, Dosen voll Konfekt und anderen Geschenken, die in den letzten Wochen eingetroffen sind – «von Freunden, die zum Teil weit entfernt wohnen», wie er verwundert feststellt.

In keiner anderen Epoche verändert sich das Stadtbild von Genf so radikal wie in den Jahren um 1850. Die Stadt öffnet sich zum See; es entstehen grosszügige Quaianlagen und Strassenblocks mit Hotels und Kaufhäusern. Sie besetzen den Platz, den zuvor die seit langem unnütz gewordenen Befestigungsanlagen eingenommen haben.