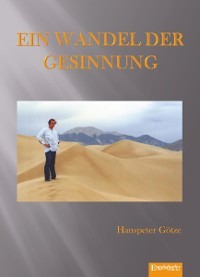Kitabı oku: «Ein Wandel der Gesinnung»
Hanspeter Götze
EIN WANDEL DER GESINNUNG
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2015
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2015) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2015
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
In den Fängen der Sucht
Unrühmliche Hinterlassenschaft aus der Trinkerzeit
Impressionen aus Wilhelmsheim
Die Wiederkehr der Gefühlswelt
Die Wahrnehmung der eingetretenen Veränderungen
Die Erfolgsgaranten für eine zielführende Abstinenz
Mein Nachschlagewerk bei besonderen Anlässen
Fußnote
Vorwort
Das Leben ist einzigartig und kostbar und sollte daher auch genossen werden. Der Alkohol unterbindet mit seiner Machtentfaltung jegliches Aufblühen und erstellt ein eigenes Regelwerk. Der Mensch wird zum Werkzeug der uneingeschränkten Vormachtstellung und verfällt in die Willenlosigkeit. Es gibt keine glücklichen Alkoholkranken. Das tägliche, der Not gehorchende Verlangen nach dem Stoff bietet keine Alternative zur Lösung des Problems. Man verliert den Boden unter den Füßen und hält sich überwiegend in der Vergangenheit auf. Im Rausch werden sämtliche Unannehmlichkeiten auf ein totes Gleis geschoben, wo sie sich in aller Ruhe vermehren können. Die allgemeine Perspektivlosigkeit ist ein Hauptthema bei den einfältig geführten Stammtischgesprächen und lässt keine geistige Wertschöpfung zu. Der verpasste Anschluss an die Realität wird mit einem gleichgültigen Gesicht hingenommen. Die von einer hohen Mauer umgebene Scheinwelt bleibt als einziges Rückzugsgebiet. Das wenige Geld wird in Alkohol investiert und durch den Verlust der Übersicht stürzt man sich in immer mehr Schulden. Körperliche und psychische Schädigungen vervollständigen den Totalabsturz. Das hier zu Papier Gebrachte schildert den selbst vollzogenen Wandel der Gesinnung, welcher mir durch die zurückliegende Therapie ermöglicht wurde. Es soll Menschen mit ähnlicher Krankheit dazu ermutigen, in das Leben der Zuversichtlichkeit zurückzukehren.
Man sammelt Erfahrung aus den Fehlern der Unerfahrenheit.
Hanspeter Götze
In den Fängen der Sucht
Anfangs war es in jeder Beziehung die große Liebe, die Partnerschaft für das Leben. Man blühte immer wieder auf, fühlte sich geborgen, unternehmungslustig, wurde verwöhnt, gepflegt und gehegt. Es verlief stets nach dem gleichen Schema. In den Anfangsjahren ging man noch sehr behutsam mit der Partnerin um, vermied Streitigkeiten und genoss das Zusammenleben. Durch meine selbstständige Tätigkeit im Außendienst umging ich die kritischen Situationen, welche in einer festen Beziehung mitunter auftraten. Spürbar waren die Unternehmungslust, der Rückhalt durch die Eltern und die entgegengebrachte Aufmerksamkeit von den Bekannten. Im trauten Heim mimte ich den fürsorglichen und zurückhaltenden Trinker, der sich bei der Berufsausübung zu einem Hallodri in allen Gassen verwandelte. Diese zwiespältige Lebensführung wurde von mir gnadenlos ausgenutzt, obwohl mich die Gedanken an die zu Hause wartende Freundin verfolgten.
Nach Messeschluss saß man in geselliger Runde im Gästehaus, genoss das Abendessen und begann danach mit dem gemütlichen Teil des Abends, dem Saufen. War das gewisse Quantum erreicht, so meldete sich automatisch das Schuldgefühl, von dem man sich durch den obligatorischen Anruf in die Heimat loslöste. Mit reinem Gewissen und den Worten „Ich liebe dich“ wurde das kurzzeitig unterbrochene Besäufnis weitergeführt. Zu meiner Ehrenrettung muss ich noch anführen, dass es auch Tage gab, an denen eine Trinkpause angesagt war; doch diese waren recht selten. Insgeheim freute man sich schon sehnsüchtig auf die Heimreise, um wieder Händchen zu halten.
Am Vortag der Rückreise, die in der Regel einen halben Tag dauerte, wurde die Menge der alkoholischen Getränke etwas eingeschränkt. Die Vorfreude auf das gemeinsame Essen, die Spaziergänge und andere Unternehmungen erleichterte mir die endlos erscheinenden Fahrten. Der Zeitabstand zwischen den einzelnen Ausstellungen betrug in etwa vierzehn Tage, sodass genügend Zeit blieb, um sich zumindest einmal zu streiten.
Am Anfang der letzten Beziehung verspürte ich keinen Drang, allein in eine Kneipe zu gehen. Alles, was wir unternahmen, geschah im gegenseitigen Einvernehmen. So besuchten wir Kabaretts, gingen zu Popkonzerten oder verbrachten den Abend in einem schönen Restaurant. Alles lief harmonisch, bis zu dem Punkt, an dem Körper und Geist dieses makellose und von Bekannten abgeschirmt geführte Leben zu einseitig fanden und man nach Alternativen Ausschau hielt. Es musste einfach wieder eine Abwechslung her, um nicht in eine totale Abhängig zu geraten.
Normalerweise wäre es für mich ein Klacks gewesen, in einer Millionenstadt wie Berlin mit seinen vielen Kneipen ein geeignetes Lokal zu finden, doch die Wohngegend der Freundin entsprach nicht dem normalen Standard. Im Umkreis von 300 Metern gab es deren nur drei mit unterschiedlichen Öffnungszeiten. Meine Freundin war sehr migräneanfällig und so erledigte ich die Besorgungen auf dem Wochenmarkt oder beim Discounter. Dies gab mir gleichzeitig die Gelegenheit, auf die Schnelle zwei Weizenbiere herunterzuschütten.
Am Anfang klappte diese Vorgehensweise prächtig, bis ich es einmal um einige Stunden überzog und sie sich auf die Suche nach meiner Person begab. Ihr unverhofftes Erscheinen löste bei mir eine akute Allergie gegen Weizenbier aus und brachte mich gleichzeitig in Erklärungsnot. Mit einem gezwungenen Lächeln, hinter dem sich die ganze Wut und Enttäuschung aufbaute, nahm sie auf meine Rechnung noch zwei Drinks zu sich und gab klar zu erkennen, dass ihr Besuch nicht rein zufällig war. Um den Streit unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen, gingen wir nach dem Bezahlen auf einen nahe gelegenen Spielplatz, welcher sich als idealer Ort für eine verbale Auseinandersetzung anbot. Vielleicht hatte ich damals einfach nicht die Traute, ihr einzugestehen, dass mich dieses eingekastelte Leben in meiner Persönlichkeit einengte. Doch anstatt einen Kompromiss zu schließen, wobei man jedem mehr Freiräume hätte zugestehen können, verfiel man wieder in den alten Fehler. Nach dieser Aussprache und dem Versöhnungsritual bekam ich die anschließenden Wochen auf Bewährung. Als Rückzugsmöglichkeit verblieb mir noch eine eigene Wohnung, welche sich im Stadtteil Moabit befand.
Da ich als Selbstständiger einen Ausweis für die Metro besaß, in der man Tabak und Getränke preiswert erwerben konnte, nahmen wir diese Möglichkeit immer öfters in Anspruch. So ergab es sich, dass wir einmal die Woche zu dem besagten Großmarkt fuhren, um den Wochenbedarf zu decken. Da meine Partnerin ebenfalls Bier bevorzugte, wurde ein Kasten gesplittet. Dies sollte meinen Bedarf an Alkohol einschränken und eine harmonische Partnerschaft garantieren.
Doch ein Suchtkranker lässt sich nicht gern kontrollieren, geschweige denn von seiner Lebenserfüllung abbringen. Jeder Alkoholiker besitzt ein großes Potential an Finessen, welche er auf der Suche nach dem Stoff eigennützig anwendet. So war es auch in meinem Fall, als ich schon beim damaligen Kauf im Supermarkt auf eine Nachfülloption achtete und eine bestimmte Biersorte auswählte, die man problemlos von einem normalen Lebensmittelgeschäft beziehen konnte. Die damalige Wohnung befand sich im vierten Stock eines Häuserkomplexes und erforderte bei jedem Kommen und Gehen einer Planvorgabe. Bereitwillig übernahm ich den täglichen Gang in den Keller, um den alkoholischen Nachschub für den gemeinsamen Fernsehabend zu besorgen. Dadurch war es auch ein Leichtes, das Leergut gegen volle Flaschen, welche sich im geparkten Auto an der Straße befanden, auszutauschen, ohne dass ein Verdacht entstand. Problemlos konnte ich somit die wöchentliche Trinkmenge verdreifachen und war ständig in ihrer Nähe. Diese Übergangslösung zur Befriedigung der Trinkbedürfnisse stufte ich damals noch als kleine Mogelei ein, obwohl die Abhängigkeit schon deutliche Konturen angenommen hatte.
Später kaufte ich im gegenseitigen Einvernehmen für mich einen ganzen Kasten Weizen im besagten Großmarkt, während meine Freundin sich immer noch mit der Hälfte begnügte. Dies bescherte mir gleichzeitig einen größeren Spielraum bei der Abfüllung des Körpers. Durch die Tätigkeit im Außendienst, der ich in einem vierzehntägigen Turnus nachging, konnte ich mit dieser Variante die Zeit zu zweit mühelos überbrücken, ohne den Gedanken an eine Kneipe zu hegen. Gleichzeitig verstieß ich nach der damaligen Auffassung nicht gegen die Bewährungsauflagen.
Es kam der Tag, an dem meine Lebensgefährtin arbeitslos wurde und sich die Probleme häuften. Sie igelte sich ein und verbrachte die Hälfte des Tages im Bett; teils aus Unzufriedenheit oder mit Vorgaukeln einer Krankheit. Ich hingegen nahm noch einen Nebenjob als Pizzafahrer an, welcher nicht nur für mehr Geld in der Haushaltskasse sorgte, sondern mich für einige Zeit auch vom übermäßigen Trinken abhielt. Da gab es gerade einmal ein Feierabendbier, um am nächsten Morgen wieder einsatzbereit zu sein. Der angestaute Druck wurde dann auf den Ausstellungen abgelassen, bei denen ich mich wieder in meinem Element fühlte. Zwar trat schon nach wenigen Tagen der Trennung das Gefühl der Verbundenheit auf und man führte endlose Telefongespräche, doch ein Bruch in der Partnerschaft war absehbar.
Bei den verbleibenden Stunden der Gemeinsamkeit nahm ich zunehmend den Part des Alleinunterhalters ein, während sie sich ihrem vermeidbaren Schicksal fügte. Es war schon damals nicht einfach, bettlägerig eine Arbeit zu bekommen. Sie bekam den Hintern nicht hoch und ich sollte als Ausgleich dafür malochen. Ich fühlte mich in diesem Zeitraum schlicht ausgenutzt und begann wieder mit dem Frusttrinken.
Nach einem ausgiebigen Kneipenbesuch kam es dann zum Eklat. Es gab eine hitzige Debatte über den Sinn einer Freundschaft, in der der eine Partner säuft und der andere schläft. Letztendlich verwies sie mich galant aus der Wohnung und ich hatte nichts Besseres zu tun, als mich in diesem Zustand ins Auto zu begeben und über die Stadtautobahn in die eigene Wohnung zu fahren. Dort angekommen, ging es geradewegs in die Stammkneipe, um den Ärger und Frust herunterzuspülen.
Am Nächsten Tag hörte ich im Wachkoma jemanden meinen Namen rufen, doch ich war unfähig zu antworten. Nachdem ich meinen Rausch ausgeschlafen hatte, fand ich im Flur meine Koffer, in denen sich Kleidungsstücke und persönliche Sachen von mir befanden. Als Zeichen der endgültigen Trennung legte man noch die Wohnungsschlüssel dazu. Danach blieben wir nur noch in telefonischem Kontakt.
All dies zog mich dermaßen herunter und die Mauer, welche einst für Rückhalt, Zuversicht und Willenskraft stand, fing immer mehr an zu bröckeln. Dazu gesellte sich noch die Aussichtslosigkeit im Messegeschäft. Dauerwerbesendungen im TV führten zu einem unerwarteten Verkaufsrückgang. Nach vier Pleiten hintereinander musste auch ich die Segel streichen und begann die angehäuften Schulden gegenüber den Geschäftspartnern abzubauen. Der Verkauf des Autos und des Messestandes dienten zur vorübergehenden Tilgung der sich aufgetanen Verbindlichkeiten. Für den eigenen Lebensunterhalt blieb mir nur noch der Gang zum Sozialamt.
In dieser Zeit befand ich mich in den Katakomben der totalen Alkoholabhängigkeit. Obwohl ich noch die Wohnung besaß, verbrachte ich die meiste Zeit bei Gleichgesinnten oder wartete auf der Parkbank auf nette Bekannte, die das Wichtigste, den Suff, besorgten. Das Essen wurde in einer Wärmestube eingenommen und um ein paar Mark für die Sucht zu ergattern, ging ich zum Blutspenden. Die einstigen Freunde wandten sich dankend von mir ab und vergessen waren die gemeinsamen Jahre des Zusammenhalts. Rückblickend war dieser Lebensabschnitt wichtig, da ich am eigenen Leib erfuhr, was die Droge Alkohol mit einem Menschen alles veranstalten kann.
Der einzige Lichtblick in diesem unendlich langen Tunnel war meine Mutter, welche mich mit eindringlichen Worten zu einer Rückkehr in meine Geburtsstadt bewegte. In meiner aussichtlosen Lage nahm ich dieses Angebot dankend an und fuhr mit dem Zug in das Allgäu. Auf dieser achtstündigen Fahrt trank ich gerade einmal zwei Bier und wurde schon sehnsüchtig am Bahnhof erwartet. Das Kapitel Berlin war für mich vorerst beendet.
In den nächsten Tagen besuchte ich den früheren Hausarzt und gemeinsam fanden wir eine Lösung für das bestehende Trinkproblem und die daraus resultierende Niedergeschlagenheit. Ich entschloss mich für eine Therapie in der Nähe von Oberstaufen (Wolfsried). Gleich am nächsten Tag fuhr ich zusammen mit meiner Mutter in die besagte Einrichtung, welche mir auf Anhieb zusagte. Nach einem Gespräch mit der Klinikleitung unterschrieb ich bereitwillig den Aufnahmevertrag. Da ich zu diesem Zeitpunkt noch privat krankenversichert war, wurde man im Gegensatz zu anderen Kassenpatienten bevorzugt und so dauerte es keine Woche, bis ich stationär aufgenommen wurde.
Die Anpassung an den dort vorherrschenden spartanischen Lebensstil war das ganze Gegenteil zu den letzten Tagen in Berlin. In den acht Wochen des stationären Aufenthaltes lernte ich die andere Seite des Lebens kennen. Hier herrschte noch Zucht und Ordnung. Dazu gehörten das absolute Rauchverbot, keine Zeitung, kein Radio oder Fernseher, geschweige denn sexueller Kontakt zu weiblichen Patienten, um nur einige der Tabus aufzuzählen. Um sechs Uhr aufstehen, händchenhaltend als Pärchen zwei Kilometer spazieren gehen, Gruppenmeeting mit allen Insassen und Meldung machen von beobachteten Verstößen anderer Suchtkranker. Wurde jemand bei einem Vergehen erwischt, musste er sich vor versammelter Mannschaft rechtfertigen und erhielt bei Schuldanerkenntnis einen Strafpunkt. Die körperliche Folter hatte man schon vor meinem Eintritt abgeschafft. Da ich keine Alternativen kannte, wurden diese Maßregelungen akzeptiert. So konnten die Patienten in Ruhe über ihre traurige Vergangenheit nachdenken und ich konzentrierte mich mehr auf die eigene Person. Ich entdeckte wieder verborgene Interessen wie das Spazierengehen, Gedichteschreiben oder Mineralwassertrinken und hatte keinerlei Verlangen nach einem Bier.
Leider war die Klinik nicht speziell für Alkoholabhängige ausgerichtet, sondern beherbergte Patienten der verschiedensten Suchtkrankheiten mit den Schwerpunktthemen Essstörungen, Medikamentenabhängigkeit, Beziehungssucht, Co-Abhängigkeit, sexuelle Traumatisierung oder Borderlinesyndrom, um nur einige davon zu nennen. Eine Mitpatientin und meine Wenigkeit bildeten das Zweierteam der Alkoholkranken. In den von einer Psychologin geleiteten Gruppenstunden wurde verallgemeinert über die Sucht gesprochen, sodass wir beide uns letztendlich gegenseitig therapierten. Nach Ablauf der vereinbarten Zeit wollte ich verlängern, doch die Therapeutin gab mir zu verstehen, dass bei der derzeitigen Stabilität eine Arbeitssuche sinnvoller sei.
Nach der Entlassung hielt ich mich eine längere Zeit an die Vorgaben und Erfahrungen aus Wolfsried, mied Kneipen und begab mich auf Arbeitssuche. Da ich mir für die Rückfälle keine Zeitfenster setzte, waren die folgenden zehn Jahre recht abwechslungsreich. Die Phasen, in denen die Vernunft Oberhand über den Saufdruck behielt, waren zwar dünn gesät, doch immerhin vorhanden. Teils lag es an der beruflichen Tätigkeit, bei der es sich nicht gebührte, nächtelang durchzuzechen, oder aber es sorgten die zahlreichen unfreiwilligen Krankenhausaufenthalte für schöpferische Pausen.
Unmittelbar nach der Rückkehr in meine Heimatstadt spürte ich einen inneren Weckruf, welcher mich zu einer neuen Lebensführung beflügelte. Ich suchte mir eine passende Wohnung, fuhr Fahrrad oder erkundete zu Fuß die Umgebung. Das Sozialamt vermittelte mir einen geringfügig bezahlten Job beim hiesigen Stadtarchiv und ich versuchte meinerseits, den Kontakt zum Alkohol zu meiden. Bei einem Spaziergang durch die Fußgängerzone entdeckte ich im Schaufenster eines Mobiltelefonanbieters ein Stellenangebot als Verkäufer für dessen Filialen in Augsburg und Füssen. Sogleich betrat ich den Handyladen und konnte ein klärendes Gespräch mit dem Besitzer führen, welcher mich aufgrund der Messeerfahrung und des erlernten Berufes einstellte. Die Verkaufslage befand sich in der Hauptgeschäftsstraße mitten im Zentrum der Stadt Augsburg. Alles klang sehr verheißungsvoll, zumal mir auch die Fahrtkosten erstattet wurden und ich erstmals wieder Anspruch auf ein normales Leben anmelden konnte.
Derartig motiviert und ausgeglichen begann ich die Arbeit und fand mit dem Filialleiter einen sehr netten, kumpelhaften und alteingesessenen Vorgesetzten, welcher mir in der Anfangszeit in allen Belangen mit Rat und Tat zur Seite stand. Die einstündigen Zugfahrten überbrückte ich mit Lesen und alles schien in geordneten Bahnen zu laufen. Natürlich sprach man auch über gesellige Trinkgelage und die Ausgelassenheit in der Jugendzeit. Schon während meiner schulischen Ausbildung hatte ich an freien Wochenenden oder in den Ferien einem Architekten in Königsbrunn bei Augsburg bei anfallenden Büroarbeiten geholfen und durch dessen Sohn, der in der Innenstadt wohnte, auch das Nachtleben zur Genüge kennengelernt. Daher war im Laufe des Arbeitstages immer für Gesprächsstoff gesorgt. Mein Aufgabenbereich erstreckte sich von der Reparaturannahme und dem Kassendienst bis hin zur Mittagsvertretung in den anderen Filialen. Bei der nahen Bäckerei versorgten wir uns mit Kaffee und Brotzeit und mein Verlangen nach Alkohol war ausgebremst.
Damals versäumte ich es, ihn über meine zurückliegende Therapie zu unterrichten, was sich später rächen sollte. Es kam nämlich der Tag, an dem ein alter Jugendfreund von meinem Vorgesetzten den Laden betrat und sie aus dem Nähkästchen plauderten. Die anstehende Mittagspause gab Anlass zu einem geselligen Abstecher in sein Lieblingsbistro, welches sich zwei Straßen weiter befand. Der erste Gang führte mich auf die Toilette, während die anderen beiden Herren schon einmal freie Plätze anvisierten. Bei meiner Rückkehr befanden sich derweil schon drei Weizenbiere auf dem Tisch und ich fehlte noch zum Zuprosten. Es klingelten bei mir zwar sofort die Alarmglocken, doch wollte ich mir auch nicht die Blöße geben und trank nach Monaten erstmals wieder Alkohol. Gedanklich sah ich bei diesem kleinen Ausrutscher keine Gefahr für das weitere Abstinenzverhalten und folglich hatte ich auch bei den nächsten Bestellungen kein schlechtes Gewissen. Die vorherige Zurückhaltung in Sachen Trinken meinerseits hatte auch den Chef von seiner Lieblingsbeschäftigung abgehalten. Jetzt, da er wusste, dass ich auch zum Kreis der Auserwählten gehörte, tauschten wir die eine oder andere Kaffeerunde mit einem frisch eingeschenkten Weizenbier.
Zu allem Übel meldete der Firmeninhaber nach drei Monaten Konkurs an und ich saß wieder auf der Straße. Anstatt zu resignieren, verfolgte ich intensiv den Arbeitsmarkt und wurde schon einige Zeit später fündig. Ein Callcenter, nur 200 Meter von meiner Wohnung entfernt, suchte einen Mitarbeiter für den Verkauf von Weinen. Auch hier verlief die Einstellung problemlos und ich sah in der neuen Tätigkeit eine Herausforderung für das vorhandene kaufmännische Talent. Das reichhaltige Sortiment umfasste Produkte aus verschiedenen Ländern, welche ausschließlich über das Telefon angeboten wurden. Die zweistündige Mittagspause verbrachte ich anfangs in meiner Wohnung und auch der Alkoholverbrauch hielt sich in Grenzen. Gleich zu Beginn der Beschäftigung setzte ich bei den Verkaufsgesprächen erste Akzente, welche den Niederlassungsleiter beeindruckten. Das nötige Wissen über die verschiedenen Rebensäfte eignete ich mir als Nicht-Weintrinker von den Topverkäufern an. Alles verlief wunschgemäß und ich fand schnell Anschluss zu der bestehenden Verkaufsgruppe.
Nach der dreimonatigen Probezeit war jedoch Schluss mit lustig. Schlagartig wurde das persönliche Plansoll angehoben und der auf einem lastende Druck wurde von Mal zu Mal stärker. Um die Mitarbeiter bei der Stange zu halten, fanden wöchentliche Verköstigungen der neu ins Programm aufgenommenen Spirituosen statt, die von der Mehrheit dankend angenommen wurden. So langsam kristallisierte sich heraus, dass ich in eine Firma geraten war, in der ein Teil der Belegschaft aus sogenannten verkrachten Existenzen bestand, welche in diesem Job eine letzte Chance sahen, sich in der Arbeitswelt zu beweisen. Ich passte mich diesen Gepflogenheiten uneingeschränkt an und fand auch unter den Mitarbeitern Freunde, mit denen ich nach Feierabend einige Biere trank. Die guten Vorsätze schwanden von Tag zu Tag, die Wohnung verkam zu einer einzigen Schlafstätte und das Wochenende diente zur Einhaltung des benötigten Alkoholbedarfs.
Dem Verkaufsleiter gab man von oberster Stelle zur Vorgabe, möglichst Mitarbeiter anzuwerben, welche gezwungenermaßen auf diese unterbezahlte Arbeit angewiesen waren. Um in solch einer Gruppe bestehen zu können, bedurfte es eines Ablegens der erlernten gesellschaftlichen Umgangsformen und der Bereitschaft zum Trinken. So diente die Mittagspause zum geselligen Fitmachen mit zwei, drei Bieren für den anstehenden Nachmittag. Da der Chef auch kein Kostverächter war, zählte im Endeffekt nur der Umsatz von jedem Einzelnen, egal, in welchem Zustand dieser erreicht wurde. Der telefonische Verkauf ermöglichte es, auch mit einem schweren Kater oder zusammengefallenen Gesicht zu arbeiten. Wurde bei den veranstalteten Verkaufswochen das Soll erfüllt, erhielt man die ausgesetzte Prämie in Form von Wein oder Likör, welches den lästigen Gang zum Getränkemarkt überflüssig machte.
Wurde jedoch das Ziel verfehlt, geriet man unter starken Druck, welchem einige der Mitarbeiter nicht standhielten. Daher kam es zu einem ständigen Wechsel der Arbeitnehmer innerhalb unseres beschaulichen Büros. Die Annoncen in der hiesigen Tageszeitung erhöhten sich zunehmend und der Niederlassungsleiter verbrachte den größten Teil des Tages mit Ein- und Ausstellungsgesprächen. Als männlicher Mitarbeiter musste man gegenüber dem Verkaufsleiter und dem nächsthöheren Gebietsleiter seine Trinkfestigkeit unter Beweis stellen, um zum Kreis der Auserwählten zu gehören. Demgegenüber besaßen die Verkäuferinnen eine weitere Option, um sich hochzuarbeiten.
Dreimal im Jahr fuhren die Topverkäufer für eine Woche zu den Verkaufsmeetings in entlegene Städte, wo man innerhalb einer Hotelanlage zusammen mit den anderen fünf bundesweiten Verkaufsbüros eine Art Wettbewerb veranstaltete. Das Telefonieren fand auf engstem Raum in einem gesondert angemieteten Saal statt und begann mit einem Prosecco-Frühstück. Im Laufe des Tages wurden kurze Trink- und Rauchpausen eingehalten und man legte großen Wert auf ein gemeinsames Mittagessen mit anschließender eineinhalbstündiger Mittagspause. Die Übernachtungen und Mahlzeiten sowie zwei Getränke nach Wahl übernahm die Firma, welche auch bei der Freizeitgestaltung die Angestellten finanziell unterstützte. Obwohl die ganze Woche mit Stress verbunden war, feierte man nach getaner Arbeit noch überschwänglich in der Hotelbar, bis das Personal das Licht ausknipste. Es waren schlicht und einfach unbeobachtete Saufwochen, bei denen man sich als Trinker pudelwohl fühlte.
Bei den abendlichen Gesprächen erfuhr ich von einigen Mitarbeitern die Gründe für deren Eintritt in diese Firma. Man war hoch verschuldet, bekam von der Bank keinen Dispokredit und benötigte den Job, um nicht noch tiefer zu sinken. Hinzu kamen familiäre Gründe und das Alter, da man mit 45 aufwärts auf dem Arbeitsmarkt schon abgeschrieben war. Gut ein Drittel der Belegschaft litt unter psychischen und körperlichen Schäden, bei denen ich mich mit einklinkte. Das Ganze bildete das ideale Fundament für einen Verkauf, bei dem die Wahrheitsliebe eine Nebenrolle spielte. Im Endeffekt zählte nur der Verkaufserlös, der die meisten zu verblüffenden und unseriösen Aussagen gegenüber den Kunden veranlasste.
Eine Abwechslung zum normalen Alltag stellte das vom Niederlassungsleiter organisierte Mittagsgrillen dar. In den Sommermonaten wurde einmal wöchentlich die Biergartengarnitur samt Bratrost auf der firmeneigenen Terrasse aufgestellt. Nach dem Entrichten einer kleinen Spende konnte nach Herzenslust gegessen und getrunken werden. Da bei der Verköstigung kein Limit gesetzt war, rutschte so mancher Mitarbeiter aufgrund der alkoholischen Beigabe für kurze Zeit unter den Tisch und musste mit vereinten Kräften auf die anfängliche Position zurückgesetzt werden. Stellten sich dann beim Aufsuchen des Arbeitsplatzes noch Orientierungsschwierigkeiten ein, bekam man den Nachmittag frei. Nicht selten dezimierte sich nach solch einem Ereignis die Anzahl der Verkäufer um die Hälfte. Dies alles geschah, um die Belegschaft bei Laune zu halten, welche wiederum diese Maßnahme, bis auf wenige Ausnahmen, dankend annahm.
Bei mir war die Sucht wieder aufgekeimt und ich trank den Wein wie Wasser. Als Geschmacksverstärker mischte ich zusätzlich mittags und abends das geliebte Weizenbier dazu. Da ich mich auf einen Provisionsvertrag einließ, der eine unerreichbare Sollvorgabe beinhaltete, halbierte sich in den anschließenden Monaten mein Gehalt und die finanziellen Verpflichtungen nahmen dementsprechend zu. In dieser aussichtslosen Lage verlor ich das Interesse am Verkauf und widmete mich lieber meinem Hobby, dem Trinken.
Nach einigen Diskrepanzen mit dem Verkaufsleiter folgte die Kündigung im gegenseitigen Einvernehmen. Der restliche Lohn wurde mit dem Sollkonto verrechnet. Dies blieb allen anderen, welche vor mir die Kündigung einreichten, erspart. Manche wiesen dabei ein weitaus höheres Minus auf und wurden in keinster Weise belangt. Ich zog vor das Arbeitsgericht und klagte erfolgreich gegen die einstige Firma, die daraufhin den zustehenden Ausgleich überwies.
Von der Agentur für Arbeit, zu deren Kunden ich mich ab sofort zählen durfte, erhielt ich einen sogenannten Bildungsgutschein ausgehändigt, welcher zur Teilnahme bei einer Übungsfirma des Kolpingbildungswerkes berechtigte. Hier konnte ich ohne große Mengen an Alkohol wieder eine Bestimmung im Leben finden. Man knüpfte Freundschaften mit ehemaligen Abhängigen und blieb während der Woche zunehmend trocken.
Eines Tages traf ich nach Feierabend eine ehemalige Bekannte aus der früheren Firma, welche mich spontan auf ein Bier einlud, während sie sich einen Kaffee genehmigte. Schon während unserer gemeinsamen Zeit beim Weinverkauf hatte sie zu den wenigen gehört, welche Mineralwasser tranken. Bei dem folgenden Gespräch erzählte sie mir von der ebenfalls erhaltenen Kündigung und dem daraufhin gefassten Entschluss, die arbeitsfreie Zeit für eine Neuordnung ihres Lebens zu nutzen. Am Ende dieser vertraulich geführten Unterhaltung gab sie mir noch einen aufmunternden Kuss auf die Wange und verabschiedete sich mit den Worten: „Wir hören voneinander.“
Dass dies das letzte gemeinsame Treffen war, erfuhr ich eine Woche später, als ich die Todesanzeige der ehemaligen Kollegin in der Zeitung las. Sie hatte sich in ihrer Garage mit Autoabgasen das Leben genommen. Durch eine gute Bekannte erfuhr ich im Nachhinein Einzelheiten über das verpfuschte Leben jener Person, von denen ich aufgrund des jahrelangen Berlinaufenthalts nichts wusste. Sie war vor meiner Rückkehr überall als „Schnapsdrossel“ und „Asbach Lady“ verschrien und behauptete sich öfters als Kampftrinkerin. Nach einer gescheiterten Ehe suchte sie anscheinend einen festen Halt und tatkräftige Unterstützung bei der Ausübung ihrer Sucht. Dies alles fand sie in einem selbsternannten Gastwirt. Man pflegte intensiv das gemeinsame Hobby und zog nach Ladenschluss noch um die Häuser, wo sie nach Aussagen von anderen Schwierigkeiten mit dem Sitzen hatte. Vielleicht war ich damals zu leichtgläubig gewesen, um nicht zu erkennen, dass die Kollegin eine trockene Alkoholikerin war. Sie sah attraktiv aus und hatte mit ihren 1,78 Meter eine stattliche, schlanke Figur. Ihr Verkaufsstil war zwar von Hektik geprägt, doch dies führte ich auf die Unerfahrenheit zurück. Auch von der ständigen Medikamenteneinnahme gegen Depressionen erfuhr ich erst nach ihrem Tod. Dieser spezielle Fall ging mir sehr nahe, zumal ich selbst von der Sucht besessen war und man sich gegenseitig hätte helfen können.
Eine Zeit lang versuchte ich, das Trinken ein wenig einzuschränken, doch gab es immer wieder Anlässe, um dem Untergang näher zu kommen. Das Pflichtbewusstsein erwachte in mir, als ich einen Ein-Euro-Job als Fahrer für „Essen auf Rädern“ zugewiesen bekam. Diese Tätigkeit erforderte ein Umdenken in der Trinkstrategie. So verlegte ich die Kneipengänge auf das Wochenende.
Nach einem halben Jahr im Dienst des örtlichen Altersheims wechselte ich zu einem Transportunternehmen, bei dem ich Kurierdienstfahrten übernahm. Es war zwar eine verantwortungsvolle Arbeit, doch stand ich als Hartz-IV-Empfänger weiterhin im Abhängigkeitsverhältnis mit dem Jobcenter. Bei der Auswahl der Freunde und Bekannten spielte weiterhin der Alkohol eine gewichtige Rolle. Man ignorierte das soziale Umfeld und begab sich zurück in alte Berliner Zeiten. Das erlernte Umdenken aus der ersten Therapie wurde als lästig abgestreift und das Trinken gehörte fortan zur Lebensgrundlage. Ich passte mich uneingeschränkt dem niedrigen Niveau der Sinnesgenossen an.
Eines Tages traf ich auf einen ehemaligen Arbeitskollegen aus der suspekten Weinfirma, der mich spontan auf einen Umtrunk einlud. Im Gespräch berichtete er von der Neueröffnung der einstigen Weinfirma in einer anderen Stadt und unter neuem Geschäftsnamen. Der einstige Niederlassungsleiter wurde in die Wüste geschickt und durch einen tollen Nachfolger ersetzt. Zudem bestand eine Fahrgemeinschaft zu dem fünfzehn Kilometer entfernten Verkaufsbüro. Wohl wissend, dass bei dieser Tätigkeit alte Trinkeigenschaften wieder aufflammen würden, begab ich mich zu einem Vorstellungsgespräch und wurde umgehend eingestellt. Alles sollte anders werden und der Chef hinterließ anfangs einen kumpelhaften Eindruck. Ich erzählte ihm von den früheren Intrigen innerhalb der Belegschaft und er versicherte mir daraufhin, dass dies unter seiner Leitung nie vorkommen würde. Dank meiner Leichtgläubigkeit ließ ich mich auf diesen Deal ein und war wieder gefangen im Reich von Lug und Trug.