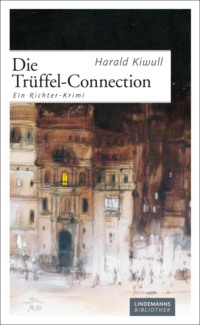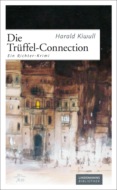Kitabı oku: «Die Trüffel-Connection»

Harald Kiwull
Die Trüffel-
Connection
Ein Richter-Krimi
Mit Illustrationen von
Wolfgang Blanke

für Zottel
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen
wären rein zufällig und sind nicht beabsichtigt.
Dr. Harald Kiwull, geboren 1943 in Litzmannstadt, heute Lodz. Aufgewachsen in einem Dorf in Norddeutschland. Studium der Rechtswissenschaft in Hamburg und Freiburg im Breisgau. War nach Tätigkeit als Zivilrichter lange Jahre Vorsitzender Richter einer Strafkammer am Landgericht Karlsruhe, deutschlandweit bekannt geworden als Berufungsrichter im sogenannten „Autobahnraser-Prozess“. Über 20 Jahre stellte er in dem von ihm mitbegründeten Verein „Kunst im Landgericht“ in 40 Ausstellungen mehr als 100 Künstler aus. Seit seiner Pensionierung lebt Kiwull in Deutschland und Spanien. Die Trüffel-Connection ist sein erstes Buch.
Lindemanns Bibliothek, Band 265
herausgegeben von Thomas Lindemann
© 2016 · Info Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck ohne Genehmigung
des Verlages nicht gestattet.
ISBN 978-3-88190-919-8
www.infoverlag.de
I.
Mir lief das Wasser den Rücken hinunter, das Hemd klebte, es war wirklich zu viel des Guten. Bis vor zehn Minuten war im kühlen Sitzungssaal diese fürchterliche Hitze fast vergessen, die uns seit Tagen quälte. Jetzt hatte sie mich wieder voll im Griff. Dabei war mir klar, dass mein nasses Hemd in der klimatisierten Fortsetzung der Verhandlung am Nachmittag auch kein Spaß sein würde.
Auch der Schatten im Biergarten der „Alten Bank“ war keine echte Erleichterung. Während des Wurstsalates dachte ich über das nach, was mir heute Morgen eigentlich kaum aufgefallen war, mich danach aber in immer stärkerem Maße beunruhigt hatte.
Die Verhandlung heute Vormittag, eine normale Fahrerfluchtgeschichte, massive Vorfahrtsverletzung mit Totalschaden des ausweichenden Fahrzeuges, war unauffällig verlaufen. Die Ehefrau bestätigte, wie erwartet und wie es sich schon aus den polizeilichen Ermittlungsakten angekündigt hatte, erneut das häusliche Alibi ihres Mannes. Natürlich waren die Aussagen des Paares, das das Kennzeichen mitgeteilt hatte, nicht unproblematisch, und der Verteidiger schaffte es schon, bei den Schöffen Zweifel an dem Erinnerungsvermögen der beiden zu wecken. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen.
Aber am Nachmittag würde die Ehefrau weinend zusammenbrechen, wenn die kurzfristig geladene Zeugin, die ihr unbekannte, frustrierte Geliebte ihres Mannes, bestätigen würde, dass er auf der Rückfahrt von einem zunächst gemütlichen, dann aber etwas hektischen Treffen gerade um diese Zeit am Dreieck Bernhardstraße vorbeigekommen sein müsste.
Das war es aber nicht, was mich beunruhigte.
Im Sitzungssaal waren heute acht oder zehn Zuhörer gewesen, darunter auch Paul Zuber, ein Rentner, der keine meiner Verhandlungen versäumte und den ich deswegen „meine Öffentlichkeit“ getauft hatte.
Gegen halb elf war dann ein Mann in den Sitzungssaal gekommen und hatte sich in die letzte Reihe gesetzt. Er war mir zuerst nicht aufgefallen, weil ich dabei war, mich über die Alibi-Erklärungen der Ehefrau aufzuregen. Aber irgendetwas irritierte mich an dieser Person. Ich konnte ihn halb hinter Paul nicht richtig sehen. Er war mir irgendwie unangenehm bekannt. Ich konnte ihn aber keiner bestimmten Erinnerung zuordnen.
Nun habe ich leider ein granatenmäßig schlechtes Personengedächtnis. Einmal traf ich in einer Kneipe einen Rechtsanwalt, den ich eine Weile nicht gesehen hatte. Zur Begrüßung schlug ich ihm auf die Schulter und trank dann ein Bier mit ihm. Erst nach einer halben Stunde merkte ich, dass es gar nicht der Rechtsanwalt war sondern ein Angeklagter, den ich vor einem halben Jahr verurteilt hatte. Ziemlich peinlich. Er war aber sehr friedlich und hatte mich offenbar nicht in schlechter Erinnerung.
Ich versuchte, mich auf meinen Wurstsalat zu konzentrieren. Von Sankt Stephan her erschallte Gelächter. Drei langblondige Mädchen klackerten auf ihren hochhackigen Schuhen, offensichtlich unbeeindruckt von der Hitze, die Gasse herab.
„ ... du, das war wirklich total krass. Also wirklich.“
„Also nein, das kannst du mir wirklich nicht erzählen. Das glaube ich einfach nicht.“
„Doch, total krass ...“
Leider erfuhr ich nicht mehr, was so total krass war, weil die drei ihre niedlichen Hintern schwenkend in die Erbprinzenstraße einbogen und lachend und klackernd entschwanden.
Ich schüttelte die Erinnerung an den morgendlichen Besucher ab und machte mich auf den Rückweg zum Gericht. Auf dem Gang zu meinem Gerichtssaal schloss ich kurz den Schwurgerichtssaal auf, den bestklimatisierten Raum des Landgerichtes, und schaute hinein. Wie ich es erwartet hatte, lag dort der Schwurgerichtsvorsitzende Johann in der vordersten Sitzbank, die Gesetzessammlung „Schönfelder“ unter dem Kopf und den „Spiegel“ lesend.
„Überarbeite dich nicht“, sagte ich und schloss die Tür wieder, konnte aber noch hören, wie er mir zurief: „ ... die Nachmittagssitzung ist ausgefallen“, und irgendwas wie: „saumäßige Rückenschmerzen“. Den therapeutischen Wert einer derartigen Rückenkur hatte er mir übrigens auch schon empfohlen.
Der Nachmittag verlief so, wie ich es mir gedacht hatte. Zum Schluss saß der Verurteilte zusammengesunken in der Bank. Die Geliebte rauschte mit höhnischen Blicken davon, dicht gefolgt von der weinenden Ehefrau, die es aber auch noch schaffte, ihrem Ehemann einen verächtlichen Blick zuzuwerfen.
Der Schöffe Immerle, ein Konditor, packte im Beratungszimmer ein kleines Tütchen mit selbst gemachten Pralinen aus. „Also, ich hätte der Ehefrau alles geglaubt. Wirklich alles. Das ist doch übel. Man kann den Frauen nicht über den Weg trauen.“
„Die Annahme von Geschenken ist ein schweres Vergehen für einen Richter“, sagte ich und biss mit Genuss in die dritte Praline.
Auf dem Nachhauseweg fiel mir plötzlich wieder der Mann von heute Morgen ein. Dunkler Teint, schwarze Haare, ein spanischer Typ, sein linkes Augenlid hing etwas herunter. Wo hatte ich ihn bloß gesehen und bei welcher Gelegenheit? Eine angenehme Erinnerung, so viel stand fest, war es nicht.
Ich wohnte seit einem Monat in einem Dachgeschosszimmer eines kleinen Ettlinger Hotels mit winzigem Bad und Kochecke und Blick aus dem schrägen Dachfenster auf eine Bahnlinie. Die Zimmer des Dachgeschosses waren an Dauergäste vermietet. Eine etwas merkwürdige Auswahl von gestrandeten Personen mit häufigem Wechsel und eigenartigen Tagesabläufen und Nachtunruhen. Ich war vor einem Monat aus dem prächtigen Haus ausgezogen, das ich zusammen mit meiner Ehefrau fünfzehn Jahre lang bewohnt hatte. Nach vielen guten Jahren waren wir uns fremd geworden, hatten immer mehr den Respekt voreinander verloren, bis der Streit zwischen uns so dramatisch eskalierte, dass ich mich entschließen musste zu handeln, „sofort oder nie“, und ich hatte mich für sofort entschieden.
Und mit Überraschung stellte ich fest, wie wohl ich mich fühlen konnte in dieser eher elenden Umgebung. Mit den paar Sachen hatte ich auch meine Gitarre mitgenommen, und mit meinem abendlichen Geklimper kehrte bei mir eine Ruhe ein, wie ich sie lange nicht mehr empfunden hatte. Häufig, bevor ich mich abends hinlegte, schaute ich aus meinem schrägen Fenster auf die Bahnlinie und die endlosen Güterzüge, die unten vorbeifuhren; vielleicht nach Wladiwostok, stellte ich mir vor, griff dann auch mal zur Gitarre, um mein Leib- und Magenlied „Midnight Special“ anzusingen. Passte ja nicht schlecht: der Häftling im amerikanischen Gefängnis, der immer um Mitternacht sehnsuchtsvoll aus seiner Zelle auf die Lichter des vorbeifahrenden Zuges blickt. Von meinen Nachbarn kümmerte sich natürlich keiner darum. Sie waren mit ihren eigenen Leben beschäftigt, von denen ich manchmal auch eine Menge mitbekam.
Ich war am Folgetag mit Wolfhart verabredet, den ich zwei Tage lang bei der Überführung seines Stahlschiffes in das neue Quartier begleiten sollte. Er hatte es vor Kurzem gekauft und wollte es über Neckar, Rhein und Main zum neuen Liegeplatz bringen. Entspannt schlief ich ein, nur flüchtig noch daran denkend, dass irgendwas mich doch beunruhigt hatte.
Mein TomTom führte mich hinaus vom Autobahn-Baustellenchaos kurz vor einem Sechzehn-Kilometer-Stau durch kleine Orte, die Friedhofstraße von Epfenbach hinauf in die Ausläufer des Odenwaldes auf immer schmaleren, schließlich fahrzeugbreiten Sträßchen mit engen, im Schritttempo zu fahrenden Kurven. Eine gute Einstimmung auf die folgenden zwei Tage.
Dann hinunter nach Neckarhäuserhof, wo mir Wolfhart strahlend vom Fluss herauf entgegenkam.
Da lag sie, die „Alte Lady“, ein richtiges Schiff mit Ausstrahlung, nicht eine dieser gesichtslosen Plastikschüsseln. Wunderbar kräftig im Aufbau und harmonisch mit ihrem Anstrich in Blau und Beige, nicht das augenschmerzende Einheitsweiß und dazu viel Holz auf Deck und im Innenbereich.
Der seit den dreißiger Jahren bestehende, kleine Jachtclub nahm uns herzlich auf beim abendlichen Grillen. Meinem strafrichtergeschädigten Weltbild taten der lockere Umgang mit der Clubkasse, in die der Gastlieger einen Betrag nach eigenem Ermessen einwirft, und die über die ganze Nacht offenen Türen gut.
Vor dem Einschlafen noch ein ruhiges, entspanntes Gespräch auf dem Achterdeck über unser Leben, die Veränderungen, dass es gut ist aufzubrechen.
In der Nacht mit zwanzig Zentimetern Platz über meinen 1 Meter 96 fühlte ich mich wohl, und Erinnerungen an mein früheres Leben auf holländischen Kanälen und „Meeren“ kamen mit dem leichten Wiegen des Schiffes auf und keine Irritation durch Gedanken an ein hängendes Augenlid.
Am nächsten Morgen dann diese Ruhe, die sich tatsächlich auch nach innen ausbreitet. Die Schönheit der Landschaft und des Flusses, in einem weiten Bogen mit dem Blick auf vier Burgen gleichzeitig. Es gibt wirklich unterschiedliche Lebenswirklichkeiten – es war wohltuend, daran erinnert zu werden.
Am Abend warf ich mich wieder in das Getümmel der Autobahn.
Nachts schlief ich unruhig. Ich hatte wie schon oft diesen elenden und nervenden Abiturtraum. Alles war prima. Ich hatte die üble Schule mit einem leidlichen Abitur und mit drei Kreuzen verlassen. Die juristischen Examen hatte ich, zu meiner Überraschung, ganz gut, das letzte sogar richtig gut abgelegt. Auch die Promotion war absolviert.
Aber eines Tages wurde ich zum Präsidenten des Oberlandesgerichts gerufen, und der eröffnete mir, dass meine Mathe- und Biologieabiturarbeiten überprüft und als nicht ausreichend gewertet worden seien. Also wirklich, gerade Mathe und Bio, und ich müsste die Arbeiten erneut schreiben samt mündlichen Prüfungen. Sollte ich nicht bestehen, müsste man mir leider das Abitur und auch alle Examina aberkennen. Eigenartigerweise hatte der OLG-Präsident diesmal einen ganz dunklen Teint.
Ich schreckte hoch, in Schweiß gebadet, und brauchte eine geraume Weile um zu begreifen, dass alles ein Traum war und ich nicht wieder mit dem ganzen Stress von vorn anfangen musste. Ich beschloss, mich in den nächsten Tagen einmal mit meinem psychologisch interessierten Kollegen und Freund Jan zu unterhalten. Denn so viel wusste ich, Träume, die sich häufig wiederholen, müssen dringend interpretiert werden, weil sie Übles bedeuten können.
Am nächsten Morgen öffnete mir der Wachtmeister Mengerle die hintere Tür zum Karlsruher Landgericht. „Haben Sie schon gehört? Frau von Hühnlein ist heute Morgen im Sitzungssaal zusammengebrochen. Der Notarzt war da. Sie ist im Krankenhaus und fällt für mindestens vier Wochen aus. Ob sie wohl schwanger ist?“
Frau von Hühnlein, sie heißt wirklich so, ist meine Vertreterin, und ich vertrete sie. Wir lieben uns nicht. Das heißt, ich liebe sie nicht, weil sie unaufhörlich zu plaudern anfängt, wenn man sie trifft, und nicht zu stoppen ist. Und dabei eine unglaubliche Langeweile verbreitet. Wirklich grässlich. Dabei aber hat sie – ich weiß nicht recht, ob das ein Widerspruch ist – erstaunlicherweise eine sehr gute Figur und ist auch noch wirklich hübsch.
Sie hat die eigenwillige Angewohnheit, bei ihren Plaudereien ein Bein angewinkelt nach hinten an die Korridorwand zu stemmen. Was die meisten Kollegen dazu veranlasst, insbesondere dann, wenn sie wieder einmal einen ihrer unrichterlich kurzen Röcke anhat, unentwegt auf ihre Beine zu starren. Aber ihre Unterhaltung macht das leider nicht spannender.
Auf dem Weg in mein Büro dachte ich darüber nach, ob das nun eine gute Nachricht war, weil für eine Weile ich von ihrem Geplauder verschont bleiben würde, oder eine schlechte, weil ich ihre Akten würde bearbeiten müssen.
Als ich die Tür zu meinem Büro öffnete, versperrte mir ein hoher Aktenwagen den Weg zum Schreibtisch. Frau Kuch, Herrscherin über unsere gemeinsame Geschäftsstelle, hatte wirklich schnell gehandelt, um ihren Liebling Hühnlein zu entlasten, und mir die Akten der nächsten Wochen zugeschoben und, so wie es aussah, auch den gesamten Bodensatz des Hühnlein’schen Referates. Ich beschloss, mich nicht aufzuregen, und versuchte, das Gefährt seitlich so unterzubringen, dass ich nicht dauernd darauf würde blicken müssen.
Leider habe ich ein mittelgradiges Faulheitsgen, das mich natürlich beeinträchtigt und mir das freudige, entspannte Arbeiten erschwert. Oder genauer gesagt, ich habe ein Quartals-Faulheitsgen, das heißt, Faulheitsphasen wechseln sich – für mich selbst oft überraschend – mit Arbeits-Energiephasen ab. Ich versuche meine partielle Faulheit dadurch auszugleichen, dass ich andere Komponenten meines durchaus positiven Charakters durch bestimmte Mechanismen anspreche, um mir den Zugang zu den Pflichten zu erleichtern. Ich habe daher die Angewohnheit, die Akten, die auf meine Bearbeitung warten, direkt gegenüber meinem Schreibtisch und damit vor meinen Augen zu stapeln – als warnenden Zeigefinger und Appell an mein Pflichtgefühl.
Die unvorhergesehene Ausweitung meiner Aufgaben empfand ich als ausgesprochen unerfreulich. Ich nahm mir vor, darüber nachzudenken, wie ich diesen neuen Aufgaben aus dem Wege gehen könnte.
Ich hängte, wie immer, meine Gerichtsschlüssel an die als Haken gebogene Büroklammer, die ich an meiner Schreibtischlampe befestigt hatte – ein genialer Einfall, wie ich fand, um einen folgenschweren Verlust im Bermudadreieck meines Arbeitsplatzes zu verhindern.
Oben auf dem Aktenstapel der Neueingänge lag ein Schreiben der Kriminalpolizei, der Spurensicherung. Hochinteressiert riss ich den Umschlag auf. Eher knapp wurde mir mitgeteilt, dass die Spurensuche am übergebenen Fahrzeugrad, am Reifen und der Schraube keinerlei Spuren auf den Verursacher ergeben habe. Die Schraube sei ganz handelsüblich.
Irgendein finsterer Geselle hatte es nämlich geschafft, mir in den Wochen zuvor dreimal einen Plattfuß an meinem geliebten, alten Lancia H.P.E. zu verschaffen. Offensichtlich wurde immer nachts eine Schraube schräg vor eines der Räder gestellt und dadurch beim Losfahren hineingedrückt, sodass es dann anschließend zu Pannen kam. Beim ersten Mal glaubte ich noch an Zufall, beim zweiten wurde ich nachdenklich und beim dritten Mal kontaktierte ich die Kripo, die das Rad abholte und mir jetzt das magere Ergebnis mitteilte. Allerdings hatte mich Kommissar Haken vor drei Tagen angerufen und mir gesagt, auch bei Staatsanwältin Schmittchen – sie heißt eigentlich Schmitt, ist aber ziemlich klein und alle Welt nennt sie Schmittchen, aber manchmal auch „Giftzwerg“ – sei der Schraubentäter am Werk gewesen. Man werde verstärkt Streife an unseren Adressen fahren. Na bravo. Mein Freund Johann hatte dazu gesagt, das sei ja nun ein eher minimales Berufsrisiko eines Strafrichters. Und er hatte, aus seiner Sicht, vielleicht auch recht.
Mir war auch ein dunkler Verdacht gekommen, wer dahinter stecken könnte. Vor etwa zwei Monaten hatte ich einen Querulanten wegen Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch verurteilt. Resultat eines Nachbarstreites. Schmittchen war als Vertreterin der Staatsanwaltschaft im Verfahren aufgetreten. Und der Verurteilte hatte im Hinausgehen etwas vor sich hin gebrummelt, was so klang wie: „Man müsste diesen Justizärschen mal gehörig die Luft abdrehen.“ Aber was half es. Eine schlüssige Beweiskette war das ja nun nicht.
Während ich weiter in meinem Aktenstapel blätterte, dachte ich darüber nach, ob ich ihm vielleicht ein Kuvert mit Schrauben schicken sollte. Anonym natürlich. Mein Auto würde ich jedenfalls vorläufig im Hof des Landgerichtes lassen und mit dem Fahrrad zum Dienst fahren.
Unter drei weiteren Aktenbündeln fand ich einen Brief des Justizministeriums. Mir wurde mitgeteilt, dass ich bei der Tagung „Menschen vor Gericht“ nachgerückt sei. Es sei eine Tagung für die Richter aller Bundesländer und wegen der zuvor erfolgten Rückzieher einiger Kollegen und wegen des schon demnächst anstehenden Termins, Anfang nächster Woche, sei ein Rücktritt von der Anmeldung nicht mehr möglich. Die Gerichte seien gehalten, etwaige Vertretungsprobleme intern auszugleichen.
Ich hatte meine Anmeldung zu dieser Tagung vor etwa einem Vierteljahr längst vergessen. Die übliche Mitteilungsfrist war lange abgelaufen. Die Tagung hatte mich besonders interessiert, weil es darum gehen sollte, das eigene Verhalten vor Gericht, physische Auffälligkeiten, Körpersprache, Interaktionen und die sich daraus ergebenden psychischen Besonderheiten mit Hilfe von gestellten Verhandlungen zu untersuchen und zu interpretieren. „Gerichtsverhandlungen“, in denen jeder mit einer bestimmten, nur ihm bekannten konfliktträchtigen Anweisung geimpft würde und die mit Video aufgezeichnet und dann von einem Juristen und einem Psychologen mit den einzelnen Teilnehmern und in einer Gruppe von etwa zehn Personen besprochen werden sollten. Jeden Nachmittag war mit dem Psychologen Arbeit in einer Selbsterfahrungsgruppe vorgesehen.
Vermutlich hatte eine Reihe von Kollegen bei näherer Überlegung Bedenken bekommen bei dem Gedanken, dass sie selbst infrage gestellt und ihre psychischen Auffälligkeiten erörtert werden könnten. Na klar, das liebt ja niemand so recht. Aber dass Richter, die Herrscher des allerletzten Wortes, sich selbst hinterfragen sollen, fällt ihnen natürlich besonders schwer. Und selbstredend üben sie nach ihrem Selbstverständnis einen Beruf aus, bei dem Gefühle nichts zu suchen haben.
Nicht schlecht, gar nicht schlecht, dachte ich und warf einen Seitenblick auf die Hühnlein’sche Hinterlassenschaft.
Morgen würde ich dem Präsidenten und dem Vertreter Nummer drei mein tief empfundenes Bedauern darüber ausdrücken, dass ich aufgrund der übergeordneten, sozusagen auf Bundesebene angesiedelten Verpflichtung gehindert sei, meine Arbeitskraft in den nächsten zwei Wochen dem vakanten Referat zu widmen. Mir war klar, dass die zähneknirschende Nummer drei sich kein bisschen mit meinen Akten beschäftigen würde, um mir das heimzuzahlen. Aber ich konnte das gut verkraften, weil bei mir, trotz meiner Genbelastung, das Referat aufgeräumt war, wie man das so nennt.
Nach einer Arbeitsplanung der Woche bis zu meiner Abreise stürzte ich mich für den Rest des Tages ohne Mittagspause und mit Energie auf die in meinem Blickfeld liegenden Aktenstapel.
Am späten Nachmittag verließ ich das Gericht. Die Temperaturen waren zurückgegangen. In der Fußgängerzone drängten sich die Angestellten auf dem Nachhauseweg, die Käufer und die Spazierer mit fröhlicher Energie. Die Erleichterung über das Ende der Hitzeperiode war deutlich erkennbar.
Ich kaufte mir in der „Nordsee“ zwei Fischbrötchen und schlenderte in den Schlosspark. Kleine Grüppchen lagerten über die weiten Wiesen unter den vereinzelten Bäumen verteilt. Mütter schoben plaudernd parallel zueinander ihre Kinderwagen über die Wege. Hunde nutzten ihre Freiheit in ungestümem Übermut. Kinder planschten am Rande des kleinen Sees in der Mitte des Parks. Und auf der anderen Seite des Wassers bewegten sich auf einem kleinen Vorsprung zwei weiß gekleidete Gestalten in langsamen, harmonischen Bewegungen des Tai Chi.
Ich setzte mich etwas abseits unter einen alten, knorrigen Baum auf die Wiese und begann, meine Fischbrötchen zu essen. Am Himmel zogen vereinzelte Wolken. Interessante, fantasieanregende Gebilde. In den Blättern raschelte ein leichter Wind. Die friedliche, harmonische Stimmung entspannte mich, machte mich ganz ruhig. Ich legte mich zurück und schloss die Augen.
Eigenartig, wie Gerüche und Geräusche bestimmte Erlebnisse und Situationen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, der Jugend unmittelbar und ganz gegenwärtig hervorrufen können. Vielleicht war es auch der Geschmack des Fischbrötchens, das mich in meinen Empfindungen in meine frühen Tage im Norden am Wasser zurückversetzte. Im Blätterrascheln des Schlossparks fühlte ich mich wie unter den großen Bäumen am Deich, schmeckte das Salz in der Luft. Fühlte die intensive, sommerliche Freiheit, die ich in meiner Kindheit und Jugend genossen hatte. Mit Freunden, mit denen das Leben ganz unendlich und ungeheuer abenteuerlich und aufregend war.
Auch mit dem Erleben der ersten Verliebtheit, den Aufregungen, den zarten körperlichen Annäherungen. Ich konnte es tatsächlich spüren, wie mir liebevoll die Hand berührt, wie sie geküsst wurde. Jetzt fühlte ich die Zunge zwischen den Fingern, mir wurde warm.
„Mäxi“, rief eine energische Frauenstimme. Ich schreckte hoch und sah mich Aug in Aug mit einem grau-braun gesprenkelten Mischlingshund, der sich mit langer Zunge mit meiner rechten Hand und dem daran haftenden, für ihn scheinbar hochinteressanten Geruch des Fischbrötchens beschäftigte. Er sprang in die Höhe, ich hatte den Eindruck, dass er mir noch kurz mit seinem rechten Auge zublinzelte, drehte sich elegant in der Luft und jagte davon.
Der Park hatte sich schon etwas geleert. Es wurde bereits dämmerig. Ich musste tatsächlich einige Zeit geschlafen haben.
Vielleicht war es diese Stimmung.
Während ich am Schloss vorbei zur Stadt schlenderte, kam mir so plötzlich, dass ich stehen bleiben musste, eine Situation in Erinnerung, an die ich wohl Jahrzehnte lang nicht gedacht hatte. Ich war jung, sehr jung und saß verliebt in der Abenddämmerung mit Elke auf den Holzbohlen der alten Badeanstalt an der Oste. Ein erstes schüchternes Herantasten. Eine Wespe nervte uns. Ich umarmte Elke vorsichtig und verspürte auf einmal einen scharfen, stechenden Schmerz an meinem Hinterteil. Nur jetzt nicht unterbrechen dachte ich, versuchte entspannt und überlegen zu wirken und presste meinen Schenkel gegen das Holz, um die Wespe totzudrücken, die mich peinigte.
Aber der Schmerz verstärkte sich, und ich sprang schließlich mit einem Schrei auf. Meine unfachmännisch ausgedrückte Zigarette hatte ein Loch in die Hose und eine tiefe Brandwunde in meinen Hintern gebrannt.
Im Weitergehen dachte ich darüber nach, ob das Erlebnis wohl symbolhafte Bedeutung haben könnte: sozusagen erste Liebe und Schmerz?
Wegen des konkret betroffenen Körperteils schien mir das aber doch etwas weit hergeholt.
Noch eine eigenartige Erinnerung stieg in mir hoch. Wirklich eigenartig.
Mein älterer Bruder und ich liefen hintereinander um einen runden Holztisch. Ich vielleicht fünf Jahre alt und er neun. Ich mit einem Messer in der Hand hinter ihm her. Oder war es umgekehrt? Oder war das Ganze auch nur eine Traumerinnerung?
Meine Jugend mit der lässigen, großartigen Mutter und dem älteren Bruder war doch friedlich dort auf dem Land, wo wir gar nicht hingehörten. Es war eine wunderbare, entspannte, unabhängige Zeit.
Weil ich meinen Lancia im Hof des Landgerichtes gelassen hatte, machte ich mich mit der Straßenbahn auf den Heimweg nach Ettlingen. Von der Haltestelle hatte ich noch einen kleinen Fußmarsch zu meinem Hotel. Inzwischen war es dunkel geworden. Der „Albtäler“, die abendliche Brise vom Schwarzwald herab, hatte sanft zu wehen begonnen, der Halbmond stand tief am Himmel. Ich stieg die Außentreppe an der Rückwand des Hotels zum Dachgeschoss hinauf. Die Leitung des Hotels hatte dafür gesorgt, dass die Gäste nicht mit dem Volk dort oben in Berührung kamen.
Durch die Außentür gelangte ich in den Flur, von dem aus die einzelnen Räume abgingen. Ich kramte meinen Schlüssel aus der Tasche, um meine Tür aufzuschließen und stutzte. Die Tür zu meinem Zimmer war leicht geöffnet. Ich war vollkommen sicher, dass ich sie am Morgen, schon wegen der unsicheren Nachbarschaft, abgeschlossen hatte.
Vorsichtig öffnete ich sie etwas weiter. Ich konnte jetzt schräg hineinsehen, etwa die Hälfte des verwinkelten Raumes war zu überblicken. Er wurde leicht durch das offene, schräg stehende Fenster vom kalten Licht des Mondes beleuchtet. Plötzlich hörte ich ein Rascheln. Ich zuckte zusammen, der Schreck fuhr mir in die Knochen. Sollte ich die Polizei rufen? Es gab natürlich eine ganze Reihe von Herrschaften, die ich verurteilt hatte und die mir vielleicht an den Kragen wollten. Zögernd öffnete ich die Tür weiter. In diesem Augenblick erlosch das Minutenlicht des Flures. Mein Herz pochte bis zum Hals.
Mit der rechten Hand griff ich um den Türrahmen, tastete nach dem Lichtschalter und machte das Licht an.
Bei Fernsehkrimis ärgere ich mich in solchen Situationen immer über die Drehbuchschreiber. Natürlich spaziert da das spätere Opfer sofort in das Haus, das Zimmer hinein und stellt dann gewöhnlich außerdem die originelle Frage „Ist da jemand?“, um dann wenig später erschlagen zu werden.
Was machte ich? Ich öffnete die Tür weiter und stellte die Frage „Ist da jemand?“ Erfreulicherweise bekam ich weder eine Antwort noch einen Hieb auf den Kopf. Ein weiteres Blatt Papier fiel raschelnd von meinem kleinen Schreibtisch im Lüftchen des geöffneten Fensters zu Boden.
Im Zimmer war alles durchwühlt. Die beiden Schränke waren offen. Meine Kleider waren herausgerissen. Die Schubladen waren geöffnet, der Inhalt war auf dem Boden zerstreut. Die Gitarre lag – erfreulicherweise unbeschädigt – auf dem Boden. Offensichtlich hatte man auch in ihr nach etwas gesucht. Die Matratze war hochgeklappt. Was glaubte eigentlich irgendwer, was bei mir zu holen wäre? Langsam beruhigte ich mich wieder, aber meine ganze Nachmittagsentspannung war verflogen.
Ich rief meinen Gewährsmann Haken bei der Kripo an, und er versprach, jemanden vorbeizuschicken.
Nach ungefähr einer halben Stunde kamen zwei müde Herren, schauten sich kurz im Zimmer um und fragten, ob etwas verschwunden sei. Ich hatte das schon überprüft. Es fehlte nichts. Eine recht wertvolle kleine Stereoanlage stand noch an ihrem Platz. Auch eine Geldbörse mit rund 200 Euro lag noch in einer der geöffneten Schubladen.
„Ist ja merkwürdig“, knurrte der eine der beiden. Sie sahen sich dann noch das Schloss an. „Keine Beschädigungen, wohl mit Originalschlüssel“. Sie klopften an den Türen der Nachbarn, die aber nicht da waren oder sich taub stellten. Ich beschloss, wieder einmal, mir so schnell wie möglich eine ordentliche Wohnung zu suchen.
Nachdem die beiden abgezogen waren, räumte ich auf und trank noch einen Schnaps aus dem Jahr 1940, der den Krieg eingemauert überstanden hatte und erst beim Abriss eines Hauses Ende der fünfziger Jahre wieder gefunden wurde. Ein Geschenk meines Freundes Klaas.
Sorgfältig verschloss ich die Tür, stellte einen Stuhl unter den Türgriff und legte mich ins Bett. Ich war jetzt tatsächlich wieder vollkommen entspannt und angstfrei. Kurz vor dem Hinabsinken in die Tiefschlafphase dachte ich: „Eigentlich bin ich doch ein cooler Typ.“
II.
Am Morgen erwachte ich sehr früh und war herrlich ausgeschlafen. Der Stuhl unter der Türklinke brachte mich in meine verunsicherte Gegenwart zurück. Ich fühlte mich jetzt etwas unwohl im Zimmer und beschloss, meinen Kaffee unterwegs zum Gericht zu trinken, aber vorher bei der Hotelleitung ein neues Schloss anzufordern.
Als ich hinaus auf den Gang trat und mein Zimmer abschloss, kam aus dem Zimmer am Ende des Ganges eine junge Frau. „Na, waren gestern die Bullen bei dir?“
Ich schaute sie erstaunt an.
„Ich rieche die Bullen auf Kilometer“, setzte sie fort. „Was wollten die denn von dir?“
Sie war hübsch, trug einen zu kurzen Rock und war für meinen Geschmack und für die frühe Morgenstunde etwas zu heftig geschminkt. Sie lächelte mir zu. Vielleicht waren die Opfer der Polizei automatisch ihre Freunde.
„Die haben was überprüft, bei mir hat gestern jemand eingebrochen“, sagte ich. „Danach haben sie hier oben an alle Türen geklopft. Waren Sie ... warst du gestern Abend nicht da?“
„Klar war ich in meiner Bude, aber meinst du, ich lasse die Bullen bei mir rein?“
„Ich habe aber vorher so einen komischen Typ gesehen, der hier rumlauerte.“ Sie schien Gefallen an mir zu finden. Lächelte mich wieder herzlich an: „Komm, du kriegst einen Kaffee von mir. Ich erzähle dir, was ich gesehen habe.“ Einladend öffnete sie die Tür zu ihrem Zimmer.
Der Raum war vollkommen anders eingerichtet als meiner. Ein übergroßes Bett mit einer aufgetürmten Kissenlandschaft nahm die gesamte hintere Wand ein. Davor standen zwei sehr bequem aussehende Sessel und ein kleiner Couchtisch. In einem großen Aquarium an der Rückwand tummelten sich leuchtende Fische. Eine kleine nette Essecke trennte die Küchenzeile vom Rest des Raumes. Ein riesiger Bildschirm beherrschte die Wand gegenüber dem Bett. An den Wänden hingen erotische Poster. Die Jalousie am schrägen Fenster war geschlossen. Sie schaltete das recht gedämpfte Licht an.
„Ist ja wirklich schön bei dir. Hast du das alles selbst eingerichtet?“ Sie nickte stolz, und ihre Zuneigung für mich schien sich noch zu steigern.
„Also. Als ich gestern am frühen Abend nach Hause kam, stand hinten am Aufgang zur Treppe ein dunkler Typ. Der drehte sich gleich um, als ich eintrudelte und ging weg. Er kam mir komisch vor. Ich habe ein Gefühl dafür. Ich habe gedacht, er hat es auf mich abgesehen. Man kann nicht vorsichtig genug sein bei meinem Beruf.“ Sie beugte sich vor und schenkte mir einen Kaffee ein, nicht ohne mir dabei einen tiefen Einblick in ihr stattliches Dekolleté zu bieten. „Danach, als ich im Zimmer war, habe ich gehört, wie jemand in unseren Gang gekommen ist und an einer Tür herumgebastelt hat. Ich bin natürlich nicht hinaus und hab nachgesehen. Ich kann mich hüten! Was hat er denn bei dir geklaut?“