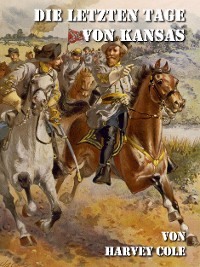Kitabı oku: «Die letzten Tage von Kansas»
Harvey Cole
Die letzten Tage von Kansas
Kompaktroman
Carpathia Verlag
© 2012 Carpathia Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung: Robert S. Plaul
Illustration: Henry Alexander Ogden (Library of Congress)
ISBN 978-3-943709-36-0 (EPUB)
ISBN 978-3-943709-38-4 (PDF)
Mehr Kompaktromane unter www.kompaktroman.de.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 1
Sie waren nur dünn besiedelt, die Territorien Nebraska und Kansas. Und das Leben dort war friedlich, zumindest solange die alte Mason-Dixon-Linie noch Bestand hatte. Sie teilte die Vereinigten Staaten in solche, in denen die Sklaverei erlaubt war und in die anderen, in denen sie verboten war. Doch dann kam das Kansas-Nebraska-Gesetz. Machtgierige Politiker hatten es erlassen, unter dem Deckmantel der Demokratie. Mit dem Kansas-Nebraska-Gesetz zog die Gewalt in die einst friedlichen Territorien ein, und nichts sollte mehr so bleiben, wie es einst war. Die Mehrheit sollte dereinst über die Sklaverei entscheiden, wenn die Territorien reif waren, als Bundesstaaten in die Union aufgenommen zu werden. Von Nord und Süd strömten Siedler nach Kansas und Nebraska. Mit ihnen zogen Banden, die neue Siedler wieder vertreiben sollten – ja nach dem, auf welche Seite sie sich schlugen. Mord und Brandschatzung waren an der Tagesordnung. Gegner und Befürworter der Sklaverei bekämpften sich mit aller Härte und Brutalität. In Sachen Grausamkeit standen sie einander in nichts nach. Das alles geschah am Vorabend des amerikanischen Bürgerkrieges, und es gibt nicht wenige, die behaupten, dass auf den Gebieten von Nebraska und Kansas der Bürgerkrieg schon mal geprobt wurde. Man nannte es »The Border Riots«, die Grenzunruhen.
Wer versuchte, sich herauszuhalten, lebte gefährlich in diesen Zeiten. Das galt auch für Adam Gatlin. Adam war ein hochgewachsener, schweigsamer Mann, die aschblonden Haare hatte er meist unter einem gewaltigen schwarzen breitkrempigen Hut verborgen. Überhaupt galt ihm offensichtlich die Farbe schwarz für ganz besonders. Schwarz waren nicht nur Jacke, Weste, Hemd, Hose und Stiefel, schwarz war auch sein großes, kräftiges Pferd namens Roscoe. Doch das Seltsamste an diesem Tier war, dass es eine hellgraue, ja fast weiße Mähne trug, lang und seidig, ebenso wie der üppige Schweif. Derlei hatte man, zumindest in Kansas, noch nie gesehen.
Wie Adam nach Kansas kam, wusste er eigentlich selbst nicht so genau. Als junger Mann, kaum zwanzig, hatte er den amerikanisch-mexikanischen Krieg mitgefochten. Als der unglückliche Daniel Bowie mit seinen 180 Getreuen zum Alamo ritt, wäre er wohl auch dabei gewesen, wenn ihn nicht ein schlimmes Fieber ans Bett gefesselt hätte, von dem nicht wenige glaubten, dass es ihn das Leben kosten werde. Nun, er hatte sich vom Fieber erholt und Bowie war mit den anderen im Alamo zugrunde gegangen, dahingemetzelt von Santa Anna, der das kleine Grenzfort vier Wochen lang mit 3.000 Mann belagert hatte. Der mexikanische General hatte keinen am Leben gelassen, der ihm Widerstand geleistet hatte. »The Alamo« – das war zum Fanal dieses Krieges geworden, den die Mexikaner schließlich verloren hatten und der der Welt den kurzlebigen eigenständigen Staat Texas bescherten, der bald in die Union aufgenommen wurde.
Adam trieb sich nach dem Krieg im Süden herum, verdingte sich im Hafen von Savanna als Arbeiter, versuchte sich als Spieler in New Orleans und als Verwalter einer Pfirsichplantage in Georgia. Er war dort Aufseher über zwölf Sklaven, die von ihren Herren ebenso gut wie von ihm behandelt wurden, doch nach einem halben Jahr war Adam klar, dass dies nichts für ihn war. Er landete für ein Jahr als Vermesser beim Eisenbahnbau. Auch das hielt ihn nicht. Er ließ sich treiben. Dieses wunderbare Land war so unermesslich groß, dachte er sich, warum sollte man irgendwo Wurzeln schlagen.
So überschritt er eines Tages die Grenze nach Kansas. Er hatte wohl von den Grenzunruhen gehört und sich nicht besonders dafür interessiert. Er hatte kein besonderes Verhältnis zu Kansas und auch nicht vor, länger zu bleiben. Eigentlich war – wenn auch verschwommen – Montana ganz im Norden sein Ziel. Was er dort wollte, wusste er auch nicht so recht. Zumindest der Name gefiel ihm. So dachte er an Montana, als Roscoe ihn mit langsamen, ja majestätischen Schritten nach Harmsville trug. Das kleine Städtchen sollte das Leben von Adam Gatlin nachhaltig verändern.
Kapitel 2
Harmsville war ein kleines Städtchen mit ein paar Hundert Seelen. Es bestand im Wesentlichen aus einer Hauptstraße, an der sich drei Dutzend Häuser aneinanderreihten. Auf dem großen schwarzen Roscoe thronend, passierte Adam Gatlin einen Krämer, den Hufschmied mit Mietstall, das Büro des Sheriffs und den Saloon »Western Flower«. Gegenüber lagen das Hotel »George Washington« und ein Tischler. Ein Bestattungsunternehmer hatte seine Werkstatt nebenan. Eine weiß getünchte Kirche mit einem putzigen Glockentürmchen schloss sich an. Das ganze Ensemble wurde von einigen Privathäusern vervollständigt.
Adam war schon mehrere Stunden unterwegs und freute sich nun auf eine Erfrischung, ein Bad und eine Nacht im Hotel in einem richtigen Bett. Es war schon spät am Nachmittag. Die Schatten wurden länger, als er Roscoe am Saloon anband und durch die Schwingtür den Saloon betrat. An einem runden Tisch in der Ecke saßen drei Männer, die Poker spielten, der Barkeeper polierte die Gläser und hob nur die Augenbrauen, als er sah, dass ein Fremder in den Saloon kam.
Adam stellte sich an den Tresen, tippte sich an die Hutkrempe und fragte nach einem kühlen Bier. Der Barkeeper nickte, griff nach einem Krug und füllte ihn, bis der Schaum über den Rand trat. Dann schob er den Krug über den Tresen und fragte knapp: »Weiter Weg?« Nicht, dass es ihn wirklich interessiert hätte. Fremde kamen zwar selten nach Harmsville, aber man war auch froh, wenn sie bald wieder weiter ritten. Seit die Unruhen immer schlimmer wurden, waren die Bürger der kleinen Stadt froh, wenn sie möglichst unbehelligt blieben. Auch Adam zeigte wenig Neigung, von irgendwelchen Abenteuern zu berichten und antwortete so knapp, wie es die Höflichkeit erforderte: »Ziemlich weit.« Fast gierig zog er den Krug an sich und nahm einen tiefen langen Schluck, dann seufzte er zufrieden. Er setzte nur kurz ab und ließ das kühle Bier erneut durch seine ausgetrocknete Kehle rinnen. Welch ein Genuss. »Gibt es im Hotel freie Zimmer?«, fragte er den Barkeeper. Der stutzte einen Moment und brummte dann. »Schätze, es wurde dafür gebaut, dass Zimmer frei sind. Fremde sind hier selten.« Adam hörte aus der Antwort sehr wohl heraus, dass Fremde nicht besonders gern gesehen waren und nicht länger bleiben sollten, als unbedingt nötig. »Bleibe nur eine Nacht, will weiter nach Montana.« Der Barkeeper polierte weiter und brummte: »Das ist aber noch verdammt weit. Soll dort ziemlich kalt sein.« Adam setzte sein Bier ab, das inzwischen leer war. »Hab ich auch gehört. Gutes Bier habt ihr hier. Ich nehme noch eins.« Zum ersten Mal lächelte der Barkeeper und ließ ein weiteres Bier einlaufen. Doch plötzlich gefror ihm das Lächeln auf dem Mund. Die Schwingtür ging auf. Ein junger Mann von 18 oder 19 Jahren kam herein. Er hatte feuerrotes Haar und wurde von einem dicklichen Jungen begleitet, der vielleicht zwei Jahre jünger war.
»He Jungs!«, rief der Rothaarige. »Habt ihr gesehen, was da draußen steht? So einen Gaul habe ich ja noch nie gesehen. Weiß jemand, wem der gehört?«
Adam, den Ärger schon ahnend, zog seinen Hut tiefer ins Gesicht. Doch der Junge hatte ihn schon als Besitzer von Roscoe ausgemacht.
»Hey, Mister, sie sind so schwarz wie der Gaul da draußen, der gehört sicher Ihnen.«
Adam drehte sich langsam um und musterte den jungen Mann lange und eingehend.
»Ja, das ist mein Roscoe, was dagegen?«
»Nein, aber so ein Pferd, von so einem Pferd habe ich immer geträumt. Ich kaufe es ihnen ab.«
»Roscoe ist nicht zu verkaufen«, entgegnete Adam und drehte sich wieder um.
»Mein Vater ist der reichste Mann hier weit und breit. Nennen Sie mir einfach einen Preis und dann ist das Geschäft gemacht.«
»Roscoe ist nicht zu verkaufen«, wiederholte Adam und drehte sich diesmal nicht mehr um. Er hörte das Klicken eines Revolververschlusses und den Jungen sagen: »Ich will das Pferd aber haben.«
Jetzt drehte sich Adam um und blickte in den Lauf eines alten Armeerevolvers.
Kapitel 3
Adam blieb ganz ruhig, als er in die Mündung des Revolvers blickte.
»Da, wo ich herkomme, werden Pferdediebe aufgehängt, junger Mann«, meinte er mit sanfter Stimme. Das schien den jungen Mann sehr zu erheitern. »Hast du das gehört, Stinky?«, fragte er seinen jüngeren Begleiter, der dem Treiben gespannt zusah. Die Männer an dem Pokertisch hatten ihre Karten niedergelegt und starrten in gespannter Erwartung auf den Rotschopf, der die Pistole im Anschlag hielt. Nun mischte sich der Barkeeper ein.
»Mach keinen Unsinn, Chris. Wenn der Mann dir sein Pferd nicht verkaufen will, dann will er es nicht verkaufen. Außerdem ist er auf dem Weg nach Montana. Da braucht er ein starkes Pferd.«
»Halts Maul, Sam. Du weißt genau, dass ich immer das kriege, was ich will. Wer weiß, wenn er sich mit Pferdedieben so gut auskennt, dann ist er vielleicht selber einer.«
Adam betrachtete die Situation eher als unangenehm, denn als gefährlich. Es hatte schon bedeutend brenzlichere Momente in seinem Leben gegeben. Der junge Mann mit Namen Chris stand etwa drei Meter von ihm entfernt. Die Distanz war heikel. Der Junge war mit einem Revolver bewaffnet, er mit einem halb vollen Bierglas. Trotzdem schätzte er die Chancen nicht schlecht ein, den Schreihals zu entwaffnen. Er überlegte, ob er ihm danach eine Tracht Prügel verabreichen oder ihn einfach mit einem Tritt nach draußen befördern sollte. Doch der Reihe nach. Sicherlich würde er auf den ältesten aller Tricks hereinfallen. Adam schaute ihn stumm und nachsichtig an. Plötzlich hob er die Augenbrauen, blickte über den Jungen hinweg und sagte laut und vernehmlich: »Gut, dass Sie kommen.« Sofort wandte der Junge den Kopf um. In diesem Moment riss Adam das Bierglas hoch und schleuderte es mit aller Gewalt gegen den jungen Mann. Es traf ihn nicht voll, streifte ihn aber so hinter dem Ohr, dass er den Revolver fallen ließ, der nun über die Dielen des Saloons schlitterte. Der Junge schrie auf.
»Verschwinde jetzt und lass mich in Ruhe«, grollte Adam, »sonst setzt es eine Tracht Prügel.«
Der kleine dicke Junge mit Namen Stinky jedoch schnappte sich den Revolver, der vor seinen Füßen liegen geblieben war, schaute ihn unschlüssig an und warf ihn dann seinem Freund zu. Nun riss Adam seinen Revolver aus dem Holster. Der Junge hatte die Waffe aufgefangen, zielte auf Adam und schoss. Der hatte sich bereits geduckt und schoss zurück. Die Kugel traf den Jungen in die Brust. Stumm und fassungslos blickte er auf die Wunde, sah das Blut aus seinem Oberkörper rinnen. Er öffnete seinen Mund, aus dem nun ebenfalls ein Schwall Blut quoll. Dann brach er zusammen und war tot.
Der kleine Dicke rannte entsetzt hinaus und heulte: »Er hat Chris getötet, er hat Chris getötet.«
Adam atmete schwer. Er befahl dem Barkeeper: »Holen sie den Sheriff!«
»Wir haben keinen Sheriff«, erwiderte er aufgeregt, »Verschwinden Sie, solange sie noch können, das ist der Sohn von Francis Monteque.«
»Und wenn es der Sohn des Teufels wäre, ich laufe nicht davon. Ich habe nichts unrechtes getan. Dann schicken Sie jemanden zu seinem Vater. Ich werde das klären.«
Der Barkeeper schaute Adam mit großen Augen an.
»Sie meinen das nicht ernst, Mister?«, fragte er zweifelnd.
»Natürlich meine ich das ernst, holen sie den Vater. Ich bin kein feiger Mörder, der davon rennt.«
Der Barkeeper nickte einem der drei Pokerspieler zu. Der rannte aus dem Saloon, um den Vater zu holen. Adam bestellte noch ein Bier. Nun setzte er sich aber an einen Tisch mit dem Rücken zur Wand. Er legte die Beine auf den Tisch, zog den Hut ins Gesicht und wartete.
Eine Stunde später flogen die Flügeltüren auf. Im Saloon stand Francis Montegue.
Kapitel 4
Die Nachricht von der Schießerei hatte sich in Harmsville in Windeseile herumgesprochen und natürlich auch, dass der widerborstige fremde Wert darauf legte, die Sache persönlich mit Francis Montegue zu klären. Über den Ablauf gab es keine zwei Meinungen. Barkeeper Sam und die drei Pokerspieler sagten übereinstimmend aus, dass dem Fremden gar nichts anderes übrig geblieben sei, als zu schießen. Selbst die wirren Aussagen des 16jährigen Stinky, der ja seinen Teil zur Tragödie beigetragen hatte, ließen nur einen Schluss zu. Der Fremde hatte eindeutig in Notwehr gehandelt. Dass er blieb, um sich vor Montegue zu rechtfertigen, empfanden die Bürger von Harmsville zwar als honorig, aber auch als ziemlich dumm. Wer würde sich schon freiwillig mit dem mächtigen Francis Montegue anlegen? Es nimmt also nicht Wunder, dass sich nach einer Stunde, als der reiche Plantagenbesitzer den Saloon »Western Flower« betrat, sich bereits drei Dutzend Menschen im Saloon drängten. Sie waren nach und nach gekommen und erörterten den Fall aufgeregt. Nun erstarben die Stimmen und eine Gasse bildete sich zu dem Tisch, an dem noch immer der schwarz gekleidete Fremde saß, die Beine hochgelegt, den Hut ins Gesicht gezogen. Die Leiche des unglücklichen Chris Montegue war inzwischen zum Bestatter geschafft worden, nur ein großer dunkelroter Fleck auf den Dielen zeugte noch von dem Drama.
»Sie haben meinen Jungen getötet, dafür werden Sie bezahlen, Fremder«, zischte Montegue. Er war ein hochgewachsener, elegant gekleideter Mann von etwa 50 Jahren. Seine scharf geschnittenen Gesichtszüge ließen darauf schließen, dass er jemand war, der lieber selbst Entscheidungen traf, als Befehle entgegen zu nehmen.
»Ich wollte mich dem Sheriff stellen, Ihre Stadt hat keinen, also stelle ich mich Ihnen – vorausgesetzt, Sie sind ein Mann von Ehre, der das Gesetz respektiert.«
Montegue lief rot an vor Wut. Noch nie hatte sich jemand ihm gegenüber solch eine Frechheit herausgenommen.
»Sie wagen es!«, rief er voller Wut und wollte nach seinem Revolver greifen. Doch da stand Adam Gatlin bereits und zielte auf ihn. Jetzt war es an Gatlin, seine Wut zu zeigen.
»Ihr Sohn wollte mein Pferd stehlen. Ich habe ein Glas nach ihm geworfen, dann hat er auf mich geschossen. Ich war schneller. Das können alle, die hier waren bestätigen. Anderswo würde er jetzt vielleicht noch leben, aber sie würden ihm gerade das Händchen halten, weil er in einer Stunde aufgeknüpft würde. Ich kenne Sie und Ihre Sorte. Habe im Süden genug davon kennengelernt. Aufgeblasen und selbstgerecht, ihr glaubt, dass für euch das Gesetz nicht zählt. Von Rechtswegen sollte man Sie aufhängen, denn der eigentliche Mörder an ihrem Sohn sind Sie – Sie haben es nicht geschafft, ihrem Sohn Anstand und Respekt vor dem Gesetz beizubringen. Wäre ich nicht gewesen, wäre morgen ein anderer gekommen und hätte ihn über den Haufen geschossen.«
Zustimmendes Gemurmel erfüllte den Raum. Montegue ließ seinen Kopf sinken, murmelte etwas von »das werdet ihr noch alle büßen« und verschwand. Die Bürger umringten Adam, klopften ihm auf die Schulter und beglückwünschten ihn zu seiner ehrenhaften Haltung. Er ließ sich zu einem Drink nötigen, bat dann aber, ins Hotel gehen zu dürfen und versprach am Abend noch einmal den Saloon aufzusuchen.
Als Adam gegen sieben zurückkam, waren noch mehr Menschen da, die alle applaudierten, als er den Saloon betrat. Ein älterer Mann mit eisgrauem Backenbart und rundem Bauch, über den sich eine goldene Uhrenkette spannte, stellte sich vor: »Mein Name ist Sam Lawrence, Richter Sam Lawrence. Ich würde gerne mit Ihnen im Namen unserer Bürger sprechen. Es ist nämlich so. Unser Sheriff ist vor einem halben Jahr gegangen. Zog in den Norden. Die Unruhen, sie wissen ja. Sie haben heute bewiesen, dass Sie ein Mann von Ehre sind, der das Gesetz respektiert und es auch verteidigt. Wir haben uns gefragt, ob Sie dieses Amt nicht übernehmen wollen?«
Kapitel 5
»Ihr Angebot ehrt mich«, stammelte Adam verlegen, »Sheriff? Nein, so was! Hätte nie gedacht… aber eigentlich, ja eigentlich bin ich auf dem Weg nach Montana, wissen Sie.«
»Was wollen Sie denn in Montana?«, fragte der Ehrenwerte Sam Lawrence direkt. Adam dachte nach. Eigentlich konnte er die Frage selbst nicht so recht beantworten. Der Name hatte ihm einfach gefallen. Im Süden hatte es ihm nicht mehr gefallen. Die Menschen hatten dort immer häufiger vom Krieg gesprochen. Hier in den Unruhegebieten sollte er angeblich schon angekommen sein – behaupteten wenigstens einige. Das war der eigentliche Grund. Doch sollte er den Leuten hier sagen, dass er vor einem möglichen Krieg davon lief. Sie würden ihn für einen Feigling halten. Er merkte, dass ihn die Leute erwartungsvoll anstarrten. Auf einmal kam ihm alles, was er vorhin über Recht und Gesetz gesagt hatte, ziemlich hohl vor. Es wäre zumindest hohl, wenn er nun kneifen würde. Er zuckte mit den Schultern und meinte: »Sheriff? Ja, warum eigentlich nicht. Scheint ja eine nette kleine Stadt zu sein, mit gottesfürchtigen und gesetzestreuen Bürgern – die meisten wenigstens.«
Wie aus dem nichts hielt der Richter plötzlich eine Bibel in der Hand. Mit der anderen steckte er ihm einen sechszackigen Stern an. »Legen Sie die Hand auf die Bibel und schwören Sie, dass sie stets die Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika, des Territoriums von Kansas und der Stadt Harmsville achten und verteidigen werden.« Adam tat, wie ihm geheißen und sagte feierlich: »Ich schwöre.«
So also wurde Adam Gatlin zum Sheriff von Harmsville. Er bekam 25 Dollar die Woche, kostenlose Verpflegung von der Witwe Biggs, Roscoe einen Platz im Mietstall von Mr. Harris und die ersten Wochen übernahm die Gemeinde auch die Kosten für Adams Hotelzimmer im »George Washington«. Als er den Wunsch nach einem eigenen kleinen Häuschen ein wenig außerhalb der Stadt äußerte, waren die Bürger begeistert, denn das konnte nur bedeuten, dass sich Adam Gatlin länger in der Stadt niederlassen wollte.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.