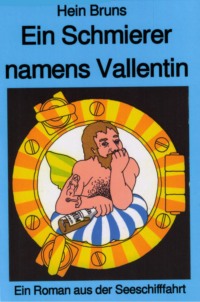Kitabı oku: «Ein Schmierer namens Vallentin», sayfa 3
Der Morgen flimmert fahl durch die dunklen Palmen. Dorfköter kläffen heiser. Im Osten zeigt sich das erste Rot. Die Moskitos sind abgeflogen. Wir sind erst gegen Morgen eingeschlafen, da weckt uns dieses verdammte Schnurren und Klopfen. Die Mädchen werden ins Boot bugsíert. Ihre Gesichtsfarbe ist fahl, fahl von den Anstrengungen der Nacht, fahl vom grauen Schimmer des Morgens. Der Abschied ist unfreundlich, nur Ernesto wird noch mit einem langen Kuss von wulstigen Lippen bedacht. Ja, Ernesto hat einen dicken Schlag bei den Huren. Wir sind hundemüde. Der Spanier und der Portugiese haben ausgeschlafen, sie hat das Weibervolk nicht weiter berührt. Wir schlürfen den dünnen Kaffee, den der Moses eben von der Kombüse geholt hat, und sind mürrisch. Gehen bis zum Arbeitsbeginn an Deck. Der Morgen ist heller und etwas kühler, auf dem Gambia liegt leichter Nebeldunst. Es ist windstill, und aus den Elendshütten des Dorfes steigt schmutziger Rauch in den Morgen. Die grüne Mauer des Urwalds schweigt. Vom Ufer lösen sich flache Boote. Die Ladung kommt. Mit hastigen Ruderschlägen kämpfen sie gegen die Strömung. In graue Lumpen sind sie gehüllt, die Ruderer. Sie schnalzen mit der Zunge, und die Riemen ächzen. Die Ladung kommt. Endlich ist diese verdammte Liegezeit in diesem gottverdammten Nest vorbei. Die Winden rattern und rumoren wieder. Die Ladebäume schwenken und zerren in den Geien. Die schwarzen Ladungsarbeiter palavern und singen bei der Arbeit. Hiew auf Hiew wird vom Bauch des Schiffes gefressen. Hiew auf Hiew. So geht das zwei Tage und zwei Nächte. Maststrahler und Sonnenbrenner erhellen das das Schiff. Die Ladungsboote finden ihren Weg leicht. Rudern hin und her. Leer ans Ufer, voll zurück zum Schiff, und Hiew auf Hiew wird gefressen. So geht das zwei Tage und zwei Nächte. –
Die Anker lösen sich aus dem Schlick des Gambia. Das Rummeln und Poltern der Ankerkette ist an diesem Morgen ein unbarmherziger Wecker. Wir dampfen den Gambia hinab, und der blaue Südatlantik nimmt uns auf. Die Tage sind heiß, und die Wachen im Maschinenraum heißer. Aber keine Moskitos mehr. Sonnenheiße Tage und glatte See. Sternenhelle Nächte und phosphoreszierendes Bug- und Schraubenwasser. Jeden Morgen um vier Uhr, nach Wachschluss, stehen Ernesto und ich auf dem Vorschiff. Lehnen auf der Verschanzung, lassen den Schweiß aus unseren Wachklamotten vom warmen Fahrtwind trinken. Rauchen, sprechen und lassen den Morgen kommen. Die afrikanische Küste liegt in den Wehen des beginnenden Tages. „Du, Ernesto, was wissen wir Seeleute eigentlich von den Ländern, die wir besuchen, oder von den Städten in diesen Ländern?“ Ernesto sagte: „Nichts, mein lieber Freund. Absolut nichts. Aber wozu auch? Was weiß denn ein Taxifahrer von den Sehenswürdigkeiten seiner Stadt? Nichts. Ja, er kennt wohl das Rathaus und die Kirchen und sonstige Gebäude, kennt jede Straße - das ist berufsbedingt - aber die Bedeutung und die Herkunft der Namen bestimmt nicht. Interessiert ihn auch gar nicht. Was weiß denn das Zugpersonal eines Fernzuges von den Sehenswürdigkeiten der Städte, wo ihre Züge enden? Nichts, von Ausnahmen abgesehen. Kennen Artisten die Städte und Landschaften, in denen sie auftreten? Nein. Und wir, was kennen wir? Auch nichts. Den Namen der Stadt oder des Landes wissen wir. Wir kennen dafür aber die Puffs und die Kneipen, wo die Huren sind. Oder hast du schon mal einen Seefahrer kennengelernt, oder bist du mit einem gefahren, der Museen besuchte oder Kirchen besichtigte, in den Zoo oder botanischen Garten ging? Ich jedenfalls noch nicht. Aber was sollen wir auch da? Du, ich sage dir, es gibt Seefahrer, die wissen nicht einmal, in welchem Lande sie sich befinden, können es dir nicht einmal auf der Karte zeigen. Die meinen, Rotterdam läge in Belgien und Monrovia in Tunesien. Aber die Preise in den Puffs und in den Kneipen wissen sie, und die Nutten kennen sie mit Namen. Und in den Hafenstädten wissen die Taxifahrer über die Nutten und Kneipen auch Bescheid. Bist du schon mal über die Grenzen einer Hafenstadt hinaus gekommen?“ „Ich muss gestehen, dass es selten genug war.“ „Siehste. Meistens bist du in der ersten Kneipe an der Küste, wo Tingeltangel war, eine Box plärrte, oder eine Band wieherte, hängengeblieben. Oder wenn du dich in eine Taxe gesetzt hast, um nicht an der Küste hängen zu bleiben, brauchtest du dem Taxifahrer gar nicht dein Reiseziel zu sagen, er fuhr dich sowieso in den Puff. Das passiert dir in der ganzen Welt.“ Ich sage: „Das stimmt schon alles, Ernesto, aber es ist doch nicht richtig.“ „Wieso nicht richtig? Aus welchem Grund wolltest du wohl in alten Gemäuern herum krauchen, wo dir der Putz auf den Kopf fällt? Was interessieren dich Kirchen oder Tempel, wo du Gold siehst, das man den verbohrten Gläubigen aus der Nase gezogen hat? Was hast du von Museen, wo du alten, vergammelten, ausgegrabenen Plunder sehen kannst, wenn 's hoch kommt, ein paar vertrocknete Mumien, von denen du nicht weißt, ob sie echt sind? Oder denke an Gemäldeausstellungen, wo das Publikum durch rast. Irgendwann, vor zweihundert oder mehr Jahren, hat ein geiler Maler vollbusige und vollärschige Weiber gemalt, Weiber, die heute im Puff kein Mensch auch nur mit dem Arsch ansieht - jedenfalls ich nicht. Was haste von so einer Gemäldeausstellung, hm? Da gehen die feinen Leute auf die Fuchsjagd. Da steht irgendwo so 'n schwuler Lord in Positur. Da flattern goldene Engel um einen heiligen Kopf, oder ein heiliger Knabe wird von Pfeilen durchbohrt. Du siehst einen angeschnittenen roten Schinken, einen gekochten Hummer und einen toten Hasen, der seinen Rüssel über die Tischplatte hängt … und der Hintergrund ist dunkel. Du siehst in einer alten Bauernstube Leute beim Fressen oder Landsknechte beim Saufen.“ „Und wie ist es mit dem Theater?“ werfe ich ein. „Theater“, sagt Ernesto verächtlich, „das ist genau so 'n fauler Zauber. Da hopsen so ein paar Leutchen in einer Scheinwelt herum, verzapfen irgendwelchen Mist aus dem vorigen Jahrhundert oder singen sich stundenlang an.“ „Aber trotzdem. Andere Leute geben viel Geld aus, um in der Welt herumzukommen. Und ich will gar nicht mal sagen, dass es immer nur die Reichen sind. Mancher spart sich für eine Seereise das Geld mühsam zusammen, spart es sich wohl auch am Munde ab. Andere wieder haben eine Schwäche für alte Gebäude, für mittelalterliche Städte und so weiter, das kannst du doch nicht einfach als Nonsens bezeichnen. Nein, Ernesto, das kannst du nicht.“ Ernesto schnippt seine Camelkippe lässig über Bord und sagt: „Du Idiot. Hast du dir die Leute eigentlich schon einmal näher angeguckt, die da so durch die Welt reisen? So! Erstmal fragen sie den Seeleuten an Bord das Hemd vom Arsch, und wenn sie irgendwo an Land gehen, stehen sie da mit den Reiseführern vor einem Bauwerk, Prospekte in der Hand und reißen das Maul auf und mimen Erstaunen und Verstehen, manchmal auch Andacht. Mensch, dann könnt' ich ihnen in die Fresse schlagen. Abends aber sitzen sie in der Kneipe und peilen hinter dem Rücken ihrer Ehefrauen doch nach den Schönen des Landes, oder sie sind in den Puffs die Kunden, die die Preise versauen. Und ihre Erinnerungen, die sie zu Hause am Stammtisch preisgeben, drehen sich um die Weiber, um das Wetter und um den ausgezeichneten Wein oder Cognac oder was weiß ich für 'n Gesöff. Vielleicht sind nicht alle so, aber die meisten doch.“ „Ja, das ist alles schon richtig, aber was uns Seeleute angeht, da darfst du auch nicht vergessen, Ernesto, dass uns meistens die Zeit fehlt. In unseren Hafenliegezeiten arbeiten wir von morgens bis abends in Scheiß und Dreck und arbeiten schwer, das weißt du. Da hat kein Deubel mehr Lust, noch Museen oder Kirchen zu besichtigen oder ins Theater zu gehen. Dann ist man abends doch froh, dass man sich auf den Sack legen und filzen kann.“ „Faule Ausreden, stinkfaule Ausreden. Gib doch ruhig zu, dass uns das alles nicht interessiert. Wieso? Du bist ja nicht zu müde, um abends noch in eine Kneipe zu latschen oder in den Puff zu gehen, wo du ja bekanntlich auch nicht schläfst. Nee, nee, mein Lieber, wir wollen einander keinen Wind vormachen und das Kind beim richtigen Namen nennen.“ Wir schweigen. Sehen über das Wasser. Die afrikanische Küste steigt aus dem Blau, und die Sonnenscheibe schiebt sich blutrot an der Kimm empor. „Komm, Valentin, wir gehen schlafen.“ Von der Brücke glast es zwei Schläge – Fünf Uhr.
Die Wachen und Tage vergehen im Gleichmaß der Zeit. Den Äquator haben wir überquert. Sang- und klanglos. Auf einem deutschen Schiff ist das immer ein Fest, allerdings auch nur ein Grund, um sich wieder einmal anständig zu besaufen. Für mitfahrende Passagiere ein Grund, um Bier und Schnaps für die Besatzung springen zu lassen. Als Gegengeschenk wird ihnen nach der täuflichen Drangsalierung ein bunt bedruckter Taufschein überreicht, der sie mit dem Namen irgendeines Meerungeheuers bedenkt. Auf ausländischen Trampfahrern, gar noch unter der Panamaflagge, gibt es so einen Firlefanz nicht, obwohl wir einer zünftigen Sauferei und anschließendem Beischlaf mit den weiblichen Passagieren nicht abgeneigt wären. –
Wir laufen zum Bunkern für einige Stunden Kapstadt an. Bunkern Kohle, für uns eine mörderische Schinderei. Übernehmen Frischproviant, das meiste sind natürlich Konserven ... und Hammelfleisch. Landgang unmöglich. Abends sind wir wieder auf offener See, dem Indischen Ozean, Kurs Kalkutta. Diese Fahrt durch das Indische Meer hat etwas Seltsames an sich. Fast wochenlang ostwärts fahren heißt: den Sonnenaufgang überholen. Und zurück: einen Tag gewinnen. Raum fließt in Zeit und Zeit in Raum. Himmel, Wasser, runder Horizont. Reise durch die Zeit mehr als durch den Raum. Blaue Wellen unterm Steven, grauschwarze oder grüne. Hoch gekuppelter Himmel. Lämmerwolken. Wetterleuchtende Regensäcke. Landschaft aus Dunst. Fahren wir im Kreise? Kein Merkmal gibt der Raum. Allmorgendlich rückt die Zeit um fünfzehn Minuten vor. Um diese Zeit sind wir dem Sonnenaufgang näher gekommen. Wir überqueren die Linie noch einmal sang- und klanglos, diesmal nachts. Der Mond ist noch unten, aber die Sterne sind hell genug. Fettig glänzen die Wellenrücken wie flüssiges Blei. Perlmuttersplitt vorm Steven. Der Wind ist umgeschlagen, er ist unstet und unklar hier.
Indien
Der Dunst, der Indiens Küste deckt, bringt in den nächsten Tagen Sumpfgeruch und Blütenparfüm mit dem Wind. An einem Morgen weht Regen in unser Logis, und der schwere, süßliche Duft blühender Tropenbäume fällt durch die geöffneten Bullaugen. Der Lotse ist heute Nacht schon an Bord gekommen. Das Fahrwasser des Hooglys ist eng. Urwaldzotten lassen ihre einzelnen Haare sehen: fleischfarbene, blühende, flachwipfelige Riesernbäume, Palmenkronen und Bambusschächte. Feistgrün umdschungelte Inseln. Keglige Berge, von Urwald überwachsen. Mittags treten Ernesto und ich, wie schon seit Wochen, unsere Wache an. Streifen das nahe Ufer mit einem Blick und eilen, um nach mittschiffs zu kommen, um den sengenden Strahlen der Sonne zu entgehen. Das Deck ist glühend. Wir gehen die Wachen beim Zweiten Ingenieur. Und wie man 's nimmt, ein Kerl wie Samt und Seide, nur saufen tut er nicht. Er ist Engländer und gehört einer komischen christlichen Sekte an, die behauptet, bei einem Weltuntergang wären ihre Leute die einzigen Überlebenden. Für ihn sind wir nur das glaubenslose Gesindel. Aber Gesindel her, Gesindel hin, jedermann kommt mal zum Zug. Wir fühlen die Lager durch, greifen in das schwingende Eisen. Tasten die Gleitbahnen ab, kontrollieren Schmiervasen und Ölwannen. Werfen einen Blick auf die Wasserstände und Kessel ... und sind schon schweißgebadet. Wir lösen Elmar und den Spanier ab. Sie wischen sich die verschmierten Arme und Hände ab. Sie wünschen uns eine gute Wache und ziehen sich am blanken heißen Treppengeländer nach oben. Bricht dann krachend Eisen, als würden von tausend Mann tausend Nüsse geknackt. Fliegt dann wirbelnd Eisen gegen die Eisenschotten, als würfen tausend Mann mit trockenen Erbsen. Tausend Mann rasseln ... abgerissene Haltebolzen. Tausend Mann hämmern, ... irrende kindskopfgroße Muttern. Tausend Katzen zischen, ... ausströmender Heißdampf. Oben auf der Zylinderstation stelzt beinern der Tod. Schreit ein Mensch gellend vor Schmerz und in Todesangst. Und einer ist gleich still. Und oben steht eine weiße Wolke, aus der es nass tropft und spitz schreit. Steht eine weiße Wolke, genährt aus der gusseisernen wunde des Hochdruck-Zylinderkopfes. Die Maschine steht, die Eisenmassen pendeln aus. Die Lichtmaschine tickert, die Pumpen stöhnen, und tausend Katzen zischen weiter. Bleiche Gesichter. Kommandoworte. Ventile werden geschlossen. Wir stürzen nach oben. Der Spanier liegt ganz still. Gesicht, Arme und Hände rohes Fleisch. In der Schläfe ein Loch, das Blut schießt durch seine schwarzen Haare. Aus der weißen Wolke regnet es Blut. Der Tod stelzt beinern davon. Elmar schreit und ruft in seiner Muttersprache. Wir verstehen kein Finnisch. Schmerz kennt keine Nationalitäten. Und Elmar wird an Deck gebracht und schreit immer noch. Der Kerl wie Samt und Seide fleht uns an: „Helft, helft, wir müssen die Maschine wieder klar kriegen. Helft. Das Schiff liegt auf einer Barre. In fünf Stunden ist Niedrigwasser, dann brechen wir auseinander. Helft!“ Gesindel hin, Gesindel her, jedermann kommt mal zum Zug. Unsere Hände greifen nach glühenden Werkzeugen. Der Schweiß und der Dampf reißen die Augen rot. Der Schweiß schwappt in unseren Schuhen. Und ein Mensch wimmert, und einer liegt ganz still. Wir sehen uns nicht mehr, nur unsere arbeitenden Fäuste. Wir spüren uns nicht mehr, nur unsere schlagenden Herzen. Worum es geht, wissen wir. Bohren in die Stummel der Haltebolzen Loch bei Loch, Loch bei Loch. Schlagen, kreuzen, meißeln und schneiden Gewinde. Setzen Haltebolzen, fabrikblanke, dicht bei dicht, dicht bei dicht. Und aus der weißen Wolke regnet es Stahl. Setzen Stiftschraube an Stiftschraube. Schwitzen, fluchen, arbeiten. Wir, das Gesindel, und der Kerl wie Samt und Seide. Und wir wickeln uns Asbestbinden um die blasigen Arme, binden uns nasse Tücher vor Mund und Nase. Wir, das Gesinde, und der Kerl wie Samt und Seide. Saufen muckenweise Tee mit Rum, Arbeiten. Werden weich in den Knien ... und schaffen es. Es ist noch nicht Ebbe, da raucht der Schornstein wieder. Der Spanier ist tot. Liegt an Deck und die Fliegen sind schon da, und die Hitze ist immer da. Das Ufer ist so nahe. Elmar liegt im Schiffshospital. Dem Kerl wie Samt und Seide haben wir das Haarwasser auch noch ausgesoffen. Wir sind Wieder das Gesindel. „Ob der Tote wohl noch mit dazu gerechnet wird?“ sagt Ernesto.
Um Mitternacht macht S. S. „BABITONGA“ im King-George-Dock zu Kalkutta fest. In großen, lateinischen Buchstaben steht der Name zweimal Bug, einmal am Heck. Und auf den Rettungsringen.
Während der Liegezeit in den Docks von Kalkutta kann man an Bord nicht scheißen gehen. Und die Docks sind die Liegeplätze der Schiffe. Wochenlang. So wälzt sich an jedem Morgen eine Schlange von Heizern und Matrosen, von Offizieren und Ingenieuren, Stewards und Köchen hin zu den kleinen roten Backsteinbauten, aufgestellt an der Stirnseite der Docks. Ja, auch hier haben „die“ achtern eine besondere Brille: „for oifc. Only“. „Die“ haben auch einen Schlüssel, für uns stehen die Türen offen. „Die“ haben Einzelkabinen, wir sitzen wie die Hühner auf der Stange. So wird es im Himmel wohl auch sein. Nur die Kapitäne kriegen ein Privatscheißhaus gestellt, es steht meistens in ihrem Baderaum und sieht aus wie eine Kochkiste, mit Heu und so. Ja, die Kapitäne haben es gut. Die Kiste hat zwei Henkel und jeden Morgen ziehen zwei Dobasse, einträchtig die Kiste zwischen sich balancierend, von Bord und hin zu dem kleinen Backsteinbau an der Stirnseite des Docks. Auch Kapitäne sind nicht ausgeschlossen, nur brauchen sie nicht selbst zu laufen.
Die Kräne sind rostig. Die Lagerhäuser und Schuppen gelb. Die Palmen verstaubt. Die braunen Hafenarbeiter verlunzt und zerlumpt, aber die Lumpen sind bunt. Barfuß sind die Hafenarbeiter und faul. Dumpf und brutig liegt der Dunst des Morgens zwischen den armseligen Lehm- und Wellblechbehausungen des Hafenviertels. Zwei Wagen stehen an der Gangway. Der eine ist alt, schwarz und verkommen, er soll einen Toten aufnehmen. Der Tote muss weg, sonst fängt er an zu stinken. Der andere trägt an jeder Seite ein grellrotes Kreuz, er soll einen Verbrannten aufnehmen. Der Verbrannte muss weg, sonst stirbt er und fängt auch an zu stinken. Die Wagen stehen nebeneinander. Die Fahrer räkeln sich in den Sitzen und schnattern miteinander. Der eine raucht mundwinklig eine Maisblattzigarette, der andere kaut Betel. Beide spucken sie, der eine weiß, der andere rot. Beide spucken sie in hohem Bogen und gezielt. Nass und rot spreizen sich die Spucksterne auf dem heißen Kaipflaster. In seine alte fadenscheinige Wolldecke gewickelt - diesmal braucht er es nicht selbst zu tun – trägt man den Spanier von Bord und schiebt ihn in das Auto. Das schwarze, das verkommene. Mit den Augen geben wir ihm das letzte Geleit. Ja, wir dürfen noch hier an Deck stehen, unsere Arbeitszeit hat noch nicht begonnen. Der Portugiese schlägt das Kreuz. Der Fahrer spuckt noch einmal aus, winkt seinem Rote-Kreuz-Kollegen lachend zu, tritt auf den Starter, und der Wagen hoppelt über die Kranschienen. Die panamesische Flagge hängt auf Halbmast. Ernesto sagt: „Von seiner Restheuer muss der Spanier wohl seine eigene Beerdigung bezahlen.“ Elmar wird auf einer Bahre in den Rote-Kreuz-Wagen geschoben. Sein Gesicht ist wie Magermilch. Ernesto sagt: „Man gut, dass man die Wagen nicht verwechselt hat.“
Unsere Arbeitszeit beginnt. Oh ja, wir müssen pünktlich sein, sonst setzt man uns an Land, und wer weiß, wann wir wieder eine Chance kriegen. Ich habe wohl von Bilbao bis hier schon ein paar Kröten verdient, um mich ein paar Wochen über Wasser halten zu können, aber trotzdem. Wenn man in der Zeit kein Schiff kriegt, was dann? Zwei Dampfkessel werden außer Betrieb gesetzt. Die anderen zwei liefern den Dampf für den Hafenbetrieb, geben Dampf für die Lichtmaschine, für die Ballast-, Lenz- und Speisewasserpumpen und für die Deckswinden. Mit langen Feuerkrücken werden die niedergebrannten Feuer aus der Buchse gerissen und die Rosten ausgebaut und der Wolf, der hintere Teil der Buchse, frisch ausgemauert. Das restliche Wasser im Kessel drückt der Dampf außenbords. Die Mannslochdeckel werden geöffnet, und wir beginnen die Kesselreinigung. Eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter totgeschlagen hat. An der Arbeit beteiligen sich auch die Heizer. An Bord sind weiße Heizer. Kerle, zusammengewürfelt wie wir. Es wird gemunkelt, dass wir farbige Heizer kriegen sollen, sie sind in den Tropen widerstandsfähiger ... und vor allen Dingen, sie sind billiger. Kesselreinigen. Mit fünf Mann, jeder mit einer Ölfunzel ausgerüstet, zwängen wir uns nacheinander durch das Mannloch in den Kessel hinein und picken und hämmern und schaben und kratzen den Kesselstein und das Salz von den Rohrbündeln. Eine Sauarbeit. Die Luft ist gesättigt mit heißer Feuchtigkeit, der Kesselstein sitzt fest auf den Rohren und an den Kesselwinden und ist glashart und spritzt wie Glas. Und wir sind nur noch triefende Schweißhaufen. Gehämmert, gepickt, geschabt, gekratzt, gebürstet und geschwitzt. Der Kerl wie Samt und Seide kommt jede Stunde und kontrolliert, ob wir auch die Rohre von unten bearbeiten. Dazu muss man auf dem Rücken liegen und sich zwischen die Rohre klemmen, man muss sich winden und drehen und den Kopf nach unten hängen lassen. Der Schweiß läuft in die Augen, die Hitze nimmt einem den Atem. Aber im Kessel ist noch keiner gestorben. Verfluchter Mist. Man sollte den ganzen Scheiß hinschmeißen, seinen Seesack packen, aussteigen und unter den Kanakern leben. Man sollte ... man sollte ... man sollte sonst was machen. Und wir hämmern und schaben und picken und kratzen und bürsten weiter, dass uns das Wasser im Arsch kocht. Die Rohre und Wände werden metallisch blank, und die Ölfunzeln blaken. Der Tag vergeht, und wir sind ausgelaugt, leergepumpt. Unsere Augen tragen Ringe wie Großstadtnutten im Einsatz, und der rote Hund fängt an zu bellen – Schweißpickel auf dem ganzen Körper, die sich entzündet haben. Auf unsere Matratzen fallen wir und scheuchen den Moses immer wieder nach mittschiffs, uns kalten Tee zu holen. Der Moses sagt: „Es kann beim Zahlmeister Vorschuss geholt werden.“ Und die Besatzung steht Schlange vor der Kammer des Zahlmeisters. Schöne knisternde Scheine, bunt und mit Bildern. Scheine, die Vergessen versprechen. Scheine, die uns weiche Betten, Brüste und Beine vorgaukeln. Scheine, für die man Reisschnaps und Rum kaufen kann. Scheine, knisternde Scheine.
Wir nehmen eine Doppelrikscha, Ernesto und ich. Der Mann in der Deichsel schwitzt wie ein Ackergaul. Er hat eine doppelte Fuhre, er kriegt auch doppelte Taxe. Der Mann in der Deichsel trabt barfuß über den heißen Asphalt und große Schweißperlen stehen auf seinen braunen Rückenmuskeln. Immer im Trab. Unser Ziel kennt er, ohne zu fragen. Kiddapur: Das Nuttenviertel von Kalkutta. Im Bungalow, Valparaiso-Lane Nummer 7, wohnen die „Töchter der Freude“. Bei ihnen ist der Deichselmann auch angestellt, er soll die Seeleute von den heißen Docks in die kühlen Betten der Nutten bringen. Immer im Trab. Immer im Trab und barfuß über den heißen Asphalt. Und schwitzen muss er wie ein Ackergaul. Trab an, verdammter Kerl, arbeiten müssen wir auch, und schwitzen müssen wir auch, warum sollst du es besser haben als wir, he? Bist auch so 'n armes Schwein wie wir, nur dass der liebe Gott uns eine weiße Hautfarbe gegeben hat. Trab an, wir wissen selbst, was das für ein Scheißleben ist. Los hoppla, immer im Trab. Wir wollen zu den Töchtern der Freude, zu den verkommenen und verhurten und geschäftstüchtigen Sumpfdotterblumen des Wunderlandes Indien. Wir wollen für unsere knisternden Scheine was erleben, wollen nacktes Fleisch sehen und betasten. Ob braun, weiß oder schwarz, die Hautfarbe spielt keine Rolle. Wir wollen unsere ausgedörrten Kehlen mit Reisschnaps auskratzen, und wollen brüllen wie die Stiere. Los, los, immer im Trab. Warum hältst du an dieser Kreuzung, he? Damit wir der bettelnden Frau mit ihrem blinden Kind auf dem Arm ein Bakschisch geben? Geben wir nicht, wir haben nur knisternde Scheine, und die brauchen wir. Warum fährst du so langsam, he? Damit wir dem Schwarm von Bettelmönchen und Gauklern und Schlangenbeschwörern ein Bakschisch geben? Los, trab an, wir wollen mit unseren knisternden Scheinen in den Puff.
Es schwingen sich grellbunte, erleuchtete Lampions in weichen Ketten um das Haus. Im Garten blüht der Jasmin. In unseren Taschen knistern die Scheine, neue, bunte. Die Nutten im Bungalow, Valparaiso-Lane Nummer 7, sind lieb zu uns, - für unser Geld.
Sie streicheln und liebkosen uns, - für unser Geld. Sie küssen uns, – für unser Geld. Sie legen sich hin, – für unser Geld. Sie schlafen mit uns, – für unser Geld. Sie lieben uns nicht ... und wir wissen das. Was sollen wir sonst wohl auch mit Geld? Wir brauchen keine Waschmaschine, unsere Hosen und Hemden werden in einer Pütz unter das Steamrohr gehalten und gekocht, und die Tropensonne trocknet das Zeug in einer halben Stunde. Knochentrocken. Wir brauchen uns um die Fresserei nicht zu kümmern, auf unserer Back ist immer Brot und Margarine und Jam zu finden ... und auch Hammelfleisch. Was sollen wir mit Geld? Wir wollen nicht fernsehen und nicht nach Italien reisen. Die Huren in der Valparaiso-Lane Nummer 7 schlafen mit uns, und unsere bunten Rupienscheine knistern in kleinen, braunen, gierigen Händen. Und die Lampions sind gelöscht, wenn das Haus voll ist, die Betten belegt sind, die Huren für die Nacht einen Beischläfer haben. Auch der Rikschakuli hat ein Bakschisch gekriegt, und er schläft in seiner Karre. Die heiße Tropennacht steht in den Gassen, durch den Garten zieht der Jasminduft, und in den Basars werden noch Pfannkuchen bei greller Karbidbeleuchtung in Hammelfett gebraten. Schönes Wunderland Indien. Wir liegen auf schmuddelig weißem Linnen und greifen an braune Brüste. Saufen den scharfen, pisswarmen Reisschnaps aus flachen, japanischen Schalen. Lassen uns von einem Boy mit Palmenwedel Frischluft über die heißen Körper fächeln und fühlen uns wie die Millionäre. Alles für unser Geld. Wir schwitzen eben für unser Geld zweimal. Einmal, wenn wir es verdienen und einmal, wenn wir es ausgeben. Der Jasminduft und der Hammelfettgeruch ziehen durch die Fensterlöcher, und auf mageren Fenstersparren tänzeln Ratten. Und wir meinen, das Glück zu halten, wollen auch über Glück nicht streiten. So findet eben jeder sein Glück woanders: Der eine in der Heide oder im Wald, und wir eben im Puff zu Kalkutta-Kiddapur, Valparaiso-Lane Nummer 7. Im King-Grorge-Dock liegt S. S. „BABITONGA“ mit zwei sauberen Kesseln. In eine fadenscheinige Wolldecke gewickelt liegt der tote Spanier, und in einem billigen Hospital liegt der verbrühte Finne Elmar. So hat alles seine Ordnung. Und ich rufe zu Ernesto rüber: „Das Leben ist doch schön, nicht wahr, Ernesto?“ Ernesto ruft zurück: „Du hast den Arsch offen, Valentino!“
Die Sonne fällt uns an wie ein reißendes Tier, und der Rikschakuli hat auf uns gewartet. Wir gehen zu Fuß, in unseren Taschen knistern keine Scheine mehr. Den Tropenhelm schieben wir in den Nacken und laufen am Strande des Hooglys entlang. Wenn sich Krähen um den Kadaver eines toten Hasen streiten und sie auf und ab schießen, sich mit hastigen Flügeln überschlagen, Loopings drehen, sich angreifen, ankrächzen und anhacken und gierig zum „Trog“ stoßen, wenn sie feige und hysterisch immer auf dem Sprung stehend langhälsig ihre Schnäbel, die verfressenen, in das rote Fleisch wühlen und geduckt die herausgerissenen Fetzen verschlingen und sich dabei noch angeifern, anzetern, anfeilschen … dann sollte man mit Schrot dazwischen halten. Aber wenn hässlich blaue, bohnengroße Schmeißfliegen und korallenrore, krallige Ameisen sich um die toten Augen eines Kindes streiten, sie umschwärmen, umkrabbeln, lautlos und gefühIlos in die Augen hinein krabbeln mit haarigen Beinen und reißenden Rüsseln, wenn dieses Geschmeiß wie eine große, dunkle Sonnenbrille die leeren Augen verdeckt und sich ablöst im Saufen und Fressen und Eierlegen ... dann sollte man zu beten anfangen. Der Hoogly wälzt sein schmutziges Wasser an den schmutzigen Ufern Kalkuttas vorbei. Lehmhütten starren mit verfemten Augen dem Wasser nach, dem schmutzigen. Lehmhütten mit Bastmatten und Feuerstellen. In den weißen Häusern und Luxusbungalows am Viktoriapark sind ein wenig mehr Möbel und wohl auch Klaviere und Bücherschränke und darin bestimmt eine Bibel. In den weißen Häusern und Bungalows sind grün und weiß und lila gekachelte Badezimmer. Die Straßen vor den weißen Häusern und Bungalows sind asphaltiert. Warum auch nicht. Hier vor den Lehmhütten tut es der Müll. Dort fahren Cadillacs, hier scharren magere Hühner. In den weißen Häusern und Bungalows herrscht Kühle, in den Lehmhütten heiße, dumpfe Schwüle. Dort ist Völlerei, hier macht man Hungerkuren. Dort ist der liebe Gott ... und hier auch. Der liebe Gott ist überall, und auch die heiligen Kühe sind überall, und auch die Sonne ist überall. Gott sieht man nicht, ob ER das wohl alles sieht? Ich meine die weißen Häuser und prachtvollen Bungalows und die braunen, elenden Lehmhütten, die Badezimmer und die kargen Feuerstellen? Die Cadillacs und die mageren Hühner, die Sattheit und den Hunger? Ob der liebe Gott das wohl alles sieht? Die heiligen Kühe sicherlich, so sagen nämlich die Priester. Oh, wie ich diese Biester, diese Fettwänste, diese überheblichen Kühe hasse, obwohl sie heilig sind. Ach, sie sind ja erst zu Heiligen gemacht worden. Sie räkeln sich auf dem Asphalt genau wie im Müll. Um sie herum kurven die Cadillacs, um sie herum scharren die Hühner, die mageren. Sie sind fett wie Ratten zur Zeit des Bombenkrieges. Sie sind eingebildet wie Starlets und faul wie Schalterbeamte. Sie fressen den Ärmsten das Letzte weg und sind gierig wie Priester. Sie sind eben heilig. Die Sonne brennt wie eine Lupe. Die Lehmhütten lassen willig eine Lücke, die grau und zertreten zum Wasser führt. „Hoppla Ernesto, stolpere nicht über das tote Kind. Guck mal, die Fliegen lassen sich nicht einmal stören.“ Da liegt ein kleiner Junge mit verkrampften Gliedern und schon leeren Augenhöhlen, die umgaukelt sind von stummen, totstummen Aasfressern. Ein wenig Gesumme ist da, aber der kleine Inder hört das nicht mehr. So wie er lebte, lautlos und lustlos. So wie er krepierte, kampflos und ergeben. So liegt er da auf dem groben Jutesack. Lautlos, lustlos, bescheiden, ergeben, still und verkrampft. Aus der Lehmhütte getragen auf dem Jutesack, über die festgetretene graue Lücke zum Strand ... hin zum Wasser, das ja auch heilig ist. Und der Holzstoß neben der Leiche, aus groben, abstrakten Knüppeln und Ästen geschichtet, die Lücken mit Heu, trockenen Palmenwedeln und einer Daily Mail abgedichtet, wird des Jungen letztes, brennendes Lager sein, bevor er in das Nirwana eingeht. Einer Mutter Kind, eines Vaters Sohn. Wo sind sie wohl, die beiden? Schönes Wunderland Indien. Krähen kann man verscheuchen oder abknallen, sie sind feige. Fliegen und Ameisen nicht. Wenn wir mit dem Tropenhelm auch einige erschlagen oder unsere Füße auf die Rollbahn der Ameisen setzen, was hilft es? Man sollte beten, damit das Schicksal dem kleinen, toten Jungen die große, dunkle, lebende Sonnenbrille abnimmt. Aber wir wissen, dass Gebete nichts gegen Schmeißfliegen und Ameisen ausrichten können. Haha, an die Fußsohlen gehen keine Fliegen und Ameisen heran, sie sind hart. Hart gedrückt von der indischen Erde, und sie sind gelb wie Naturgummi. Nein, da ist für die Fliegen und Ameisen nichts zu holen. Die Rippen des Jungen sehen aus wie die Spanten eines Faltbootes. Sein Bauch ist eingefallen, nur der Nabel ist dick und rund wie eine Ping-Pong-Kugel. Einer Mutter Kind, eines Vaters Sohn. Alle Fliegen müssten kommen, alle, alle Fliegen Kalkuttas, nein, alle Fliegen Indiens, und alle müssten sich festfressen und festsaugen, und die Ameisen auch ... und alle, alle müssten dann mit verbrennen, verbrennen mit ihrer Brut. Dann hätte der Tod des kleinen Jungen noch einen Sinn, und das wäre gerecht. Die beiden braunen Gestalten, die die Lücke und der Sand heranführen, sehen uns nicht einmal. an. Sie ergreifen die vier Zipfel des Jutesarges, der kleine Leichnam wackelt ein bisschen, ein paar Ameisen purzeln noch in den Sand, ein Schwarm Fliegen kann nicht mehr landen ... und mit einem geübten Schwung liegt der kleine tote Inder auf dem Holzstoß. Ernesto sagt: „Man wird doch nicht etwa den Sack mit verbrennen?“ Und der Randa hüllt alles ein, und der Rauch steigt in die Sonnenglut, bleistiftgerade. Das Heu und die Palmenwedel und die Daily Mail sind verbrannt, und nun streiten sich nur noch die roten Flammen um den Körper eines indischen Kindes. Der kleine Junge ist gar nicht wieder zu erkennen. Die Haare sind gleich weg. Die Verkrampfung hat sich gelöst. Der Bauch ist geschwollen. Die Haut ist über Faltbootspanten straff und gespannt und wird gleich platzen. Beinchen und Ärmchen sind Beine und Arme geworden. Was so ein Feuer alles anrichten kann. Arme und Beine werden immer dicker, schwellen, leben scheinbar wieder und platzen. Keine Träne, keine Blume. Kein Lied und auch kein Gebet, kein Gedenkstein. Ein schwelender Haufen Menschenfleisch. Dreckiges Wasser und grauer Sand und triste Lehmhütten. Glühende Sonne und im Schatten der Mangobäume die heiligen Kühe, wiederkäuend. Oh, wie ich die Viecher hasse. Aus dem Grün des Viktoria-Parks grüßen weiß und arrogant die Prunkbauten. Zisch-zasch macht es noch, und dann tragen die schmutzigen Wasser des Hooglys Holzasche und die Überreste eines Kindes mit sich fort. Der Hoogly ist heilig. Der Indische Ozean ist groß. Einer Mutter Kind, eines Vaters Sohn.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.