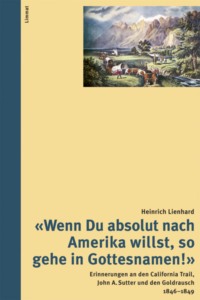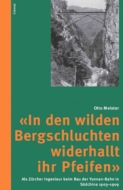Kitabı oku: «"Wenn Du absolut nach Amerika willst, so gehe in Gottesnamen!"», sayfa 6
Zwei Wochen vor der Abreise begaben sie sich nach Glarus auf die Kanzlei, um ihre Pässe abzuholen. Lienhards «Reise-Pass» datiert vom 10. August 1843, und das «Signalement des Tragers» lautet wie folgt: «Alter: 21 Jahre; Grösse: 5 Fuss 8 Zoll; Haare: dunkelbraun; Augenbrauen: item; Stirne: gewöhnlich; Augen: hellbraun; Nase, Mund: mittler; Kinn: rund; Gesicht: oval; Besondere Kennzeichen: keine.»76 Nachdem sie das lang ersehnte Reisedokument sicher in ihrer Tasche wussten, mischte sich auf dem Nachhauseweg sogar ein wenig Wehmut in ihre Vorfreude: «Auf dem Rückweg von Glarus über Mollis nach Hause besahen wir noch unsere romantischen Glarnerberge. Da erhoben sie sich so Majestätisch, und doch sahen sie so friedlich aus an diesem freundlichen, sonnigen Augusttag. ‹Werden wir diese herrlichen Berge wieder sehen?›, fragten wir uns, ‹es ist halt doch schön hier!›»77
Am 24. August fiel der Abschied vom Vater so versöhnlich aus, wie Heinrich es sich immer gewünscht hatte: «Während meine Brüder Peter und Kaspar meine Reisekuffer hinten auf das Chaisechen78 für mich befestigten, waren mein Vater und ich noch allein im Hause. Wir tranken etwas Wein zusammen und vergaben uns jeden Fehler, welchen wir gegen einander begangen haben mochten. Plötzlich sagte der Vater zu mir: ‹Heinrich, bleibe hier! Ich will Dir gern alle Auslagen ersetzen, wenn Du hier bleibst.› Daran erkannte ich deutlich genug, dass der Vater mich doch noch lieb hatte, woran ich früher so oft zweifelte. Freilich konnte ich seinem Wunsche nicht entsprechen, denn ich sagte ihm, dass, wenn ich auch wirklich wollte, so dürfte ich mich so etwas nicht unterstehen, indem man mich für immer verhönen würde. Jetzt war Unten alles fertig, der Vater wollte mich noch bis Lachen begleiten. Aber aus dem Väterlichen Hause, in welchem ich das Licht der Welt zum Erstenmahl erblickte, in welchem ich meine Kindheit durchlebt und gross geworden durch die gütige Pflege und Vorsorge meiner Eltern, besonders meiner nun modernden, unvergesslichen Mutter, deren Augen ich zudrückte – es that mir doch Wehe, ich mochte mich dagegen wehren, wie ich wollte.»79
In Lachen stiegen die beiden jungen Männer mit ihren Angehörigen zu einem letzten gemeinsamen Mittagessen im Gasthof Zum Bären ab. Später begaben sie sich zum Landungssteg, wo das Botenschiff nach Zürich wartete, und nahmen Abschied. «Der Vater blieb noch längere Zeit an der Landung stehen», erinnert sich Lienhard, «wahrscheinlich glaubte er, mich zum Letztenmahl gesehen zu haben. Ich schwenkte ihm noch manchmahl mein Nastuch, bis auch er endlich den Platz verliess.»80
Nach einer unruhigen Nacht auf Heu und Stroh war Lienhard frühmorgens der Erste, der das unbequeme Lager verliess. Selbst die vielen Flohbisse der vergangenen Nacht vermochten seine frohe Aufbruchstimmung nun nicht mehr zu trüben. In Zürich angekommen, besorgte er sich er sich ein deutsch-englisches Wörterbuch, während sich Aebli auf die Suche nach einem Transportmittel für ihre Weiterfahrt Richtung Basel machte, mit gutem Erfolg: Beim Landeplatz der Frachtkähne erklärte sich einer der Bootsleute bereit, ihn und seinen Reisegefährten – als einzige Passagiere – für wenig Geld bis nach Laufenburg mitzunehmen. Ihr Gepäck sowie «einige schwere Stücker Roheisen und eine Anzahl fetter Kälber für die Bäder in Baden»81 wurden eingeladen, dann ging es auf dem langen, spitzen Kahn in schneller Fahrt via Limmat, Aare und Rhein flussabwärts. Am Abend machte man bei einem Gasthof Halt für die Nacht: «In dem Wirtshaus fanden wir noch ganz unerwartet einen unserer nächsten Nachbarn, Friedolin Streif, welcher mit Schabzieger handelte und am nächsten Tag nach Zurzach wollte, welches unweit von Da zwischen der Aare und dem Rhein liegen soll. Durch Streif sandten wir unsern Verwandten noch einmahl Grüsse heim.»82 Am Nachmittag des 26. August erreichten sie Laufenburg, von wo sie mit einem Fuhrwerk nach Sisseln gelangten.
Hier wartete bereits ein junger Mann von Ruflis Reisegruppe: «Wir fanden bei unserer Ankunft nur ein einziger Passagir von St. Gallen namens Jakob Behler, welcher wie wir Highland83 als das Endziel seiner Reise nach Amerika betrachtete. Behler hatte die selbe Broschüre von Salomon Köpfli über Neu Helvetia84 gelesen wie wir, und seine zwei Brüder und er wurden dadurch ebenso sehr wie Aebli und ich für das neue gelobte Land begeistert, als welches wir Highland dieser Beschreibung gemäss halten mussten. Wir betrachteten uns, als wären wir schon alte Bekannten, und hatten, soviel ich mich erinnere, keine Ursache, späther diese Bekanntschaft bereuen zu müssen.»85
In den folgenden Tagen trafen nach und nach weitere Reisende ein, vor allem Leute aus den Aargauer Gemeinden Küttigen, Erlinsbach und Frick, darunter viele Familien mit Kindern. Als Transportmittel für die Reise nach Le Havre dienten zwei grosse, breite gedeckte Wagen, in denen Bänke angebracht waren und die von je vier bis fünf starken Pferden gezogen wurden. Lienhard und Aebli waren der Ansicht, dass die beiden Wagen überladen seien, besonders nachdem sich ihnen vor Basel noch eine Gruppe von etwa zehn Berner Emigranten angeschlossen hatte.
Am 31. August passierten sie die Grenze bei St. Louis, danach ging die Reise langsam, aber stetig in nordwestlicher Richtung quer durch Frankreich: «Nancy ist eine schöne Stadt in einer herrlichen, mit Wein bebauten Gegend noch im Lotringischen. Wir hielten uns aber nur so lange auf, als nöthig war, das Mittagessen einzunehmen. Chalons ist eine grosse und schöne Stadt, Paris liessen wir zu unserer Linken ligen. Rouen erreichten wir Nachmittags zirca um Vieruhr; es nahm uns zwei volle Stunden, bis wier diese Stadt passiert hatten. Nachher bezogen wir wieder in einem grossen Pferdestall unser Nachtquartier86. Rouen ligt an der Seine, es kommen schon kleinere Seeschiffe bis dahin. Die Landung sieht einem Seehaven ähnlich, und man riecht schon den Teer, sieht grosse Taue, Anker, Matrosen – überhaupt war da viel Leben und geschäftiges Treiben.»87 Lienhard gehörte zu den jungen Leuten, die bei dem fast ausnahmslos schönen Sommerwetter einen guten Teil der Strecke zu Fuss zurücklegten, und wenigstens darin sah er einen Vorteil gegenüber der Beförderung mit der Postkutsche: «Auf diese Art, wie wir reisten, hatten wir natürlich gute Gelegenheit, Frankreich, soweit wir kamen, besser zu besehen, und ich war entzükt über die grössten Theils schönen, gutbebauten, fruchtbaren Gegenden.»88
Nach zweiwöchiger Reise näherten sie sich ihrem ersten grossen Etappenziel: «Sonntag, den 14. Sept. kamen wir plötzlich auf einer Anhöhe an, von wo aus wir zum Erstenmahl das Meer erblickten. Es war eine prächtige Aussicht, die See glänzte wie ein Silberspiegel und erweckte in uns Gefühle eigener Art.»89 Wenig später erreichten sie die Stadt Le Havre. Als sie dort beim letzten Essen mit Rufli in einem Gasthaus sassen, trat ein Mann auf sie zu und erkundigte sich, ob es unter ihnen Glarner gebe. Er stellte sich selbst als Glarner namens Legler vor und anerbot sich, Leuten aus seinem Heimatkanton bis zur Abfahrt des Schiffes zu helfen, da er sich in Le Havre gut auskenne und einige Tage Zeit habe. Aebli und Lienhard nahmen das Angebot dankbar an und trennten sich von der Rufli-Gruppe.
Legler brachte sie zuerst in einem besseren Gasthof unter und begleitete sie in den folgenden Tagen bei ihren Besorgungen. Als Erstes kauften sie sich ihre Schiffspassage auf dem amerikanischen Segelschiff «Narragansett»90. Dann besorgten sie sich das noch fehlende Geschirr und Bettzeug sowie zusätzliche Essensvorräte für die mehrwöchige Seereise. Am 18. September mussten sich die Schiffspassagiere an Bord einfinden, und in Lienhards Pass vermerkte der Commissaire de Police Délégué neben dem Polizeistempel: «Vue pour La Nouvelle Orléans sur Le Navire Le Narraganset. Havre Le 18 Sep. 1843.»
Die Wahl des neuen, dreimastigen Segelschiffes sollte sich als Glücksfall erweisen, strenge Regeln an Bord sorgten für Ordnung und Hygiene und machten den Schiffsalltag auch für die gut achtzig Passagiere des Zwischendecks erträglich. Mehr als fünfzig von ihnen waren Schweizer, denn auch Rufli hatte für seine Gruppe Passage auf der «Narragansett» gebucht. Am 20. September meldete das Journal du Havre, die «Narragansett» habe den Zoll passiert und stehe kurz vor dem Auslaufen. Am folgenden Tag ist das Schiff auf der Liste der «sorties» aufgeführt.91
Auf offener See wurden Aebli und Lienhard wie die meisten Mitreisenden zuerst seekrank. Danach verlief die Reise ohne Zwischenfälle – mit einer Ausnahme, und diese hätte für Heinrich Lienhard ein böses Ende nehmen können. Aebli und er wollten sich eines Tages mittels einer Pumpe, die ausserhalb des Schiffbugs befestigt war, mit Meerwasser waschen. Lienhard stieg als Erster hinunter, stellte sich unter die Pumpenröhre und hielt sich mit der linken Hand an einem Tau fest; dann rief er Aebli zu, langsam mit Pumpen zu beginnen. Da stürzte das Wasser mit solcher Wucht auf ihn nieder, dass er vor Schreck seinen Halt fahren liess und nur noch reflexartig mit der andern Hand das Tau wieder packen konnte. Es stellte sich heraus, dass oben ein irischer Matrose Aebli von der Pumpe weggedrängt hatte, um diese sogleich mit aller Kraft selbst zu betätigen. Der Schock blieb Lienhard zeitlebens in Erinnerung: «Die See war allerdings ganz ruhig und fast spiegelglat, aber da ich nicht Schwimmen konnte, weiss ich doch nicht, wie es mir ergangen, wäre ich hinab gestürzt.»92
Als sie sich nach der Atlantiküberquerung der Karibik näherten, griff der Kapitän immer öfter zum Fernrohr, und eines Tages ertönte endlich der Ruf: «Land in Sicht!» Langsam tauchte am Horizont die östliche Spitze der Insel Hispaniola auf, doch zu Lienhards Bedauern passierten sie diese in grosser Entfernung. Heinrich Lienhard war von der ersten Seereise an ein begeisterter Schiffspassagier. Bei all seinen Schiffsreisen zählte er am Morgen stets zu den Ersten, die an der Reling standen, und abends zu den Letzten, die ihre Schlafstelle aufsuchten. Und wenn der Mond hell genug schien, verbrachte er, in eine Wolldecke gehüllt, oft die ganze Nacht auf Deck, um nichts zu verpassen. Er liebte es, im Vorbeiziehen die Küsten und Inseln zu betrachten, und immer wieder beobachtete er fasziniert die vielen Tiere in Luft und Wasser, die in der Nähe von Land das Schiff lange begleiteten.
Im Golf von Mexiko erwartete sie stürmisches Wetter. Während mehrerer Tage lavierte die «Narragansett» in den Wellen, und der Kapitän bemühte sich, nicht zu weit nach Westen zu geraten, wo nach seinen Worten Gefahr bestand, auf eine Sandbank aufzulaufen. Als sich die See endlich beruhigte und das Wasser seine dunkle Farbe verlor, dauerte es nicht lange, bis sich ihnen ein kleines Lotsendampfboot näherte. Die Besatzung der «Narragansett» zog die Segel ein, befestigte ein dickes Tau an der «Black Star», und diese schleppte nun das grosse, dreimastige Segelschiff zur Mündung des Mississippi River. Dort kam ein Arzt an Bord, der die Gesundheitskontrolle vornahm. Auf der «Narragansett» musste er weder Kranke noch Tote registrieren, sondern konnte sogar einen zusätzlichen Passagier verzeichnen: Während der Umrundung der Ostspitze Kubas (Kap Antonio) war nämlich ein kleiner Antonio zur Welt gekommen, Sohn eines jungen Paares aus dem süddeutschen Baden. Somit hatte die Seereise nach 47 Tagen ein glückliches Ende gefunden, und nach einer weiteren Schleppfahrt mit der «Black Star» erreichten sie zwei Tage später den Hafen von New Orleans.93
Während fast alle Franzosen in New Orleans zurückblieben, hielten sich die Schweizer und Deutschen nur kurz in der Stadt auf, um sich dann an Bord des Dampfers «Meridian» zu begeben. Zehn Tage dauerte die Fahrt flussaufwärts bis nach St. Louis, Missouri. Um von hier nach Neu-Schweizerland zu gelangen, setzte man mit einer Fähre auf die Illinois-Seite des Mississippi über, danach blieben noch knapp dreissig Meilen94 zu Fuss oder mit einem privaten Fuhrwerk landeinwärts zu bewältigen. Reisende nach Highland warteten in St. Louis mit Vorteil im «Switzerland Boarding House», wo Farmer von Highland jeweils vorbeischauten, wenn sie ihre Produkte nach St. Louis brachten. Es dauerte denn auch nicht lange, bis zwei Schweizer aus der Siedlung erschienen und sich bereit erklärten, die neu eingetroffenen Landsleute und ihre schweren Koffer mitzunehmen.
Da sie die Strecke nach Highland in zwei Etappen zurücklegen wollten, machten sie gegen Abend Halt in einem Wäldchen. Sie bereiteten sich auf eine ungemütliche Nacht vor, denn im Wagen gab es keinen Platz zum Schlafen, der Erdboden war feucht, und es fing auch noch zu regnen an. Sie holten ihre Regenschirme hervor und versuchten, sich an einem Feuer zu wärmen, wobei einer der Farmer namens Buchmann einen Krug mit Whisky zirkulieren liess. Dann begann er von den Männern, Frauen und Kindern zu erzählen, die auf ihrer langen Reise über den amerikanischen Kontinent während Monaten noch viel härtere Strapazen auf sich nahmen, um im Fernen Westen eine neue Heimat zu suchen: «Er erzählte mir, wie die Emigranten über die Ebenen und Felsengebirge nach Oregon und Californien fünf bis sechs Monate lang mit Ochsen- und Mauleselfuhrwerken auskampieren müssten, wie sie sich mit Lebensmittel, Zelten, Gewehren und Waffen versahen, wie sie verschiedenen Indianern begegneten, von den Buffalos, Antilopen, Hirschen u.s.f. Er sagte, dass schon seid zwei bis drei Jahren im Frühjahr sich Leute in wo möglich grössern Gesellschaften zusammen fänden, und noch mehr verschiedene Einzelnheiten über jene geheimnissvollen Regionen.»95
Farmer Buchmann hätte sich keinen aufmerksameren Zuhörer wünschen können als Heinrich Lienhard. Das Wort»California» muss diesen wie ein Blitz getroffen haben, denn es liess ihn in den folgenden Jahren nicht mehr los. «Ich war also noch nicht an dem Endziele meiner Reise angekommen», erinnert er sich, «und doch empfand ich bereits Lust, vielleicht bald eben dieselbe Reise zu wagen.»96
Erste Jahre in Amerika: Illinois 1843–1846
Heinrich Lienhard und Jakob Aebli erreichten Neu-Schweizerland um den 20. November 1843 und wurden von Aeblis Verwandten, Familie Schneider, freundlich aufgenommen. Lienhard verbrachte zwei Wochen bei ihnen und benutzte die Zeit, um sich eine Arbeit zu suchen. Seine erste Stelle fand er bei einem Solothurner namens Mollet, der ihm als Lohn für den Anfang zwar nur Kost und Logis anbot, ihm später aber, wenn er sehe, dass Lienhard es verdiene, auch einen Lohn bezahlen wollte.97 Mollet arbeitete neben seinem Beruf als Wagenmacher auch als Zimmermann, und Lienhard freute sich auf die neue Herausforderung, zumal Mollets Frau Amerikanerin war und er deshalb hoffte, rasch mit der englischen Sprache vertraut zu werden.
Die kommenden Wochen erwiesen sich als schwieriger Anfang in der neuen Heimat. Der strenge Arbeitstag begann früh am Morgen, lange vor dem Frühstück, und hätte nach des Meisters Vorstellung bis abends um neun Uhr gedauert. Das Essen war eintönig und ungesund; es bestand aus «stark ausgebratenem und dabei sehr gesalzenem Speck, Kornbrod, ohne Salz und Fett bereitet, und dabei schlechten Weizencaffee mit allerhöchstens zehn Tropfen Milch auf die Tasse, so dass man kaum eine Verenderung der schwarzen Kaffeefarbe zu sehen vermochte.»98 Als Ersatz für Fett und Salz wurde das Maisbrot mit dem «ausgeschmolzenen Fett des verbratenen Specks» begossen.99 Diese Mahlzeit kam dreimal täglich an sieben Tagen pro Woche auf den Tisch, «so Regelmässig, als ob ein strenges Gesetz irgend etwas Anderes verböte».100
Lienhard bekam Magenschmerzen, fühlte sich schlecht behandelt, war unglücklich und enttäuscht. Nach zwei Monaten bei Mollet fand er, dass er nun zwar die «Schattenseite» von Neu-Schweizerland kenne, aber noch nichts von der «Sonnenseite» bemerkt habe.101 Als er den Meister eines Tages bei einer groben Tierquälerei beobachtete und vergeblich versuchte, ihn davon abzuhalten, verliess er dessen Haus für immer.
Die Monate Februar und März 1844 verbrachte Heinrich Lienhard bei Familie Leder102, mit deren Sohn Jacob er sich befreundet hatte. Der Vater, Johann (John) Leder, war als «Rigi-Leder» bekannt, da er am Nordhang eines «Rigi» genannten Hügels eine Farm besass. Hier fühlte sich Lienhard bald heimisch, umso mehr, als Vater Leder Klarinette und Trompete spielte und in seinem Haus am Abend oft musiziert und getanzt wurde.103 Allerdings arbeitete Lienhard auch bei Leders wieder ohne Lohn, und das bescheidene Vermögen, mit dem er nach Amerika aufgebrochen war, nahm langsam, aber stetig ab104: «Ich war jetzt nahe an zwei Monate bei Leders gewesen, und obschon ich mit den Leuten zufrieden war, sagte mir mein gesunder Verstand, dass ich auf diese Art nicht bestehen konnte. Bis dahin war ich Sonntags wie andere meiner Freunde dann und wann in das Wirthshaus gegangen und hatte auch ein paar Bällen beigewohnt, wobei ich immer etwas Geld brauchte, dagegen noch keines verdient hatte. Mit bedauren betrachtete ich da meine 20-Franken-Stücker, wenn ich eines davon aus meinem Gurt trennte, welchen ich immer am Körper trug. Ich kam mir fast als ein Vergeuder vor, und doch war ich eigentlich durchaus kein solcher.»105
Lienhard fand, dass (Salomon) Köpfli die Verhältnisse in der Siedlung «viel zu paradisisch»106 beschrieben habe und dass auch in den Briefen der Familie Schneider an ihre Verwandten zu Hause alles viel vorteilhafter dargestellt worden sei, als es sich in der Realität erweise. Es herrschte zwar kein Mangel an Lebensmitteln, doch zirkulierte sehr wenig Geld, so dass ein einfacher Farmgehilfe im günstigsten Fall mit einem Lohn von sechs bis sieben Dollar pro Monat rechnen konnte – und nicht selten fehlte den Farmern sogar noch diese kleine Summe Bargeld. Lienhard spielte zu dieser Zeit mit dem Gedanken, nach Le Havre zurückzukehren, Französisch zu lernen und dann nach Brasilien auszuwandern. Indessen sollten sich auch in Highland die Dinge bald zum Besseren wenden.
Nachdem er sich entschlossen hatte, nur noch bezahlte Arbeit anzunehmen, blieb ihm die Wahl zwischen den Brüdern Ambühl aus dem Kanton Graubünden107 und dem Berner Jakob Schütz108. Die Ambühls waren als «tüchtige, aber sehr hart arbeitende Farmer» bekannt, «welche viel Land besässen, für damahlige Zeiten gute Löhne bezahlten, aber auch bis in alle Nacht hinein Arbeiteten».109 Jakob Schütz, so hiess es, zahle zwar keinen grossen Lohn, dafür behandle er einen anständigen Arbeiter eher wie einen Sohn als einen Knecht, und «da das Wort ‹Knecht› auf mich ein widerlicher Eindruck machte und da ich in der Farmerei nämlich die Behandlung der Pferde, Pflügen etc. noch erst zu lernen hatte, entschloss ich mich sogleich, zuerst bei Schütz anzufragen.»110
Lienhard hatte Jakob Schütz bald nach seiner Ankunft in Neu-Schweizerland einmal getroffen, als er wie Schütz und andere Siedler zu gemeinnützigen Strassenarbeiten aufgeboten worden war.111 Man hatte ihm einen schweren Zweizollbohrer in die Hand gedrückt, mit dem er über längere Zeit arbeitete, dann aber ermüdete und begann, zwischendurch kurze Verschnaufpausen einzuschalten. Dem Strassenmeister Jacob Durer112, Wirt des Hotels Helvetia in Highland, missfiel dies offensichtlich, denn er forderte ihn jedesmal sogleich zum Weiterarbeiten auf. Dabei unterschätzte er aber das Temperament seines jungen Landsmannes: «Einige Mahl liess ich es mir gefallen», so Lienhard, «doch da ich fand, dass er mich zu seinem besondern Ziele auserlesen zu haben schien, erlaubte ich mir, ihm zu sagen, dass, wenn ihm meine Arbeit nicht genügend sei, werde ich ganz aufhören; dass ich mehr gethan habe als er selbst und so viel als irgend einer der Anwesenden [und] dass es mir vorkomme, man sei sehr hungrig, weil man Leute, welche kein Land besitzen und kaum angekommen seien, sogleich zu Straassenarbeiten auffordere.»113 Lienhards Ton schien Durer und seinem Kollegen Joseph Suppiger, einem Mitbegründer Neu-Schweizerlands, noch weniger zu gefallen; ein Wort gab das andere, und es entbrannte ein heftiger Streit, in dessen Verlauf Lienhard drauf und dran war, den grossen Bohrer hinzuwerfen.
In diesem Moment trat Jakob Schütz dazwischen: «Der kleine Mann, welcher bis dahin zugehört hatte, erhob sich nun ebenfalls, und ich glaubte, am Ende würde er auch noch gegen mich auftretten. Aber ich traute meinen Ohren kaum, als ich ihn sagen hörte, dass es ein rechter Unverstand sei zu verlangen, weil ich ein fetter junger Mann sei, dass ich mich nicht ein wenig ausruhen dürfe, nachdem ich bereits mit dem Zweizollborer so lange im Eichenholz gebohrt habe. Sie sollen es selbst einmal versuchen, damit werden sie bald genug ausfinden, ob sie ruhen möchten oder nicht. Auf die beiden grossmauligen Herren Squire114 Supiger und Helvetia Hotel Wirth Turer wirkten diese wenigen Worte des schlichten Farmers Jakob Schütz eigenthümlich beruhigend, denn sie hielten ihre Schimpfmäuler sogleich ruhig und hatten nachher durchaus nichts mehr gegen meine Arbeit einzuwenden. Was mich anbelangte, hätte ich den Schütz um den Hals fassen und Küssen mögen, weil er der Einzige war, der das Herz hatte, den grossmäuligen Herren die Wahrheit zu sagen. Natürlich fand dieser Mann ein warmer Platz in meinem Herzen. Ich ahnte aber damahls noch nicht, dass ich diesen Mann noch mehr lieb und werth schetzen lernen sollte.»115
Schütz erklärte sich einverstanden, Lienhard auf seiner Farm anzustellen. Als Lohn versprach er ihm viereinhalb Dollar im ersten Monat, danach, wenn er mit ihm zufrieden sei, fünf Dollar pro Monat. Sein Arbeitsbeginn wurde auf den 15. März 1844 festgesetzt, ein Tag, dem Lienhard mit Bangen entgegensah. Er hatte in den vergangenen Monaten ohne Lohn so viel gearbeitet, dass er sich nun fragte, was man künftig wohl für bezahlte Arbeit von ihm verlangen werde. «Am Abend des 14. Tag Merz fuhr mich mein Freund sammt meinem Gepäck hinüber zu Jakob Schütz. Während ich auf dem Wagen sass, regte sich in mir ein Gefühl, gleich als gienge ich nun dirreckt in die Sklaverei, und jedenfalls fühlte ich mich sehr erniedrigt.»116
Als er am nächsten Morgen erwachte, sprang er schnell aus dem Bett, denn obwohl es noch dunkel war, befürchtete er, verschlafen zu haben. Schütz, der im gleichen Raum schlief, erwachte und fragte ihn erstaunt, was er denn so früh anfangen wolle. «Ich antwortete, ich wolle das Vieh und die Pferde füttern, allein Schütz lachte darüber, hiess mich nur wieder zu Bette gehen, es sei Zeit genug zum Aufstehen mit dem Sonnenaufgang. Ich hätte nach dem wohl noch zwei volle Stunden schlafen dürfen, allein ich fürchtete, er möchte dann am Ende aufstehen und an die Arbeit gehen, während ich mich dann verschlafen könnte, daher zog ich vor, wach zu bleiben. Ich hatte mich jedoch in der Zukunft bald so gewöhnt, dass ich fast regelmässig mit Sonnenaufgang erwachte, und ich kann mich nicht erinnern, dass mir Schütz je zum Aufstehen gerufen hatte.»117
Mit Jakob Schütz hatte Heinrich Lienhard in Neu-Schweizerland das grosse Los gezogen. Sein Meister war ein verständnisvoller, freundlicher Mann Mitte fünfzig, der ihn, wie man es ihm vorausgesagt hatte, nicht nur gut, sondern wie ein Familienmitglied behandelte. Schütz war als guter Farmer bekannt und besass einige Meilen südwestlich der Stadt Highland eine eigene grosse Farm mit gutem Waldland. Er hatte diese aber, als Lienhard zu ihm kam, noch verpachtet und bewirtschaftete die sogenannte Ruef-Farm118 eine Meile westlich der Stadt Highland. Schütz fütterte und behandelte seine Tiere gut, weshalb sie zu den besseren der Gegend gehörten. Er kannte sich auch mit Tierkrankheiten aus, wurde oft von Farmern in den Stall gerufen und half immer, wenn es möglich war, obwohl ihn nicht alle dafür bezahlen konnten. «Der Charakter von Schütz war aufrichtig», schreibt Lienhard, «Personen, welche mit Lügen umgiengen, Schmeichler, Wucherer, Betrüger und hochmüthige, falsche Personen überhaupt, verachtete er. Armen, dürftigen Personen half er gern, soviel es seine Mittel ihm erlaubten, und wurde irgend Jemand von Andern Hart oder Ungerecht behandelt, konnte er sicher sein, in Schütz einen Beschützer und Freund zu finden.»119

Karte von «Highland oder Neu Schweizerland» und Umgebung von 1847 (Ausschnitt) mit den Namen der Siedler, unter anderen westlich der Stadt Ruefs Farm («Ruff»), die Jacob Schütz 1843 noch bewirtschaftete,
südwestlich davon dessen eigene Farm und im Südosten Seneca Gales Farm. Nördlich der Stadt die Farmen der Gebrüder Ambühl.
Schütz war seit einigen Jahren mit der verwitweten Tochter eines Schweizer Farmers verheiratet,120 eine Verbindung mit einer besonderen Geschichte. Die Frau hatte vier oder fünf Monate nach der Hochzeit eine Tochter geboren, worauf Schütz, der sich getäuscht und betrogen fühlte, sie aus dem Haus weisen wollte. Erst jetzt erfuhr er von ihr, dass sie vor der Heirat mit einem anderen, mittellosen jungen Mann verlobt gewesen sei und diesen auch habe heiraten wollen. Ihr Vater habe sie aber, obwohl er von ihrer Schwangerschaft gewusst habe, gezwungen, ihren Verlobten aufzugeben und stattdessen den wohlhabenden Schütz zu heiraten. Nachdem seine Frau ihm alles erzählt hatte, gab Schütz ihrem Bitten nach, und sie durfte mit dem Sohn Fritz aus erster Ehe bei ihm bleiben. Lienhard erinnert sich, dass Schütz und seine Frau zwar getrennt, aber doch unter einem Dach und in gutem Einvernehmen lebten. Die kleine Tochter Maria allerdings wurde bei einer anderen Familie untergebracht.
Als Schütz im März 1844 einmal am Haus jener Familie vorbeiritt, sah er das kleine Mädchen spielen. Er ging zu ihm hin, sprach einige Worte mit ihm, worauf Maria so spontan und freundlich reagierte, dass sie sein Herz offenbar im Sturm eroberte und er beschloss, die Kleine in seinem Haus aufzunehmen. Als Lienhard mit Jacob Leder Anfang März bei Schütz um Arbeit nachgefragt hatte, war Maria erst ein oder zwei Tage bei ihm, und das Bild, das sich ihm und Jacob damals bot, blieb ihm unvergesslich: «Wir fanden das Kind fast beständig an der Hand des alten Schütz, der ihre vielen Fragen kaum alle beantworten konnte. Aber er sah Glücklich aus, musste oft lachen und freute sich offenbar, endlich ein Kind gefunden zu haben. Gleich als ob das kleine Mädchen das Unrecht ihrer Mutter an Schütz wieder gutmachen wollte, war es überall bereit und zur Hand, ihrem väterlichen Wohlthäter behülflich zu sein, und zeigte nicht die geringste Scheu oder Furcht vor fremden Menschen, weder vor Pferden oder Vieh, so dass der Anblick dieses kleinen, lebhaften Wesens besonders geeignet war, das Antlitz des Vater Schütz aufzuheitern.»121 Nur den Schwiegervater, bemerkt Lienhard, habe er in Schütz’ Haus nie angetroffen.
Heinrich Lienhard lernte viel auf der Farm, sowohl im Umgang mit Pferden, was ihm später in Kalifornien zugute kam, als auch in der Landwirtschaft. Eine neue Arbeit erklärte ihm Schütz jeweils kurz und überliess ihn dann bald sich selbst. Im April 1844 gingen sie eines Morgens zusammen auf ein grosses Maisfeld, auf dem Lienhard die Maisstengel bereits abgehackt und zerkleinert hatte, und Schütz zeigte ihm nun, wie er mit Pferd und Pflug umzugehen habe, um das Feld noch zu pflügen. Nach ein paar Runden fand Schütz, Lienhard werde jetzt schon allein zurechtkommen, und liess ihn verdutzt allein zurück. Sein erster Impuls war, alles stehen zu lassen und Schütz ins Haus zu folgen; er entschied sich dann aber, vorher wenigstens eine Runde zu versuchen. «Ich lenkte meine Pferde so gut es eben gieng, und es gieng natürlich schlecht genug, da ich meinte, ich könne meine Augen nicht zu gleicher Zeit auf die Pferde und den Pflug halten. Zudem wurde der Pflug anfangs jeden Augenblick durch die vielen sich zusammenstauenden Maisstengel aus der Furche gehoben. Da gab es dann eine schöne Wülerei: Haufen [von] Maisstengeln mit Grund vermischt, der Pflug oft fast bis an den Baum im Grunde oder im nächsten Augenblick ganz aus Demselben, und die Furchen (wenn sie überhaupt diesen Namen verdienten) bald rechts, bald links aus der Richtung. Mit Schweiss förmlich bedekt, hatte ich endlich die erste Runde gemacht, und fast glaubte ich, schon eine geringe Verbesserung wahrzunehmen. Die Zweite Runde folgte, und jetzt war ich überzeugt, dass es bereits besser gieng. Mit jeder Runde wurden die Furchen besser, und mit jeder Besserung wuchs mein Eifer und schwand meine Verzagtheit, und noch ehe man mir mit dem Horn zum Mittagessen blies, war ich zu der Ansicht gekommen, dass ich wahrscheinlich ebenso gut pflügen könne als fast jeder Andere, und das Pflügen war mir bald mehr zum Vergnügen als zu einer anstrengenden Beschäftigung geworden.»122
Dank Schütz fühlte sich Lienhard nach einem halben Jahr richtig wohl in Neu-Schweizerland: «Der Monat April war sehr schön und Angenehm, und ich fühlte mich beim Pflügen mit meinen zwei vortrefflichen Pferden so glücklich, wie ein junger Mensch mit gutem Gewissen [und] voll Hoffnung für die Zukunft nur kann. Ich wetteiferte mit den Lerchen des Feldes im Singen und Pfeifen und pflügte dabei drauflos, dass es eine wahre Freude war. Selbst die Pferde schienen meine Stimmung zu theilen, die ganze Natur war voll fröhlichen Lebens.»123 Schütz erklärte ihm eines Tages, dass er seine Pferde nicht so streng brauchen dürfe und dass die Tiere mittags wenigstens eine Stunde mehr Ruhezeit brauchten. Er solle nachmittags deshalb nicht vor zwei oder drei Uhr an die Arbeit zurückgehen. Erstaunt fragte ihn Lienhard, was er denn in der Zwischenzeit arbeiten solle, worauf Schütz lachend erwiderte, er könne tun, was ihm gefalle, nur zu arbeiten brauche er nicht.
Zu Beginn der Sommermonate begann in Highland regelmässig die gefürchtete Fieberzeit. Das Wechselfieber, eine Art von Malaria, war «eins der grössten Übel, die die Einwanderer zu ertragen hatten»,124 und es forderte Jahr für Jahr zahlreiche Todesopfer. Lienhard lernte das Fieber bereits im ersten Sommer in all seinen Varianten kennen. Über Tage und Wochen wechselten sich heftige Fieberschübe mit nicht minder heftigen Schüttelfrösten ab, und die starken Kopfschmerzen trieben ihn fast zur Verzweiflung. Fühlte er sich zwischendurch etwas besser, liess der nächste Rückfall bestimmt nicht lange auf sich warten. Es dauerte fast drei Monate, bis er wieder ganz gesund war. Schütz und seine Frau pflegten ihn über die ganze Zeit, weshalb er für die Sommermonate keinen Lohn annahm.