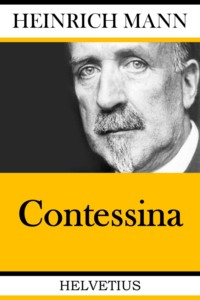Kitabı oku: «Contessina»
Contessina
1 Contessina
Contessina
An der Hand ihrer Bonne geht Contessina langsam, mit kleinen mühsamen Schritten durch den von der Frühlingssonne gelockerten Strandsand. Auf dem weißgekrönten Meerblau, inmitten eines fast harten Glanzes zeichnet sich die schmächtige Silhouette des kleinen Mädchens ab, mit ihren schüchternen kurzen Bewegungen.
Ihr Haar sonnt sich, ein goldner Mantel, zu schwer für die schmalen Schultern, in dem mächtigeren Gold des Lichtes, aber ihre Augen vermögen den Glanz nicht auszuhalten. Contessina läßt den Blick über die Berge, jenseits des Pinienwaldes, weit dahinten zu ihrer Rechten, schweifen, wo die Blendung der schon gegen Mittag steigenden Sonne weniger stark ist. Im Weiterwandern schaut sie in versteckte Täler, in schmale Hohlwege hinein, deren lauschende grüne Stille von dem mattsilbernen Band eines kleinen Kanals durchzogen wird. Doch in Contessinas große dunkle Augen tritt nichts von der Stimmung der Landschaft ein, auf der sie ruhen, so wenig von ihrem innigen Schweigen wie von ihrem lauten Glanze. Ohne gerade traurig zu sein, sind sie ein wenig teilnahmslos, die Augen des kleinen Mädchens, für ein Alter, in dem auch der unbedeutendste Gegenstand ein ganz frisches Interesse erregt.
Das Kind läßt die muntere Französin plaudern, ohne sich durch die Unterhaltung ermüdet oder angeregt zu zeigen, ohne eine Frage zu stellen oder um eine Erklärung zu bitten. Sie kommen einmal an einem Trupp Fischer vorbei, die mit dem Einziehen der Netze beschäftigt sind, meist alte Leute mit eingetrockneten Gesichtern, gesträubten grauen Bärten, in zerlumpter, bunter Kleidung. Die Weiber sitzen weiter oben am Strande im Kreise, die Knie aneinandergeschoben und die Hände darum hergelegt. Von weitem sind ihre lauten harten Stimmen vernehmlich. Nachdem sie zwischen den beiden Gruppen hindurchgeschritten ist, von links den stummen Gruß eines alten Mannes, von rechts den Zuruf eines Weibes: »Gott segne unsere Contessina!« erhalten hat, stellt die Kleine, ein Stückchen weiter, die erste Frage an ihre Begleiterin, und ihre Stimme, die seltsam klangvoll aus dem schwächlichen Körper kommt, zittert leicht, fast ängstlich:
»Sind das denn auch Menschen?« fragt sie.
Die Bonne lacht lustig auf.
»Aber Contessina!«
Da der Mistral, der gegen Mittag aufkommt, sich bemerkbar macht, überschreiten die beiden eine kleine Brücke, waten quer zwischen den gebleichten, verwehten Dünen hindurch, und dann sind sie in der Pineta. Auf dem festen Waldwege wird Contessinas Schritt sicherer, im Schatten der hohen, geraden Stämme ihre Stimme fester, und sie plaudert ein wenig. Was man heute nachmittag beginnen werde, ob Mama gut geruht habe? – Oh, sie weiß, wieviel für sie selbst an Mamas gutem Schlafe liegt.
Der Fußweg verbreitert sich, nun läuft eine herrschaftliche Fahrstraße daneben her, und schon tritt das Schloß zwischen den Bäumen hervor. Das niedrige, graue, weitflügelige Gebäude liegt dort, vornehm zurückgezogen, im Grunde seines ungeheuren Parkes eingeschlafen – seit wie lange? Contessina weiß es. Es ist so still, und die grünen Jalousien der Vorderseite haben sich fast nie mehr geöffnet, seit Papa gestorben ist. Und dies war sehr bald, nachdem sie selbst zur Welt gekommen. Er ist gestorben, und obwohl alle ihn entschwinden gesehen haben, weiß doch niemand, auch Mama nicht, recht zu sagen, auf welchem Wege er das Leben verlassen. Er ist so dahingegangen. Seither hat Mama niemand mehr sehen wollen und sich mit seinen Bildern eingeschlossen. In jedem Zimmer befindet sich eines davon, und es hängt ein Teppich von der Staffelei, und es steht ein Schemel davor, fast als ob es ein Betschemel wäre.
Die arme Mama ist oft krank, so daß Contessina sie nicht sehen kann, heute aber ist es ein gutes Zeichen, daß sie schon aus der Loggia der Gartenseite herabgrüßt. Die Kleine wird zu ihr geführt und empfängt eine stürmische, zitternde Umarmung. »Meine Elena! Meine Elena!« Jedesmal mit dem leidenschaftlichen Ton, als ob sie das Kind schon sich entrissen geglaubt hätte.
Dann streckt Mama sich auf der Ottomane aus, breitet ihr dunkles Kleid über die matten Farben des Teppichs und legt die Arme wieder um das Kind, das auf einem Kissen an ihrer Seite sitzt. So bleiben sie, regungslos aneinandergeschmiegt, dem großen Bilde eines bleichen hohen Mannes gegenüber, der, obwohl sie noch da sind, der Letzte war. Die Mutter, aus dem gleichen Geschlechte, und Contessina, sie sind nur wie der Nachhall des letzten Akkordes von einem alten Liede, das nun beendet ist.
Die Mutter beginnt zu erzählen mit ihrer bald heftig und hastig flüsternden, bald langgezogenen und eintönigen Stimme. Sie erzählt von ihrem Leben mit dem Papa; wie damals das Haus voll Licht und Menschen gewesen jeden Sommer, und wie sie mit ihm allein weit aufs Meer hinausgefahren. Aber im Winter haben sie in einer großen Stadt, die Florenz heißt, gelebt, wo viele Paläste nebeneinander stehen, in denen es jeden Abend Licht und Menschen gibt und vor denen das Equipagenrasseln nicht aufhört.
Im Halbdunkel des weiten Gemaches, weit in die Arme der Mutter gelehnt, läßt Contessina sich einlullen von den Erzählungen, die wie Märchen klingen. Aber in das behagliche Dämmern ihrer kleinen Kindergedanken schleicht sich, unmerklich und unverstanden, die Ahnung, daß sie selbst das alles, wovon sie hört, nie, nie erleben und besitzen werde. Und doch ist dies eine Ahnung, die Kindern heim Anhören von Märchen nicht zu kommen pflegt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.