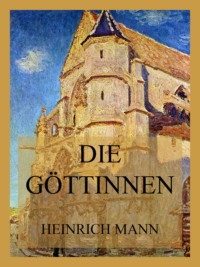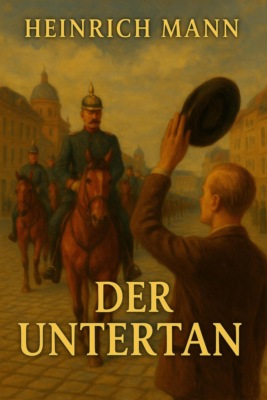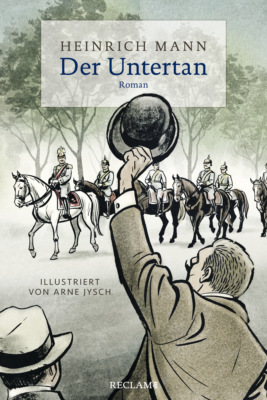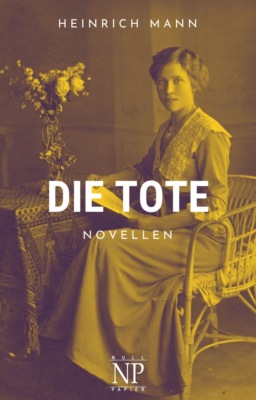Kitabı oku: «Die Göttinnen», sayfa 7
IV
Die Einwohner von Palestrina liefen hinunter auf die alte Straße, die ihre Bergstadt mit Rom verbindet. Es trieb sie an, von weitem auszuschauen nach dem Kardinal. Endlich sollte er Besitz ergreifen von dieser suburbanen Diözese, die der neue Papst ihm verliehen hatte. Er trug einen deutschen Namen, den keiner behalten konnte.
Der schwarze Wagen rollte schwerfällig herbei; aus den Gärten, den Abhang hinauf, winkten ihm Tücher und grüßten ihn Kränze. Er schlich, vom Volke umringt, das Hoch schrie, mühsam den steilen Platanengang hinan, und er rasselte auf den geschmückten Platz. Böllerschüsse krachten; da sah man einen noch jungen Mann aussteigen. Wo war sein rotes Käppchen und wo die Scharlachstreifen an seinem Kleide? Die Gemeinde schwieg enttäuscht. Aber sie wartete auf Feuerwerk, Konzert und Lotto. Darum fand sie sich darein, dass statt des Kardinals nur sein Vikar erschienen war, der Monsignor Tamburini.
Sie geleiteten ihn durch die engen Treppengassen hinauf zu den Kapuzinern, bei denen er übernachtete. Am nächsten Morgen besuchte er, auf Schritt und Tritt von schmetternder Musik begleitet, das Nonnenkloster. Die Oberin empfing ihn in dem kühlen Hofe, wo von den arabischen Säulchen junge Rosen hingen. Nach der Begrüßung schob sie die Gartenpforte zurück und lud den Vikar in die Vigne. Unter dem schweren Blau des Augusthimmels woben die Weinblätter ihren schwanken Schatten über einen schmalen Felsgrat hin. Am Ende des Weges, wo jäh die Wand abfiel, stand ein Marmortisch, und es saß eine Dame davor, das Gesicht auf die Landschaft gerichtet. Sie sah rechts aus einem Gewoge blauer Kuppen den Soracte emporsteigen. Geradeaus dämmerte ein Wall von grauem Duft, näher und entfernter, den Horizont entlang: Albaner- und Volskergebirg. In der Lücke zwischen ihnen glitzerte weiß eine Ahnung des Meeres. Die braune Campagna dehnte sich in sommerlicher Verlassenheit, fieberglühend bis in jene Ferne.
Der Vikar flüsterte neugierig:
"Wen habt Ihr dort, eine Dame?"
"Sie ist es eben," erwiderte die Oberin, "wegen derer ich Monsignor hierher führe. Sie ist uns eines Abends ins Haus geschneit, und geht nicht mehr fort. Was sollen wir tun?"
"Zahlt sie?"
"Sehr gut."
"Wie heißt sie?"
"Sie hat einen Namen genannt, den sie später selbst wieder vergessen hatte. Ich möchte schwören, dass es nicht der ihrige war."
Monsignor Tamburini lächelte.
"Ein Roman? Was Ihr für ein Glück habt, hochwürdige Mutter. Bekommt sie Briefe?"
"Einmal war am Tore ein Mann aus Rom und brachte ein Paket Wäsche. Ich habe es untersucht, es war Geld darin, aber nichts Schriftliches. Es ist alles sehr geheimnisvoll und fast ängstlich."
"Wir werden sehen," sagte selbstbewusst der Vikar. Er raffte seine Soutane über die Füße hinauf, dass die violetten Strümpfe zum Vorschein kamen, und durchmaß mit großen Schritten, sich kräftig räuspernd, die Vigne. Die Fremde wandte sich nach ihm um und dankte ihm für seinen Gruß. Ihre Züge dünkten ihm eigentümlich bekannt. Er stellte sich vor und fragte:
"Nicht wahr, gnädige Frau, der Anblick dieses Landes fesselt uns wochenlang."
Die Dame versetzte:
"Es ist schön, aber ich bin nicht deswegen hier. Ich bin die Herzogin von Assy."
Er fuhr zusammen.
"Ich hätte es fast erraten!" stotterte er. "Man kennt ja Euere Hoheit aus den illustrierten Blättern!"
Indessen er sie anstarrte, dachte er: "Die Oberin, das furchtsame Gänschen, hat also recht, wir erleben Abenteuer". Er sammelte sich.
"Welch seltsames Zusammentreffen! Hier im weltfernen Klostergarten finde ich die hohe Frau, die Heldin und die Märtyrerin, deren großartigem Kampf für eine heilige Sache wir alle voll atemloser Angst gefolgt sind…!"
Er redete mit eherner Stimme, seine mächtigen Hände griffen aus. Er hatte die niedrige, durch eine Haarsträhne geteilte Stirn, die kurze, gerade Nase und das starke Untergesicht des Römers, und stand bieder und massig vor sie hingepflanzt; doch unter ihren schweren Lidern prüften seine kleinen Augen sie, beweglich und tiefschwarz. Die Herzogin lächelte.
"Heldin — kaum. Märtyrerin — ich weiß nicht. Jedenfalls keine besonders tapfere, da ich mich hier verkrochen habe. Aber, glauben Sie mir, Monsignore, die Langeweile verleiht Mut. Bevor Sie kamen, hatte ich gerade fünfmal gegähnt, und kaum erblickte ich Sie, war ich entschlossen, mich Ihnen zu erkennen zu geben."
"Sie haben Furcht gehabt … vor…?"
"Ganz recht. Vor der Auslieferung."
Er hatte sich nicht denken können, was sie fürchtete. Sie hielt sich also für verfolgt? Wie unnötig! Die Machthaber in ihrem Lande waren gewiss sehr froh, sie los zu sein. Seither war es dort beinahe still geworden, wusste sie das nicht? Er öffnete den Mund, um es ihr zu sagen, schwieg aber und wiegte den Kopf. Wenn sie Furcht hatte, warum wollte er sie ihr nehmen? Aus der Furcht eines andern ließ sich immer irgendein Vorteil ziehen. Er sagte fett und überzeugt: "Hoheit, ich verstehe das."
Er hatte nachgedacht und belebte sich.
"Die jetzige räuberische Regierung Italiens ist stets zu jeder Schandtat bereit. Die Tyrannen Ihres Heimatlandes brauchen bloß in Rom den Wunsch zu äußern, und Sie, Frau Herzogin, werden schonungslos ausgeliefert."
"Sie glauben?"
"Da gibt's keinen Zweifel. Solange Sie allein und schutzlos sind, heißt das."
"Wer sollte mich schützen?"
"Das kann nur…"
"Wer?"
"Die Kirche!"
"Die Kirche?"
Er ließ sie nachdenken.
"Warum nicht," äußerte sie schließlich.
"Vertrauen Sie sich der Kirche an, Frau Herzogin! Die Kirche vermag mehr, als Sie ahnen. Was ohne sie fehlgeschlagen ist, vielleicht — vielleicht gelänge es mit ihrem Beistande!"
Sie überhörte seine gedämpfte Andeutung.
"Ich könnte dann in Rom frei umhergehen?" fragte sie.
"Frei und sicher, ich bürge dafür."
"Nun dann — meinetwegen. Und rasch, Monsignor, rasch! Sie sehen, ich langweile mich."
"Sofort, Frau Herzogin. Heute Abend, nach Beendigung des hiesigen Festes. Ich hole Euere Hoheit in meinem Wagen ab."
Er verabschiedete sich mit geistlichem Anstande. Draußen erwartete ihn das Orchester. Unter Marschgebläse gelangte er zum Dom und zelebrierte das Hochamt. Am Abend, als vom Stadtplatz zum stahlblauen Sternenhimmel Raketen schossen, hielt sein Wagen an der Klosterpforte. Sie öffnete sich halb, die Herzogin bestieg das Gefährt. Sie reichte der knicksenden Oberin die Hand, das Gesicht der Alten ruhte elfenbeinfarben im Frieden ihrer weißleinenen Flügelhaube. Hinter den kleinen Öffnungen in der kahlen gotischen Fassade spähten die müden Augen junger Nonnen.
Der Vikar erreichte mit seiner unverhofften Begleiterin auf einem Seitenwege die Campagna. Die Pferde mussten laufen; um elf Uhr waren sie beim Tor, kurz darauf auf dem Monte Celio. Dort stand das kleine Haus eines Prälaten, der plötzlich nach dem Orient entsandt war. Es war vollständig möbliert zu vermieten. Die Herzogin übernachtete darin. Am Morgen war sie entschlossen, dazubleiben.
Das Häuschen lag auf dem Rücken des verlassensten der römischen Hügel, in der Tiefe eines verwilderten Gartens. Davor, auf dem von zerbröckelnden Mauern eingehegten, ungepflasterten Platze sonnte sich die Navicella, das bemooste, geborstene Brunnenbecken in Schiffsgestalt. Es träumte von Tagen, als drüben Trinitarierritter klirrend auf die Schwelle ihres Hauses traten. Noch erhob sich über der verschlossenen Tür das Sinnbild des Ordens, ein weißer und ein Mohrensklave, die zur Rechten und zur Linken des segnenden Christus von ihrer Befreiung zeugten. Aber die Front ragte vor zusammengesunkenen Wänden ins Leere. Das Geräusch weniger Schritte verirrte sich an den Ort. Vom Kloster der heiligen Johannes und Paulus her schlürften manchmal durch den Bogen des Kaisers Dolabella die Sandalen eines Mönches.
Seitwärts unter ihrem überspringenden Dache hatte die weiße Villetta der Herzogin einen Pfeilergang. Von dort erblickte sie, eingerahmt von den beiden Zypressen, die an ihrem Gartengitter sich zueinander neigten, das Kolosseum und das Trümmerfeld des Forums.
Im Innern klapperten die Absätze auf roten Fliesen. Die Zimmer waren dunkel tapeziert oder geweißt. Die Möbel luden durch Formen und Stellungen zum Meditieren ein oder zum Beten. Etwas Sachtes und leicht Dumpfiges hing wie unsichtbare Spinnengewebe in allen Räumen; es glich einer Erinnerung an alte Bücher, schwarze, behutsam gleitende Gewänder und längst abgestandenen Weihrauch. Die Herzogin dachte an Monsieur Henry, ihren spottsüchtigen Lehrer.
"Ich will ihm doch schreiben, wohin ich nun geraten bin."
Sie benachrichtigte Pavic. Er stellte sich alsbald ein und brachte San Bacco mit. Der Freiheitskämpfer ging feierlich auf sie zu; sein Gehrock war über den Hüften zusammengeschnürt und stand oben offen. Blitzenden Auges sagte er:
"Willkommen, Herzogin, im Exil!"
"Marquis, ich danke Ihnen!" erwiderte sie, mit leiser Parodie seines tragischen Tonfalls.
Pavic trat vor.
"Euere Hoheit taten einen folgenschweren Schritt, als Sie, ohne den Rat Ihrer Freunde einzuholen, Ihr sicheres Asyl verließen."
Sie hob die Schultern.
"Lieber Doktor, haben Sie sich denn eingebildet, ich würde mein Leben im Kloster beschließen?"
"Wir hofften, Sie würden Geduld haben, nur noch eine Weile. Man arbeitete für Sie."
"Wir arbeiteten für Sie," wiederholte San Bacco. Die Herzogin meinte:
"Gut. Arbeiten wir also gemeinsam! Und unterhalten wir uns nebenbei. Rom macht mir einen fast närrisch lustigen Eindruck."
Sie wies durch das Fenster auf den schwermütigen Platz. Pavic rang die Hände.
"Ich beschwöre Sie, Frau Herzogin, setzen Sie keinen Fuß hinaus! Bei Ihrem ersten Erscheinen verhaftet man Sie!"
"Verhaften? Ah! Meine Herren, es ist Ihnen noch unbekannt, welchen mächtigen Schutz ich genieße."
"Einen … Schutz?" fragte Pavic mit hörbarer Enttäuschung.
"Den Schutz unserer heiligsten Mutter, der Kirche."
Sie lächelte und bekreuzte sich. Pavic ahmte hastig ihre Gebärde nach, er bat die Sünde ihres Hohns in Gedanken ab.
"Nun schweigen Sie?"
San Bacco schritt aufgeregt durch das Zimmer. Er rief in der Fistel:
"Ich ehre die Kirche, als Christ, als Demokrat und als Edelmann. Aber wo ihre Tätigkeit beginnt, da endet die des Soldaten. In meiner Vorstellung, Herzogin, erscheint der Priester erst am Sterbebett des Helden!"
"Marquis, Sie haben vollkommen recht, bis auf eine Kleinigkeit: ich bin kein Held."
Sie stellte sich vor ihn hin und sah ihm in die Augen.
"Sie überschätzen mich, mein Lieber, ich bin schwach. Die Langeweile hat mich schwach gemacht. Ein starker, gewandter Priester lief mir in den Weg, ein Vikar des Kardinals Grafen Burnsheimb, und ich bin ihm hierher gefolgt. Was wollen Sie, Marquis, ich bin erst fünfundzwanzig! Man muss nicht zu viel von mir verlangen. Ich habe Freunde in Rom, die mich über mein Unglück trösten werden. Monsignor Tamburini erzählt mir, dass die Prinzessin Laetitia hier ist. Ich kenne sie seit Paris und will sie aufsuchen. Meinen Sie, dass die Fuchsjagden im Oktober ohne mich stattfinden sollen?"
San Bacco schüttelte den Kopf.
"Sie stellen sich frivol, Herzogin! Inmitten der leichtfertigen Festlichkeiten in Zara waren Sie von historischer Größe … jawohl, von historischer Größe! Und jetzt, unter der Last eines pathetischen Verhängnisses, kokettieren Sie mit Oberflächlichkeit. Sie lieben das Bizarre, Herzogin, — und es steht Ihnen."
"Aber Ihnen steht das Geistreiche gar nicht. Seien Sie gut!"
Sie bot ihm die Hand.
"Ich muss eine Menge Einkäufe machen. Sie sehen, wie es hier kahl ist. Kommen Sie, begleiten Sie mich. Nicht wahr, Sie schenken mir ein paar Stunden?"
Er murmelte:
"Ein paar Stunden? Ich gehöre Ihnen ja ganz."
Er beugte sich über ihre Finger. Sein rotes Kinnbärtchen zitterte.
Hinter ihnen stand Pavic, betreten und mit einem bitteren Geschmack auf der Junge. Die Herzogin wandte sich um.
"Und Sie, Herr Doktor, sind Sie versöhnt?"
Pavic stammelte:
"Bin ich nicht Ihr Diener? Frau Herzogin, Ihr Diener, wie es auch kommen mag. Ich hatte mir's anders gedacht. Sie sind in Gefahr, Sie fürchteten sich, ich wollte Sie decken mit meiner Brust…"
Da sie den Mund verzog, verwirrte er sich vollständig.
"Auch ich selbst fürchtete mich, es ist ja wahr … Genug, jetzt schützen Sie stärkere Hände. Ich als einfaches Slawenherz war stets ein gläubiger Sohn der Kirche…"
"Dann ist also alles in Ordnung. Ich höre den Wagen des Kardinals. Gehen wir."
Sie setzte sich den Hut auf.
"Das Kammermädchen, das man mir geschickt hat, versteht nicht viel. Es ist ein Verbannungs-Kammermädchen."
San Bacco suchte in allen Zimmern nach ihrem Sonnenschirm. Dann stiegen sie ein. Vor einer der Ladentüren, wo sie auf ihre Dame warteten, sagte der Garibaldianer zu dem Tribunen:
"Ich bewundere diese Frau, denn sie hat mich enttäuscht. Ich kam und meinte Vernunft predigen zu müssen. Sie konnte verbittert sein, nicht wahr, oder kindisch ratlos, oder empört. Nein, durchaus nicht; sie scherzt. Sie hat die kraftvolle Leichtigkeit dessen, der seiner Sache gewiss ist. Diese Frau ist groß!"
Pavic murrte.
"Groß, hm, groß, — ich sage nicht nein. Es gibt eine passive Größe. Manche sterben lustig. So ein Aristokrat, der sich guillotinieren ließ, weil irgendeine Liebesgeschichte ihn vom rechtzeitigen Überschreiten der Grenze abhielt, ich halte ihn für eine lächerliche Figur, schon darum, weil er zwecklos ist."
"Mein Herr! Sie vergessen, zu wem Sie das sagen!"
San Bacco richtete sich stolz auf. Aber Pavic versetzte ruhig.
"Sie, Herr Marquis, den ich so hoch verehre, sind ein Mann der Freiheit."
Und der Mann der zwei Seelen, der San Bacco hieß, wusste nichts zu entgegnen. Der andere sprach weiter.
"Der aber, an dessen Leben eine große Sache hängt, ist zu kostbar; er darf nicht sterben irgendeiner Chimäre zu Gefallen, und trüge sie den klingendsten Namen. Sollte ich, der ich meinem Volke viel bin, zusehen müssen, wie auf Barrikaden Blut fließt? Muss ich mich statt eines Bauern spießen lassen?"
San Bacco verstand nicht, er schwieg, und Pavic verbiss sich stumm in seine Idee. Sie hielt ihn besessen bei Tage und bei Nacht. Kaum vom Schlummer erwacht, begann er der Herzogin, als ob sie vor ihm stände, die Gründe vorzuhalten, weshalb das Opfer seines Lebens, das sie verlangt hatte, töricht und verderblich gewesen wäre. Er saß dann im Bett und redete mit dem Mute, den er vor ihrem Angesicht nicht fand, auf sie ein, schallend laut, mit starken Gesten und schließlich ganz erbittert. Er warf ihr seine Nachtwachen vor, seine Heimatslosigkeit und sein gebrochenes Dasein, ja, auch den Tod seines Kindes. In seiner Überreiztheit glaubte er oft, sie habe den Knaben gefordert statt seiner selbst.
"Und nach so vielen Opfern..!"
Er vollendete sich den Gedanken niemals, aber sein Gefühl überzeugte ihn, dass sie für so viele Opfer sich ihm hätte geben müssen. Und nie mehr würde sie es tun, er wusste es! Er hatte sie, in einer Stunde, da er über die Ratlose verfügen durfte, nach der grauen Bergstadt und ins Kloster gebracht. Die Gefahr hatte er übertrieben, ihr und sich selbst. Einsamkeit, Ernüchterung und Furcht sollten an ihrer Seele arbeiten, sie demütig, zahm und mitleidig machen. Nun war sie ihm aus der Hand entschlüpft, ein bunter Vogel, der hoch über ihm auf einem schmalen Zweige saß und zwitscherte, unüberwindlich frei und hochmütig. Pavic verzweifelte. Was konnte er noch tun, um in ihrem Gedächtnisse jene Stunde auszulöschen, da er nicht gestorben war. Er irrte umher und suchte.
Nach Beendigung ihrer Einkäufe sagte die Herzogin:
"Morgen Abend sehen wir uns beim Kardinal, Sie sind eingeladen, meine Herren."
Zur bestimmten Zeit trafen sich die beiden in der Lungara, der zwischen Palästen still dahinziehenden Straße jenseits des Tiber. Sie erstiegen gemeinsam die breite flache Treppe im Hause des Kirchenfürsten. Hinter einem schwarzgekleideten Diener, der fromm geneigten Hauptes einen Armleuchter vor ihnen hertrug, durchmaßen sie eine Reihe von Sälen mit verschlossenen Fensterläden. Das Kerzenlicht riss Lücken in das Dunkel, es enthüllte ein Stück Deckengemälde: große kalte Leiber, berechnete Haltungen und wohlgeordnete Faltenwürfe erstarrten in einem öden Pomp; es streifte verblasstes Gold an weit voneinander getrennten Stühlen, von denen brokatene Fetzen fielen. Dann öffneten sich den Besuchern einige kleinere Gemächer, von Schaukästen eingenommen, auf denen ausgestopfte Vögel mit gewundenen Hälsen, gespreiztem Gefieder, aufgesperrten Schnäbeln sich in der Dämmerung bauchten zu seltsamen Gestalten. Im Bibliothekszimmer stand ein junger Abbate vom Studium auf, verbeugte sich und kehrte zu seinem Schreibzeuge zurück.
Endlich gelangten sie in das Kabinett des Hausherrn. San Bacco, der ihm bekannt war, nannte ihm Pavics Namen; darauf stellte er sie beide den vier Damen vor, die um die Herzogin von Assy herumsaßen, einer sehr fetten und überaus lebhaften Greisin, der Fürstin Cucuru, sowie ihren zwei schönen blonden Töchtern, und der Contessa Blà, einer noch jungen Frau. Monsignor Tamburini hielt sich, ein pflichtstrenger Adjutant, im Rücken des Kardinals. Graf Burnsheimb lehnte klein, schmächtig und leicht gebeugt, im schwarzen, rot umsäumten Gewande und das rote Käppchen auf dem dünnen weißen Haar, an einem hohen roten Ledersessel. Seine weiße magere Hand ruhte ungekrümmt und lebensvoll auf der gelben Marmorplatte seines Arbeitstisches. Es erhob sich darauf zwischen gehäuften Büchern eine römische Ampel, drei bronzene Schnabelbecken an einem langen Stiel. Sie erhellte von unten das versteckte, feine Lächeln des Kardinals. Er wandte das schmale blasse Gesicht den Damen zu, einer nach der andern, und lud mit kühler langsamer Stimme seine Gäste ein, ihm in die Galerie zu folgen.
Tamburini schob in der Wand eine Kulisse zurück, sie betraten die lange, ansehnlich breite Wandelhalle, die durch drei Maschinen auf den Garten hinaussah. Er drängte sich hier in der Höhe des ersten Stockwerks, eng und abgezirkelt, an den Abhang des Janiculushügels. Noch hing etwas rosiger Staub, von der Sonne zurückgelassen, in den Taxusmauern. Sie umgaben quadratisch zwei dreieckige Wasserbecken, auf deren niedrigen Einfassungen zwei Tritonen sich räkelten und zwei Faune.
An beiden Enden der Galerie befand sich eine verschlossene Pforte, überdacht und umflutet von Vorhängen aus grünem Marmor. Aus den mächtig geschwungenen Steinwellen traten zwei weiße, nackte Figuren, ein Knabe hüben, und drüben ein Mädchen. Sie lächelten und legten einen Finger auf den Mund. Die ganze Länge des Raumes trennte sie; zaghaft setzten sie den Fuß an, als wollten sie einander entgegengehen über den spiegelnden Mosaikboden, worauf blaue Pfaue, umkränzt von Rosen, die goldigen Schweife aufrollten. Statt ihrer humpelte die Fürstin Cucuru darüber hin. Sie bot, sobald sie auf den Füßen war, einen überraschenden Anblick. Ihre lahmen Kniee machten sie ungeduldig, sie bestrebte sich ihnen vorauszueilen, mit angelnden Armen und leidenschaftlich stampfendem Krückstock. Sie beugte sich, fast zusammenbrechend unter der Last ihres Fettes, soweit nach vorn, dass der untere Teil ihres Rückens die Schultern überragte. Dadurch ward hinten das Kleid aufgerafft und enthüllte die geschwollenen Beine der Greisin. Ihr ägyptisches Profil, mit platter, auf der Oberlippe fest anliegender Nase, schoss vor sich her den bekümmerten Blick eines die Beute versäumenden Raubvogels. Sie blieb hinter der Gesellschaft zurück und schrie mit gieriger Lockstimme abwechselnd "Lilian!" und "Vinon!"; aber die Hilfe ihrer Töchter verbat sie sich wütend.
Atemlos und hochrot fiel sie schließlich in einen Fauteuil bei der geöffneten Gartentür. Daneben schob der Kardinal eigenhändig einen zweiten Sitz für die Herzogin. Die Cucuru rief:
"Nehmen Sie dreist allen Platz, Herzogin! Sie brauchen Kühlung, Sie sind zart. Ich, ich habe überhaupt keine Luft nötig, ich habe eine Gesundheit und eine Kraft! Vierundsechzig bin ich, hören Sie, vierundsechzig, und werde noch hundert werden! Mit Seiner Hilfe!"
Sie schielte nach oben und murmelte, sich bekreuzigend, etwas Unverständliches.
"Ja, ja, Anton," so wandte sie sich, noch lauter, an den Kardinal, "Ihr seid natürlich recht froh, dass Ihr die da im Hause habt!"
Und sie klopfte mit dem Horngriff ihres Stockes die Herzogin kräftig auf den Arm. Der Kardinal sagte: "Genießen Sie unsere Abendkühle, liebe Tochter, hier am Janiculus ist sie zuträglich, und trösten Sie sich, wenn es möglich ist, über die Bitternisse des Exils!"
"Papperlapapp!" machte die Cucuru, "Freund, was redet Ihr von Exil! Die Frau ist jung, sie kann tätig sein und leben, leben, leben! Geld hat sie, sie weiß kaum wieviel, und Geld, Freund Anton, ist die Hauptsache!"
"Monsignor Tamburini bestätigte dies mit einem fetten "So ist es!" Die Contessa Blà erkundigte sich:
"Hoheit, nehmen Sie Ihr Missgeschick schwer?"
"Ich weiß nicht," erklärte lächelnd die Herzogin, "ich habe mich bisher nicht genau untersucht. Augenblicklich ist es mir gleich, der Garten duftet so frisch."
Die Blà nickte und schwieg. Aber Pavic, der noch nichts gesagt hatte, lieh sich vernehmen. Die schleichende Rachsucht, die seine Begierde, der Herzogin von Assy zu Füßen zu liegen, jetzt manchmal verdrängte, stieg ihm plötzlich zu Kopf. Seine Stirn war gerötet, er sagte leidselig und dem Auge der Herzogin ausweichend:
"Eine Unheilsbotschaft; ich weiß nicht, wie ich sie länger zurückhalten soll. Den Assyschen Besitzungen in Dalmatien droht die Konfiskation. Der Staat steht im Begriffe sie einzuziehen. Zu dieser Stunde ist es vielleicht schon geschehen."
Der Kardinal fragte ruhig:
"Sie wissen es im Voraus?"
"Hier ist der Brief meines Vertrauensmannes."
Pavic trat zurück, befriedigt und dennoch von Schmerz zerrissen.
Der Kardinal las und reichte das Papier der Herzogin. Dann griff die Cucuru danach. Sie prüfte es und brach, sobald sie es für echt befunden hatte, in Gelächter aus. Vermittels ihres Stockes, den sie unablässig auf den Boden stieß, verstärkte sie ihren Lärm. Dann wurden die Augen der alten Dame wässerig, und ein Stickhusten gestattete ihr nur noch leise Kreischlaute. Monsignor Tamburini maß die Herzogin von der Seite, misstrauisch und entrüstet, wie einen zahlungsunfähig gewordenen Kunden. Sie selbst fragte plötzlich:
"Der Staat konfisziert meine Domänen? Das soll heißen, Nikolaus nimmt sie mir weg?"
Pavic antwortete düster:
"Ja."
"Ah, Nikolaus … und Friederike und … Phili," sagte sie vor sich hin. Das Vernommene erregte ihr tiefstes Staunen. Es kam ihr keineswegs wie ein Unheil zum Bewusstsein, das sie betroffen hätte; ohne an seine Folgen zu denken, sah sie nur den Akt vor Augen. Der König Nikolaus vollzog in einer Regung väterlicher Unzufriedenheit die gewichtige Urkunde. Friederike stand spitz und entschieden daneben, Phili ganz begossen. Die armen Leute, um ihrem Gegner nahe zu kommen, erfanden sie nichts weiter, als ihm sein Geld zu stehlen. Auch Rustschuk wäre darauf verfallen! Plötzlich hörte sie dicht an ihrem Ohr die Contessa Blà:
"Nicht wahr, Hoheit, die Sache hat etwas Groteskes?"
"Etwas … Woher wissen Sie?"
Sie sah überrascht auf.
"Ganz recht, ich finde dasselbe. Aber sagen Sie, woher wissen Sie?"
"Aus den Bildnissen der dalmatinischen Herrschaften. Sie haben etwas so streng, — wie soll ich sagen, so streng Bürgerliches. Sie müssen überaus sittenrein sein und werden, was sie Ihnen, Hoheit, nun zufügen, sicherlich nicht gern tun. Der König Nikolaus, wie konnten Sie ihn erzürnen, er ist so ehrwürdig."
"Ehrwürdig, das ist für ihn das Wort!" rief die Herzogin, mit zuckendem Gesicht. Die beiden jungen Frauen begannen gleichzeitig zu lachen. Unwillkürlich reichten sie einander die Hand. Die Blà murmelte: "Natürlich, es sind Bürger …," und zog ihr niedriges Taburett näher heran. Sie setzte sich vor die Herzogin hin, fast zu ihren Füßen.
San Bacco lief, durch die Neuigkeit mächtig aufgerüttelt, in der Galerie hin und her. Er schleuderte, mit den Armen fuchtelnd, aus seinem gärenden Selbstgespräch zuweilen ein lautes Wort ins Freie. Endlich brach er los. Die Verruchtheit dieser elenden Tyrannen hatte also an der Knechtung des Volkes nicht mehr genug, sie erfrechten sich zu Übergriffen gegen alte, erbgesessene Geschlechter!
"Ein tausendjähriger Familienbesitz, wer hat denn ein Recht, ihn mir abzusprechen? Kein Staat und kein König — nur Gott!"
Nach diesem Ausspruche ließ der Revolutionär, der diesseits und jenseits des Meeres alle angestammten Rechte gestürmt hatte, drohende Blicke unter seinen Zuhörern kreisen.
"Ein hergelaufener Monarch, mit dem Reisesack in der Hand ins Land gekommen! Nicht einmal ein Eroberer! Aber ich werde ihn vernichten! Ich werde zu ermitteln wissen, wieviel jünger die Koburg sind als die Assy! Und das werde ich den Blättern mitteilen!"
Pavic ward durch die Heftigkeit des andern an glückliche Tage erinnert. Es war ihm zu Mut, als liefe wieder das Volk von allen Seiten zusammen; es umwogte ihn keuchend, und er fühlte schon die Bretter irgendeines Weinfasses unter den Füßen. Seine Augen begannen zu glänzen, die Hände bebten, und dann redete er. Er hielt eine seiner großen Reden: niemand war darauf gefasst gewesen. Die Damen erschraken, der Kardinal betrachtete gelassen diesen neuen Menschentypus. Monsignor Tamburini verlor vorübergehend sein überlegenes Urteil unter dem Anprall dieser Beredsamkeit und versuchte sich klarzumachen, wieviel sie unter Umstanden wert sei.
Die Herzogin sah unaufmerksam weg; sie war zu oft bei den Proben auf der Bühne gewesen. All mählich blieb sie an den Gesichtern ihrer neuen Bekannten haften. Die Blà, die das Mienenspiel des Tribunen skeptisch studierte, machte den Eindruck einer eleganten Frau ohne Schicksale, fein und gütig. Und obendrein spielte Geist auf der schönen Weiblichkeit ihrer Züge. Vinon Cucuru, die Dunkelblonde, kicherte in ihr Schnupftuch. Sie war mit Stumpfnase und Grübchen ein selbstbewusstes Kind, dem es gar nicht fehlen konnte. Aber ihre Schwester schien alles hinter sich zu haben und gebrochen von allem zurückgekommen zu sein. Lilians Haar war tiefrot, mit violetten Lichtern. Sie hielt den blassen Blick gesenkt, ihre Nase begann vorn sich zu röten, die Hände lagen, wie kranke Mollusken, trostlos im Schoße. Das Mädchen kam dem Fremden ganz weiß und kalt vor von abgestorbenen Schmerzen, die als Leichen in ihrer Brust vergessen waren. Sie ließ davon jeden sehen was er mochte. Keine Gesellschaft war wichtig genug, um ihr etwas zu verbergen.
Im Rücken der Damen und hinter Tamburini und San Bacco, an der langen Wand der Galerie gesellten sich wie auf Balkonplätzen die alten Bilder zu Pavic' undankbaren Hörern. Das Haar in Schläfen und Stirn gestrichen, sann ein junger Mann mit ungleichen Augen zärtlich über den hohen steifen Fältelkragen hinweg. Ein liebliches, reiches Kind hatte über dem Tisch, worauf seine Taschenuhr lag, eine Seifenblase geformt. Sein Papagei floh kreischend, sein Hündchen sprang herzu. Man sah es, der Spitz würde noch Kapriolen machen und der Vogel noch schreien, wenn der Stundenzeiger der Kleinen schon stillgestanden und der bunte Schaum ihrer zehn Jahre geplatzt sein würden. Die todesdüstere Schönheit daneben, in gewellten Haaren, Agraffen und wehen den Schleiern, hielt in Händen ein Sieb. Ihr zugespitzter, üppiger Finger deutete auf den durchlöcherten Behälter wie auf ein Leben, in dem alles vergeblich gewesen wäre und alles bodenlos. Doch Judith, die schmale Jungfrau, trug unter gemmengekrönten Locken das bleiche Antlitz sehr hoch, ohne es je auf ihre starken Hände zu neigen, in denen das Schwert blitzte und der Kopf blutete.
Pavic machte krampfhafte Anstrengungen, um sich in der Täuschung zu erhalten, als umringten ihn Bewunderer. Allmählich versiegte seine Rede in der allgemeinen Gleichgültigkeit. Er stotterte, fasste an die feuchte Stirn und verstummte, beschämt und unglücklich. Die alte Fürstin hatte ihn die ganze Zeit mit offenem Munde angestarrt. Kaum war es füll, so klappte sie das Gebiss zusammen und sprach von etwas anderem.
Zwei leise Diener mit rasierten, friedevollen Lippen reichten Erfrischungen umher. Die Herzogin und die Blà nahmen Zedernschnee. Der Kardinal tat in sein geeistes Wasser ein Stückchen Zucker, San Bacco und Pavic gossen Rum hinein; die Cucuru trank ihn unverdünnt. Ihre Tochter Vinon schleckte Vanillegefrorenes. Monsignor Tamburini bereitete eine Orangeade, wobei ihm der Fruchtsaft über die Finger tropfte, und bot sie der trübseligen Lilian. Sie streckte achtlos die Hand aus; er zog das Glas zurück und bat verzerrten Mundes und mit der Anmut eines schlecht Gebändigten:
"Aber erst ein freundliches Gesicht machen!"
Sie drehte ihm den Rücken zu, doch traf sie den Blick ihrer Mutter und schrak zusammen. Darauf kehrte sie zu Tamburini zurück, lächelte ihm zu wie eine, die auch das noch tun kann, und goss, als habe sie sich zum Giftbecher entschlossen, das Getränk auf einmal hinab.
Die Cucuru hatte sich einen Teller mit Marmelade belegt. Sie schrie den Aufwärter an: "La bouche!" Mit unerwartetem Ruck senkte sie sich so tief seitwärts, als wollte sie den Kopf unter den Stuhl stecken, sie brach sich mit einem Knacken die Kiefer aus und legte sie in die bereitgehaltene Schale.
"Ihr braucht eure Zähne zum Essen, ich meine nur zum Sprechen. Kauen tue ich mit dem Gaumen!"
So heulte sie, mit plötzlich dumpf und uralt gewordener Stimme, angestrengt hinaus in die Galerie, deren edle Maße den feinen Reden bedächtig wandelnder Geistmenschen erbaut waren.
Der Kardinal unterhielt die Herzogin von Münzen und Kameen. Er zeigte ihr in Kasten, die er herbeitragen ließ, eine Abteilung der seinigen.
"Ich habe niemals erfahren, woher diese da stammt. Man erkennt auf einer Seite eine Weintraube und auf der andern unter den Buchstaben Iota und Sigma eine Amphora."