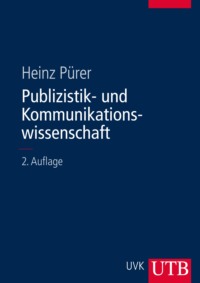Kitabı oku: «Publizistik- und Kommunikationswissenschaft», sayfa 15
• regelmäßig für einen oder mehrere Auftraggeber auf der Grundlage individueller Vereinbarungen oder tariflicher Verträge,
• für ein oder mehrere Unternehmen auf der Grundlage von Vereinbarungen im Einzelfall oder ohne Auftrag, indem sie journalistische Beiträge erarbeiten und den Medien anbieten.
Freie Journalistin/freier Journalist ist auch, wer Inhaber oder Anteilseigner eines Medienbüros ist oder im Zusammenschluss mit anderen freien Journalistinnen oder Journalisten arbeitet, sofern die journalistische Tätigkeit dabei im Vordergrund steht. Angestellte Journalistinnen und Journalisten arbeiten auf der Basis des geltenden Arbeitsrechts und bestehender Tarifverträge.«
Aus der sehr detaillierten Beschreibung geht hervor, dass das Berufsbild im Hinblick auf das Arbeitsverhältnis (fest angestellt oder freiberuflich), auf die Medien (Presse, Rundfunk, Online-, Offlinemedien, Öffentlichkeitsarbeit etc.), auf die Tätigkeitsmerkmale (Recherchieren, Auswählen, Aufbereiten, Gestalten etc.) und auf die Unternehmensart (Medienunternehmen, Wirtschaftsunternehmen, Verwaltung, Organisation) konkretisiert wird. Es bezieht damit einen möglichst umfassenden Kreis von Personen ein, die in Kommunikationsberufen tätig sind. Dies ist nicht zuletzt berufspolitisch für die Verbände selbst (hohe Mitgliederzahlen) sowie für die jeweils Betroffenen (Tarifverträge) von besonderer Bedeutung.
Es ist wiederholt versucht worden, Daten zu Berufsbild, Berufsstruktur, Selbstbild und Fremdbild der Journalisten in Deutschland zu ergründen. Es ist dies forschungstechnisch gar nicht so einfach zu bewerkstelligen: So liegen keine Berufslisten oder Berufsverzeichnisse vor, in die Einsicht genommen werden könnte. Und auch die Berufsverbände sind aus Gründen des Datenschutzes in aller Regel nicht bereit, die Namen ihrer Mitglieder bekannt zu geben. Daher sind Journalismusforscher weitgehend auf die Bereitschaft von Medienbetrieben angewiesen, wenn sie Informationen über die Anzahl der journalistisch Beschäftigten erhalten oder sich für Zwecke wissenschaftlicher Befragungen (mittelbaren oder unmittelbaren) Zugang zu Journalisten verschaffen wollen. Nicht [123]selten stößt man dabei unter den Journalisten auch auf eine beträchtliche Zahl von Antwortverweigerern. Es verwundert dies bei einer Berufsgruppe, die anderen Personengruppen – berufsbedingt natürlich – sehr gerne auf die Finger, unter den Teppich (und mitunter sogar in die Betten) schaut. Möglicherweise ist aber ein Grund auch darin zu sehen, dass zahlreiche Fragebögen – nicht zuletzt von Studierenden der Journalistik oder Kommunikationswissenschaft – auf den Schreibtischen der Journalisten landen, deren Bearbeitung oftmals viel Zeitaufwand bedeutet.
Unter den zahlreichen empirischen Studien, die es über Journalisten in Deutschland seit Ende der 1960er- bzw. Anfang der 1970er-Jahre gibt, seien hier aus Platzgründen jene herausgehoben, die medienübergreifende Gesamtdarstellungen umfass(t)en. Es sind dies Mitte der 1970er-Jahre vorgelegte Studien, Anfang der 1990er-Jahre (nach der Wiedervereinigung) erstellte Studien sowie zwischen 2005 und 2009 entstandene Journalistenbefragungen. Dazu im Einzelnen:
Journalistenenquete 1974, Synopse »Journalismus als Beruf« 1977
1974 erarbeitete die Arbeitsgemeinschaft für Kommunikationsforschung (AfK) München eine – leider nicht veröffentlichte, sondern nur als vervielfältigter Forschungsbericht vorliegende – repräsentative »Journalistenenquete« (vgl. Böckelmann 1993, S. 56ff). 1977 folgte – ebenfalls von der AfK München – die Forschungssynopse »Journalismus als Beruf« (vgl. Böckelmann 1993, S 58ff). Auch sie liegt nur als vervielfältigtes Manuskript vor. Bei ihr handelte es sich u. a. auch um eine Auswertung von Kernstudien, deren Datenmaterial zugänglich und einigermaßen vergleichbar war (vgl. ebd.). Damals gab es in der Bundesrepublik (also nur Westdeutschland) »etwa 25.000 Journalisten«, unter ihnen mehr als 4.500 freie Journalisten und etwas mehr als 1.500 Volontäre und Praktikanten (ebd.). Die meisten von ihnen arbeiteten bei Tages- und Wochenzeitungen (6.500). »Etwa 3.000 Journalisten waren beim Rundfunk [damals nur öffentlich-rechtlicher Rundfunk – H. P.] und sonstigen AV-Medien tätig« (Böckelmann 1993, S. 59). Die Befragten hielten mehrheitlich (»zwischen der Hälfte und zwei Dritteln«) den Journalismus »für einen ›Beruf für Idealisten‹«, Beziehungen wurden für Karrieren als wesentlich erachtet (Böckelmann 1983, S. 60). Im Rollenverständnis der Befragten dominierte die Auffassung, »politische und gesellschaftliche Prozesse kritisch zu kommentieren und zu kontrollieren« (ebd.), daneben gab es noch »die Rollenvorstellung vom Journalisten als Anwalt unterprivilegierter […] Bevölkerungsgruppen« (ebd.). Das Berufsbild befand sich damals infolge »zunehmender Rationalisierung und Technisierung der journalistischen Berufstätigkeit« im Umbruch (ebd.). Zur Erklärung: Die Einführung elektronischer Systeme der Zeitungsproduktion – und damit die Verlagerung technischer Arbeiten aus dem Bereich Satzherstellung in die Redaktion – stand damals bevor.
Journalismus in Deutschland [I], Sozialenquete 1992
Weiters zu erwähnen sind die 1992 entstandenen Berufsstudien über »Journalismus in Deutschland[I]« (Weischenberg et al. 1993f; 1.500 schriftlich Befragte) sowie die »Sozialenquete über die Journalisten in der Bundesrepublik Deutschland« (Schneider et al. 1993f; 1.500 Telefoninterviews). Beide Studien beanspruchten Repräsentativität, gelangten aber infolge unterschiedlicher methodischer Designs zu mitunter mehr oder weniger voneinander abweichenden Ergebnissen. 1992 gab es im wiedervereinten Deutschland 32.000 (Sozialenquete) bzw. 36.000 (Journalismus in Deutschland) hauptberuflich tätige Journalisten, hinzu kamen rund 18.000 bis 20.000 freie Mitarbeiter. In der Summe ergab dies etwa 52.000 bis 55.000 Journalisten. Größter Arbeitgeber waren die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, [124]gefolgt von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie vom privaten Rundfunk (Radio, TV). Die zumindest tendenziell vergleichbaren Ergebnisse der beiden Studien lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Im Jahr 1992 waren Journalisten eine relativ junge Berufsgruppe mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren. Der Anteil der Frauen lag im Bundesdurchschnitt bei 30 Prozent (in Ostdeutschland höher als in Westdeutschland). Das monatliche Durchschnittseinkommen betrug damals rund 2.045 Euro netto. Die Berufszufriedenheit war hoch, besonders geschätzt wurde die berufliche Autonomie. Mit Blick auf Berufsverständnis bzw. Rollenbild stand die Informationsfunktion an erster Stelle, gefolgt von Kritik- und Kontrollaufgaben. Die Befragten verfügten über ein recht positives Publikumsbild (»aufgeschlossen«, »gut informiert«, »politisch interessiert«), bei politischen Präferenzen wurde von den Befragten die SPD besser bewertet als andere Parteien. Was ethische Fragen betraf, so standen die ostdeutschen Journalisten unfairen Methoden der Informationsbeschaffung deutlich zurückhaltender gegenüber als die westdeutschen. Junge Journalisten standen der Berufsethik unbekümmerter gegenüber als ältere. Wichtigste Orientierungsmedien der Journalisten waren Der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung sowie Tagesthemen (ARD) und Tagesschau (ARD). Die Arbeitszeit betrug im Wochendurchschnitt 46 Stunden und stieg mit höherer Berufsposition. Den größten Zeitaufwand nahm bei Printjournalisten die Recherche, bei Funkmedien die technisch aufwändigere Produktion ein. Bei den journalistischen Ausbildungswegen dominierte mit Abstand das Volontariat. In der Summe waren die Journalisten damals eine relativ homogene Berufsgruppe, eine ausgeprägte Tendenz zur »Selbstreferenz« war nicht zu übersehen: Externe Einflüsse wurden gering bewertet, hohe Beachtung kam der Kollegenorientierung zu.
Journalismus in Deutschland [II]
Mit der 2006 als Buchpublikation veröffentlichen Studie »Die Souffleure der Mediengesellschaft« legten Siegfried Weischenberg, Maja Malik und Armin Scholl einen umfassenden »Report über die Journalisten in Deutschland« vor (Weischenberg et al. 2006b). Kernbefunde der Studie wurden 2006 auch als Aufsatz vorab publiziert (Weischenberg et al. 2006a). Das Design des Journalistenreports 2006 entsprach weitestgehend jenem der 1993 publizierten Studie »Journalismus in Deutschland« (Weischenberg et al. 1993ff). Die Resultate der umfangreichen quantitativen und repräsentativen Erhebung beruhen auf den Antworten von 1.536 repräsentativ im Frühjahr 2005 telefonisch (mittels CATI) befragten, festangestellten oder freien Journalistinnen und Journalisten aus Zeitungs- und Zeitschriftenredaktionen, Anzeigenblättern, Hörfunk- und Fernsehsendern, Onlinemedien, Nachrichtenagenturen und Mediendiensten. Als Journalisten werden den Autoren der Studie zufolge (relativ eng) diejenigen Personen bezeichnet, »die hauptberuflich und hauptsächlich damit beschäftigt sind, aktuelle, auf Tatsachen bezogene und (für ihr Publikum) relevante Informationen zu sammeln, zu beschreiben und in journalistischen Medien zu veröffentlichen« (Weischenberg et al. 2006b, S. 31).
2005 gab es in Deutschland hochgerechnet etwa 48.000 hauptberuflich tätige Journalisten – festangestellt oder als hauptberuflich Freie. Gegenüber 1993 (damals rund 54.000) sind dies immerhin rund 6.000 weniger, wobei das Minus hauptsächlich auf die rückläufige Zahl von hauptberuflichen Freien – insgesamt stellen diese 12.000 bzw. ein Viertel – zurückzuführen ist (vermutlich aber auch auf die relativ eng gehaltene Definition von Journalist). Die Zahl der festangestellten Redakteure dagegen ist mit rund 36.000 gegenüber 1993 stabil geblieben (vgl. Weischenberg et al. 2006b, S. 36f). (Die mehr als 7.000 Journalisten, die bei der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2005 als arbeitslos gemeldet waren, sind in der Statistik nicht enthalten).
[125]Die Autoren eruierten Befunde zu klassischen Fragen der journalistischen Berufsforschung, u. a. also: in welchen Medien und Ressorts die Journalisten arbeiten; welche Merkmale und Einstellungen sie aufweisen; wie es um ihre Berufszufriedenheit bestellt ist; über welches Rollenbild sie verfügen; wie sie sich informieren und welche ihre Leitmedien sind; wonach sie sich richten und wie es um ihre Moral bestellt ist. Holzschnittartig - und damit naturgemäß verkürzt - lässt sich der deutsche Journalist kompakt wie folgt beschreiben:
Er ist männlich (63 Prozent), knapp 41 Jahre alt (1993: 37 Jahre), entstammt der Mittelschicht, verfügt über einen Hochschulabschluss (69 Prozent) und hat ein Volontariat absolviert (63 Prozent). Er arbeitet bei einem Printmedium (61 Prozent), verdient ca. 2.300 Euro netto monatlich (1993: umgerechnet 2.000 Euro), lebt in einer festen Partnerschaft (71 Prozent) und ist kinderlos (57 Prozent). Er positioniert sich weltanschaulich »eher links von der Mitte« und sieht sein Medium »mehr oder weniger rechts von der Mitte« (Weischenberg et al. 2006b, S. 70). Sein berufliches Selbstverständnis ist vom Informationsjournalismus geprägt (vgl. Weischenberg et al. 2006b, S. 192ff). Wichtige Orientierungsmedien sind für ihn die Süddeutsche Zeitung (35 Prozent) und Der Spiegel (34 Prozent) sowie die ARD-Tagesschau (19 Prozent) und weitere andere, aber weniger regelmäßig genutzte Medien (vgl. S. 132ff). Weitere Resultate sind:
Frauen: Der Anteil der Frauen im Journalismus macht 37 Prozent aus (1993 waren es knapp ein Drittel, in den 70er-Jahren 20 Prozent); unter den Berufsanfängern stellen sie erfreulicher Weise bereits die Hälfte (50,3 Prozent). Frauen nehmen insgesamt nur zu gut einem Fünftel (22 Prozent) leitende Posten ein und verdienen im Durchschnitt immer noch weniger als ihre männlichen Kollegen. Vier von fünf Chefredakteuren sind männlich (vgl. S. 45ff). Auf der mittleren Führungsebene hat indessen »etwas mehr Bewegung stattgefunden« (ebd): knapp 29 Prozent der Ressortleiter und Chefs vom Dienst sind weiblich (1993: 20 Prozent). Journalistinnen sind überwiegend in Ressorts bzw. für Themen wie Mode, Wellness, Lifestyle, Gesundheit, Familie, Kinder, Soziales tätig. Diese Verteilung spiegelt »weitgehend altbekannte Rollenmuster wider« (Weischenberg et al. 2006b, S. 48), wenngleich »die Geschlechtergrenzen in den zentralen Ressorts des Journalismus langsam aufzuweichen [scheinen]« (ebd.) und Frauen »nicht mehr nur in den vermeintlichen Randbereichen des Journalismus vertreten [sind]« (Weischenberg et al. 2006b, S. 49). Vom Segment der Zeitungen abgesehen sind Frauen »in den zentralen Ressorts und zentralen Medien mindestens entsprechend dem Frauenanteil im Journalismus insgesamt repräsentiert« (ebd.).
Ausbildung: Bezüglich weiterer Ergebnisse sei erwähnt, dass z. B. der Ausbildungsweg der Journalisten bislang »keinerlei Einfluss auf ihre spätere berufliche Position und nur wenig Einfluss auf ihr Gehalt« hat (S. 68). Unter den journalistischen Ausbildungswegen stehen Praktikum (69 Prozent) und Volontariat (62 Prozent) unangefochten an der Spitze, ein Studium der Journalistik weisen 14 Prozent der Befragten auf, jenes der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 17 Prozent. Unter den universitären Studienrichtungen stehen Germanisitik/Literatur- und Sprachwissenschaften mit 25 Prozent an der Spitze (Weischenberg et al. 2006b, S. 67f).
Medientyp: Innerhalb der Medienbereiche hat es seit 1993 Verschiebungen gegeben (vgl. Weischenberg et al. 2006b, S. 37ff): So sind bei Fernsehen und Hörfunk sowie allgemein bei Zeitschriften prozentuell vergleichsweise mehr Journalisten tätig als 1993; bei Zeitungen, Anzeigenblättern, Agenturen und Mediendiensten prozentuell weniger. Bei Onlinemedien arbeiten 5 Prozent, unter ihnen eine beträchtliche Anzahl fester Freier. Auf diese Gruppe, die Freien, greifen nun in vergleichsweise stärkerem Ausmaß auch Fernsehen und Hörfunk zurück (vgl. Weischenberg et al. 2006b, S. 40).
Rollenbild: »Größte Zustimmung von den Journalisten erhalten […] Rollenbilder, die auf Information und Vermittlung gerichtet sind«: »das Publikum möglichst neutral und präzise informieren« (89 Prozent); »komplexe Sachverhalte erklären und vermitteln« (79 Prozent); »dem Publikum möglichst schnell Informationen vermitteln« (74 Prozent); »Realität genau so abbilden, wie sie ist« [126](74 Prozent). Wichtig erscheint den Journalisten aber auch, Kritik an Missständen zu üben (58 Prozent), den Menschen Gehör zu verschaffen (34 Prozent), sich für Benachteiligte in der Bevölkerung einzusetzen (29 Prozent), Bereiche wie Politik und Gesellschaft zu kontrollieren (24 Prozent). Dagegen wollen nur 14 Prozent »die politische Tagesordnung beeinflussen und Themen auf die politische Agenda setzen« (Weischenberg et al. 2006b, S. 106f). Absicht und Rollenumsetzung (tatsächliche Handlungsrelevanz) weichen jedoch voneinander ab, wobei es auch mediale Unterschiede (Medientyp) gibt (Weischenberg et al. 2006b, S. 107ff).
Tätigkeiten: Die Wochenarbeitszeit beträgt den Angaben der Befragten zufolge 45 Stunden (und ist damit um eine Stunde weniger als 1993). Der tägliche zeitliche Aufwand für die Recherche beträgt 117 Minuten, jener für das Auswählen 33 Minuten, für das Redigieren des Informationsmaterials 33 Minuten, für das Redigieren der Texte von Kollegen und Mitarbeitern 55 Minuten. »Gleich geblieben ist mit zwei Stunden auch die Zeit, die für das Texten und Verfassen von Beiträgen aufgebracht wird […] wohingegen die Moderation (nur bei Rundfunkjournalisten) deutlich an Bedeutung verloren hat« (28 Minuten; 1993: 46 Minuten) (Weischenberg 2006b, S. 80f). Neu hinzugekommen sind Internettätigkeiten (Kommunikation und Recherche, 122 Minuten), E-Mail-Kontakte und Kommunikation mit dem Publikum (44 Minuten). Das Mitte der 1990er-Jahre neu hinzu gekommene Internet blieb für die Arbeit der Journalisten also nicht ohne Folgen.
Arbeitszufriedenheit: Die Arbeits- bzw. Berufszufriedenheit ist relativ hoch. Geschätzt wird v. a. das Verhältnis zu Mitarbeitern (93 Prozent), Arbeitskollegen (88 Prozent) und Vorgesetzten (74 Prozent). Hohe Wertschätzung genießt auch die Möglichkeit, sich die Arbeit selbst einzuteilen (79 Prozent) und mit der politischen und weltanschaulichen Linie des Medienbetriebs gut zurecht zu kommen. Auch mit der Qualität der Ausbildung sind die Befragten zufrieden (72 Prozent), die Fernsehjournalisten besonders. Mit der Höhe der Bezahlung sind 54 Prozent zufrieden, mit der beruflichen Sicherheit immerhin die Hälfte (50 Prozent). Aufstiegsmöglichkeiten werden von Chefredakteuren (56 Prozent) und Ressortleitern (46 Prozent) naturgemäß höher eingeschätzt als von Redakteuren (26 Prozent Zufriedene) oder Volontären (33 Prozent Zufriedene). Ähnlich sind die Verhältnisse bezüglich der beruflichen Absicherung (Weischenberg et al. 2006b, S. 89ff).
Arbeitsklima, Ethik, Publikumsbild: Das Arbeitsklima wird durchweg als gut bezeichnet, mit der Arbeitsbelastung am wenigsten zufrieden sind die Zeitungsjournalisten, »deren Redaktionen personell am meisten von der Medienkrise betroffen sind« (Weischenberg et al. 2006, S. 93). Gegenüber der Legitimität umstrittener Recherchemethoden herrscht noch stärkere Zurückhaltung vor als 1993, jüngere Journalisten sind vergleichsweise weniger zurückhaltend (vgl. Weischenberg et al. 2006, S. 174ff). Das Publikumsbild ist differenziert; im Durchschnitt wird es für politisch interessiert und gebildet, an Informationen noch mehr interessiert gehalten als an Unterhaltung und politisch überwiegend der Mitte zugeordnet (vgl. Weischenberg et al. 2006, S. 157ff).
Parteipräferenzen: Was die Parteipräferenzen der Befragten betrifft, so gaben 36 Prozent der Befragten an, eine Neigung für Bündnis 90/Die Grünen zu haben, gefolgt von 26 Prozent der Respondenten mit Neigung zur SPD, neun Prozent mit Neigung zu CDU/CSU, sechs Prozent mit Neigung zur FDP und ein Prozent zur PDS (heute: Die Linke). Weitere 20 Prozent geben an, ohne Parteineigung zu sein. Gegenüber 1993 finden die Grünen fast doppelt so viel Zuspruch (plus 19 Prozent), in der Altersgruppe der 36- bis 45-Jährigen ist er mit 42 Prozent am höchsten.
Bei den hier dargestellten Befunden handelt es sich nur um einige wenige (notgedrungen relativ undifferenziert wiedergegebene) Ergebnissplitter, vorwiegend nackte Daten. Die Studie enthält eine große Fülle von Erklärungen und Interpretationen dieser und weiterer Daten und Fakten, die ein differenziertes und facettenreiches Bild über die Berufsgruppe der Journalisten in Deutschland vermitteln. Die Autoren gelangen gegenüber 1993 zu einem Berufsbild, das auch die Folgen der Digitalisierung und der Wirtschaftskrise im Mediensektor zu spüren bekam; das Berufsfeld selbst hat sich [127]u. a. durch Fachmedien und spezielle Themengebiete sowie durch das Internet ausdifferenziert. Der Berufsstand franst seit geraumer Zeit bekanntlich an seinen Rändern aus, so etwa auch im Onlinejournalismus. »Man lernt, wie schwer es geworden ist zu entscheiden, ob jemand nun ein Journalist ist oder nicht. Diese Identifizierungsprobleme werden im Online-Zeitalter immer größer« (Weischenberg et al. 2006, S. 20). Die Studie wirft auch einen Blick auf die Wertschätzung von Berufen in der Bevölkerung, die für Journalisten laut Allensbacher Umfrage von 2005 mit 10 Prozent der Befragten sehr gering ist. Mittlerweile weist diese Wertschätzung wieder etwas bessere Ergebnisse auf (vgl. w. u.). In dem Band wird auch das Thema der sog. »Alphatiere« (z. B. Sabine Christiansen, Anne Will, Günther Jauch, Johannes B. Kerner, Hans-Ulrich Jörges, Sandra Maischberger etc.) im Journalismus angesprochen, teilweise konkretisiert an kontinuierlich gesammelten, veröffentlichten Äußerungen der Protagonisten bzw. betroffenen Medienstars selbst (Weischenberg et al. 2006, S. 52–53).
Mit Journalisten in Deutschland befasst sich auch eine 2009 veröffentliche, qualitative Studie (Meyen/Riesmeyer 2009). Befragt wurden mittels Leitfadeninterviews 501 nach dem Prinzip der theoretischen Sättigung ausgewählte deutsche Journalisten (vgl. Meyen/Riesmeyer 2009, S. 49ff). Die Studie erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität, Verallgemeinerungen lässt sie infolge der relativ großen Zahl von Befragten tendenziell jedoch zu. Theoretisch basiert die Studie auf Bourdieus Konzept von Feld, Kapital und Habitus, aus welchem die Autoren eine Theorie des journalistischen Feldes herleiten (Meyen/Riesmeyer 2009, S. 25ff). Die Autoren finden u. a. heraus, dass sich viele Befragte dem Publikum verpflichtet fühlen, was Meyen/Riesmeyer dazu verleitet, von einer »Diktatur des Publikums« (so der Titel der Untersuchung) zu sprechen.
Eine empirische Studie über »Freie Journalisten in Deutschland« wurde 2009 von Michael Meyen und Nina Springer vorgelegt (Meyen/Springer 2009). Es handelt sich dabei um eine Onlinebefragung von 1.543 freien Journalisten, ergänzt um 82 Tiefeninterviews (vgl. Meyen/Springer 2009, S. 12). Dieser »Report« gibt u. a. Aufschluss über die Berufsstruktur, den Arbeitsalltag, das Selbstverständnis, die Auftragslage und die Berufszufriedenheit von freien Journalisten in Deutschland. Außerdem nahmen die Autoren eine Typenbildung vor. Durchgeführt wurde die Studie im Auftrag des Deutschen Fachjournalisten-Verbandes (DFJV).
Im Zusammenhang mit dem Berufsbild Journalismus ist schließlich auch auf Berufsauffassungen bzw. Berufsverständnisse zu verweisen, die im Journalismus vorzufinden sind. Dabei ist es nicht unproblematisch, journalistisches Handeln typischen beruflichen Rollenmustern zuzuordnen, zumal Journalisten nicht oder nur selten »ausschließlich einem einzigen Rollenmuster folgen. Vielmehr wechseln sie zwischen verschiedenen Rollen, wie es ihre Aufgabenstellungen eben von Fall zu Fall erfordern« (vgl. Haas/Pürer 1996, S. 355). Auch ist darauf hinzuweisen, dass für die Ausprägung journalistischer Berufsauffassungen individuelle wie mediensystemische Faktoren eine Rolle spielen. Dazu gehören u. a. persönliche Lebensläufe der Journalisten, ihre Bildungs- und Ausbildungswege sowie Erwartungen und Ansprüche an den Beruf. Zu erwähnen sind auch Erfahrungen der beruflichen Sozialisation, Sachzwänge des medienspezifischen Umfeldes und der konkreten Arbeitsbedingungen sowie Funktion und Position eines Journalisten innerhalb des Medienbetriebes selbst. Nicht zuletzt spielen für die Ausprägung des Berufsverständnisses aber auch Haltungen eines Journalisten zu den politischen und sozialen Funktionen des Journalismus und der Massenmedien eine Rolle (vgl. Haas/Pürer 1996, ebd.). Auf folgende, mehr oder weniger typische und auch empirisch vorfindbare journalistische Berufsauffassungen (Haas/Pürer 1996; Haas 1999) bzw. Journalismus-Konzeptionen (vgl. Bonfadelli/Wyss 1998; Haller 2004) ist zu verweisen (die hier nicht in ihren einzelnen Details beschrieben, sondern nur im kurz gerafften Überblick vorgestellt werden):
[128]• Objektive Vermittlung: Journalismus als neutrale Vermittlungsaufgabe bedeutenden Geschehens in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur; der Journalist als unparteiischer Vermittler, der Nachrichten möglichst faktengetreu und unverfälscht weitergibt; verzichtet auf Wertung und Bewertung, will Bürger unvoreingenommen informieren. Die Problematik ist folgende: Kann zum Verlautbarungsjournalismus abdriften, wenn er Hintergründe und Ursachen ausklammert, auf kritische Wachsamkeit verzichtet und an der Oberfläche bleibt (wird verkürzt gelegentlich auch »Informationsjournalismus« genannt).
• Kritik und Kontrolle: Journalismus als Aufgabe der Meinungsbildung und des Wächters der Demokratie; Kritikfunktion findet Ausdruck in prüfenden und kritisch bewertenden Beiträgen (wie Glossen, Kommentaren, Leitartikeln etc.); Kontrollfunktion in aufdeckend-enthüllenden Beiträgen. Dabei ergibt sich die Problematik, dass das Berufsverständnis mitunter getragen wird von der Auffassung, wonach Medien neben Legislative, Exekutive und Judikative eine »Vierte Gewalt« sein sollen; Journalismus und Medien sind dazu jedoch nicht legitimiert.
• Interpretativer Journalismus: Begnügt sich nicht damit, Fakten zu sammeln und zu referieren, sondern integriert sie in größere Zusammenhänge, recherchiert Hintergründe und bietet Analysen an; nicht die Weitergabe von Nachrichten ist wichtig, sondern besonders deren Bewertung; will Interpretationsweisen und Zusammenhangseinschätzungen von Wirklichkeit anbieten. Die Problematik dieser Berufsauffassung ist, dass sie mitunter einer individuellen, subjektiven Wirklichkeitssicht verfällt und sich als Hüter der Wahrheit zu gerieren (vorwiegend im Magazin-Journalismus vorfindbar) droht.
• Anwaltschaftlicher Journalismus: Ist geprägt von parteiischer (nicht parteipolitischer) Subjektivität und versteht sich als Advokat von Personen oder Gruppen, die selbst keinen Zugang zu Medien und Interessenvertretungen haben; versucht eher »von unten nach oben« zu vermitteln (für die Schwachen und gegen die Starken, für die Ohnmächtigen gegen die Mächtigen); sieht sich als »Kommunikationshelfer«: will dem sprachlosen Bürger Gehör in der Öffentlichkeit verschaffen; verzichtet durch parteiische Stellungnahme auf Sachlichkeit und Objektivität. Problematik: Kann Gefahr laufen, sich für unredliche Zwecke missbrauchen zu lassen oder aus Fanatismus sich in deren Dienst zu stellen.
• Investigativer Journalismus: Will der Öffentlichkeit vorenthaltene oder verschwiegene, gesellschaftlich aber relevante Informationen bekannt machen, Missstände und Machtmissbrauch aufdecken (to investigate = aufspüren) bzw. öffentlich machen; bedarf einer äußerst gründlichen Recherche (Tiefenrecherche) und entsprechenden Beweisführung (und wird auch »nachforschender Journalismus« oder – missverständlich – »Recherche-Journalismus« genannt); recherchiert (zunächst) nicht selten in verdeckter Form, also ohne dass dem Informanten das Ziel der Recherche bekannt ist; ergreift mitunter Partei und verzichtet auf Objektivität; der Journalist strebt mit prononciertem Standpunkt eine authentische Darstellung seiner Wirklichkeitssicht an. Das Problem ist, dass er dadurch einseitig berichten und unvollständig informieren kann. Fließender Übergang zum Enthüllungsjournalismus, dem Gefahr droht, dass Insider »aus dem Apparat« den Journalismus instrumentalisieren, indem sie Informationen für eigene Zwecke weitergeben.
• Präzisionsjournalismus: Möchte dem Vorwurf der Oberflächlichkeit begegnen und macht die Instrumente und Validitätskriterien der empirischen Sozialforschung zur Basis der journalistischen Recherche; Vorbild des Journalisten ist der (empirische) Forscher, der versucht, seine Themen umfassend und mittels sozialwissenschaftlicher Verfahren zu ergründen. Problem: Läuft Gefahr, in dilettierende (Pseudo-)Wissenschaft zu entarten und die Grenzen zwischen Journalismus und Wissenschaft zu verwischen.
[129]• New Journalism: Versucht, unter Rückgriff auf literarische Formen und Stilmittel Realität (oft aus der Sicht der Betroffenen) wiederzugeben, wobei der ästhetischen Ausdruckskraft des Journalisten Priorität zukommt; verzichtet bewusst auf die Trennung von Nachricht und Meinung sowie von Fiction und Nonfiction, mischt Fakten und Erfundenes; bedient sich dialogischer Formen und innerer Monologe. Stammt aus der Studentenbewegung und Hippie-Kultur der 60er-Jahre in den USA (Tom Wolfe, Truman Capote), fand und findet im deutschen Sprachraum sein Forum in Zeitgeist-Zeitschriften.
• Marketingjournalismus: Versteht als stark publikumsorientiertes Konzept den Journalisten als Dienstleister und den Rezipienten als Kunden und berücksichtigt dessen Bedürfnisse bei der Produktion journalistischer Angebote; Ziel ist die langfristige Zufriedenstellung der kommunikativen Bedürfnisse des Rezipienten. Läuft dabei jedoch Gefahr, in Kommerz-Journalismus abzudriften und rein ökonomischem Kalkül zu folgen (d. h. möglichst kostengünstig bei der Werbewirtschaft nachgefragte Publika als Waren abzusetzen).
• Public Journalism: Aus den USA kommend wird in jüngerer Zeit auch im deutschen Sprachraum auf den Public Journalism verwiesen: »Public Journalism nimmt fair an den gesellschaftlichen Diskursen in der demokratischen Gemeinschaft teil. Er fördert demokratische Lösungen gesellschaftlicher Probleme, ohne sich einseitig zum Anwalt für spezifische Lösungsvorschläge zu machen, und ist verantwortlich für die Resultate seiner Berichterstattung« (Forster 2007, S. 4; siehe auch Forster 2006).
Die hier dargestellten Journalismus-Konzeptionen finden sich in unterschiedlichen Ausprägungen in Presse und Rundfunk (und teilweise auch in Onlinemedien) wieder und sind in aller Regel auch theoretisch begründet (vgl. Haas 1999). Sie sind nicht zu verwechseln mit zumeist negativ beurteilten Erscheinungen im Journalismus wie dem »Sensationsjournalismus«, dem »Scheckbuchjournalismus«, dem »erschlichenen Journalismus«, dem »Katastrophenjournalismus« u. a. m. Der Sensationsjournalismus übertreibt. Der Scheckbuchjournalismus monopolisiert Information gegen Geld. Der erschlichene Journalismus täuscht bisweilen lautere Ziele vor. Der Katastrophenjournalismus arbeitet voyeuristisch mit den Gefühlen, Ängsten und Nöten sowohl seiner Objekte als auch des Publikums. Aus einer normativen, journalismus-kritischen Sicht manifestieren sich in diesen Journalismen Fehlleistungen eines nur noch auf Gewinn hin orientierten Mediensystems, in welchem der ökonomische Erfolg (Auflage, Reichweite) gleichsam die journalistische Ethik diktiert. Auch der partizipative Journalismus, im Zusammenhang mit Bürgerjournalismus und Nutzerbeteiligung bei Onlinemedien oftmals genannt, gehört (weitgehend) nicht zu den klassisch-professionellen Berufsauffassungen im Journalismus.
Simone Ehmig ist – im weiteren und allgemeineren Sinne des Wortes – journalistischen Berufsverständnissen deutscher Journalisten auf den Grund gegangen. Sie meint einen Generationswechsel im deutschen Journalismus festzustellen, und zwar unter dem Einfluss historischer Ereignisse auf das journalistische Selbstverständnis. So hätten zeitgeschichtliche Ereignisse das Selbstverständnis des deutschen Journalismus in drei Generationen geprägt: die »Berichterstatter« der Nachkriegszeit; den »Anwaltstypus« der 1970er und 1980er-Jahre; sowie den »Nachrichtenjäger« der 1990er-Jahre (vgl. Ehmig 2000).