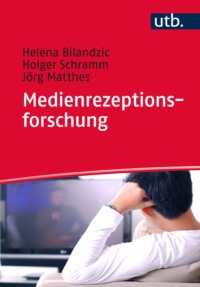Kitabı oku: «Medienrezeptionsforschung», sayfa 4
Schemata sind aber nicht nur für Erinnerungslücken verantwortlich, sondern auch für Ergänzungen. Personen fügen systematisch Informationen hinzu, die nicht Teil des ursprünglichen Stimulus sind. Minsky (1975) führt in diesem Zusammenhang den Begriff der Standardwerte (default options) ein. Ist beim Abgleich von Schema und Stimulus ein schema-konstituierendes Element nicht im Stimulus vorhanden, führt dies nicht notwendigerweise zum Misfit, sondern es werden Standardwerte eingesetzt, wie sie in ähnlichen Situationen vorkommen. Würde man beispielsweise einer Versuchsperson einen Arzt beschreiben und die Person anschließend bitten, die Beschreibung wiederzugeben, könnte es sein, dass die Versuchsperson einen weißen Kittel erwähnt, obwohl dieser nicht Teil der ursprünglichen Beschreibung war. Derartige Ergänzungen ermöglichen eine sinnvolle Kontextualisierung von Informationen. Dies ist die dritte Funktion von Schemata, die Ergänzungsfunktion.
Diese drei Funktionen von Schemata erklären, wie die Rezipienten bei der Medienrezeption Wissen über Themen, Personen, Objekte oder Sachverhalte verarbeiten bzw. abspeichern (vgl. z. B. Conover & Feldman, 1984; Miller, Wattenberg & Malanchuk, 1986). Ist ein Schema vorhanden, kann die Information schnell und effizient eingeordnet und verarbeitet werden. Diese Argumentation findet sich beispielsweise in Forschungsarbeiten zur Nachrichtenrezeption: Schemata ermöglichen den Rezipienten, die Nachrichten in einen bedeutungsvollen Kontext zu stellen und damit schnell zu verstehen. Damit kann ein effektiver Umgang mit der Fülle von massenmedial vermittelten Informationen gewährleistet werden. Die Schema-Theorie kann darüber hinaus aufzeigen, wie ein Thema von den Rezipienten repräsentiert wird: als kognitives Schema. Ebenso kann beschrieben werden, welche Schemata die Rezipienten über Wahlkandidaten haben (vgl. Miller et al., 1986). Ähnlich argumentiert die Forschung zu Genres und Gattungen: Genre-, Sender- oder Sendungs-Schemata bestimmen, welche Merkmale ein Format aufweisen muss, um sinnvoll von den Rezipienten eingeordnet zu werden (vgl. Bilandzic, 1999; Fredin & Tabaczynski, 1993; Gehrau, 2003). So beschreibt Bilandzic (1999) die selektive Fernsehnutzung als schema-geleiteten Prozess: Jedes Umschalten wird als neuerlicher Beginn eines Entscheidungsprozesses betrachtet, bei dem ein Genre-, Gattungs-, Themen- oder Sender-Schema aktiviert wird, was dann wiederum zu einer Bewertung des Gezeigten führt. Ist ein Schema für einen Stimulus vorhanden, wird dieser schneller verarbeitet, als wenn kein Schema vorhanden wäre (Bilandzic, 1999, S. 97).
Beispiel
Stellen Sie sich vor, Sie sehen in einem Nachrichtenbeitrag zwei Politiker einen roten Teppich entlanggehen. Zudem sind viele Fotografen zugegen und es erklingt feierliche Musik. Sie erkennen sofort, dass es sich um einen Staatsbesuch handelt. Da Sie dies erkannt haben, und damit das Schema Staatsbesuch aktivieren, müssen Sie nicht mehr lange und ausführlich darüber nachdenken, warum ein roter Teppich ausgerollt ist, feierliche Musik erklingt und viele Fotografen anwesend sind. Das aktivierte Schema erleichtert Ihnen die Verarbeitung der gezeigten Information (Entlastungsfunktion).
Darüber hinaus bestimmen Schemata, welche Medieninformationen wahrgenommen und erinnert werden (vgl. Coleman, 2003; Garramone, Steele & Pinkleton, 1991). Hiermit kann man beispielsweise erklären, warum Personen bei der Rekonstruktion von Nachrichten systematische Lücken aufweisen. Es werden nur die Details wiedergegeben, die dem initiierten Schema entsprechen (vgl. Kasten mit Beispielstudie).
Schließlich erklären Schemata aktive Bedeutungskonstruktionsprozesse der Rezipienten. Fragt man Rezipienten nach dem Inhalt der Medienberichterstattung, dann nennen bzw. ergänzen sie zum Teil Inhalte, die gar nicht in den Medienbeiträgen vorhanden waren. Am deutlichsten wurde diese Funktion im dynamisch-transaktionalen Ansatz herausgearbeitet (vgl. Früh, 1996). Bei der schematischen Informationsverarbeitung werden Verbindungen zwischen dem medialen Stimulus und dem bereits vorhandenen Schemata hergestellt. Beispielsweise konnte Früh (1996) zeigen, dass die kognitive Verarbeitung medialer Information stärker durch subjektive Schemata beeinflusst wird als durch die Medienstimuli.
Beispielstudie
Graber (1988). Processing the news: How people tame the information tide (2. Aufl.). New York: Longman
Graber (1988) befragte in einer qualitativen Studie mehrfach 21 Personen zur politischen Medienberichterstattung und setzte die Aussagen der Personen mit den Medienberichten in Verbindung. Die Autorin konnte zeigen, dass die Panelteilnehmer nur einen geringen Teil der Medienberichterstattung behalten bzw. dass nur wenige Fakten wiedergegeben werden konnten. Graber führt dieses Ergebnis auf die schema-geleitete Informationsverarbeitung zurück: Es werden die Informationen aus der Medienberichterstattung in bereits bestehende Schemata integriert und damit kontextualisiert. Durch die schema-geleitete Informationsverarbeitung verlieren die Informationen ihre Detailhaftigkeit und werden vergleichsweise abstrakter repräsentiert. Zudem argumentiert Graber, dass Schemata es den Rezipienten erlauben, die Vielzahl von vermittelten Informationen sinnvoll zu verstehen und zu kontextualisieren, d. h., in bereits bestehende Schemata einzuordnen. Auch werden Informationen ergänzt, die nicht in den Nachrichten genannt werden, aber zu einem aktivierten Schema passen (z. B. die Motive von Politikern).
Veränderung von Schemata
Da Schemata relativ stabil sind, stellt sich die Frage, wie sie entstehen und wie sie sich verändern können. Rumelhart (1980) und Rumelhart & Norman (1978) schlagen hierfür drei Prozesse vor: Anlagerung (accretion), Anpassung (tuning) und Neustrukturierung (restructuring). Accretion bezeichnet das sukzessive Ansammeln von Faktenwissen, z. B. beim Lernen von Telefonnummern oder Namen. Neue Informationen werden zu einem bereits bestehenden Schema hinzugefügt, ohne dass es zu strukturellen Veränderungen in der Wissensorganisation kommt. Wenn allerdings kein Schema für die neue Information herangezogen werden kann, dann ist Lernen durch Accretion nicht mehr effektiv. In diesem Fall muss entweder ein bereits bestehendes Schema modifiziert werden (tuning) oder es wird ein neues Schema gebildet (restructuring). Tuning kann auf drei verschiedene Arten erfolgen: Zum Ersten kann durch die mehrfache erfolgreiche Anwendung eines Schemas auf eine Situation das Schema stärker an die Gesamtpopulation der betroffenen Situationen angepasst werden. Zum Zweiten kann ein Schema auf neue Situationen oder Stimuli generalisiert werden, indem ein neuer Aspekt zu dem Schema hinzugefügt wird. Im Gegensatz zu dieser Art des Tunings kann zum Dritten auch die Anwendung eines Schemas wiederum nur auf ganz bestimmte Situationen beschränkt werden. Die letzte Form der Schema-Veränderung, das Restructuring, bezieht sich auf die Entstehung von neuen Schemata. Hierfür schlagen die Autoren wiederum zwei Prozesse vor: Patterned Recognition und Schema Induction. Zunächst kann durch Analogie-Lernen ein neues Schema aus einem bereits bestehenden entstehen (patterned recognition). Beim Prozess der Schema Induction wird hingegen ein neues Schema gebildet, wenn wiederholt eine vorher unbekannte Stimuluskonfiguration auftritt.
Trotz der wichtigen Impulse der Schema-Theorie für die Rezeptionsforschung blieb Kritik nicht aus (vgl. Matthes, 2004). Kritisiert wird u. a., dass der Schema-Begriff zu schwammig ist, und für jegliche empirische Befunde herangezogen werden kann. Auch die Annahme, dass die Rezipienten für viele Nachrichten, Sendeformen, Personen, Genres, Werbegattungen etc. in ihrem mentalen Schubladensystem vorgefertigte, abrufbare Schemata bereithalten, zeichnet ein etwas zu einfaches Bild von Informationsverarbeitungsprozessen. Es gibt kein Element eines kognitiven Netzwerkes, das nur einem einzigen Schema angehören kann. Das kognitive Netzwerk ist plastischer und dynamischer aufzufassen, es ist ständig in Veränderung.
2.3.3 Konnektionistische Modelle
Bei der Schema-Theorie geht es in erster Linie um die Aktivierung bzw. den Abruf eines vorher abgespeicherten Schemas: Ein Schema wird entweder aktiviert oder nicht aktiviert. Wird ein Schema gefunden, wird es in derselben Form abgerufen, in der es vorher abgespeichert wurde – ähnlich einer Datei in einem Computer. Für viele Kognitionsforscher ist die Auffassung zu statisch, um menschliche Informationsverarbeitung adäquat zu beschreiben (vgl. Anderson, 1977; Smith, 1996; Wirth, 1997). Es ist unwahrscheinlich, dass ein Element eines kognitiven Netzwerkes nur einem einzigen Schema angehört. Das kognitive Netzwerk ist gemäß dieser Auffassung plastischer und dynamischer. Ausgangspunkt dieser sogenannten konnektionistischen Sichtweise ist der Versuch, auf der Grundlage von Computersimulationen Erkenntnisse über kognitive Prozesse zu erhalten. Kognitive Prozesse werden so modelliert, dass sie dem zugrunde liegenden biologischen Vorbild weitestgehend ähnlich sind. Es geht um eine neuronal inspirierte Modellbildung kognitiver Prozesse (vgl. Pospeschill, 2004, S. 17). Konnektionistische Modelle gehen von adaptiven informationsverarbeitenden Systemen aus, die sich aus einer Vielzahl von Verarbeitungseinheiten (units) zusammensetzen und Signale in Form von Aktivierungsmustern über gerichtete Verbindungen übertragen. Dies ist als eine grobe Analogie zum biologischen Nervensystem aufzufassen, bei dem Informationsverarbeitung durch einen Verbund von Nervenzellen realisiert wird. Vereinfacht ausgedrückt, werden Informationen als Aktivierungsmuster einzelner Einheiten repräsentiert. Diese Units sind in einem Netzwerk von Verbindungen miteinander verknüpft. Damit wird vom strukturellen Aspekt der Informationsverarbeitung Abstand genommen. Wissen wird nach dieser Auffassung nicht in Form von lokalen Symbolträgern wie Schemata gespeichert, sondern es entsteht gewissermaßen als Aktivierungsmuster einzelner neuronaler Elemente. Die Repräsentation von Wissen ist dabei distributiv, aktiv und sie kann sich über Aktivierungsmuster weiter verändern. Ein entscheidender Unterschied zur Schema-Theorie ist die massiv parallele, d. h. gleichzeitige, Aktivität vieler Units. Ferner verläuft die Informationsverarbeitung nicht nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip: Das Informationsverarbeitungssystem muss nicht entscheiden, ob dieses oder jenes Schema herangezogen wird.
In einem konnektionistischen Netzwerk könnte man zwar so etwas wie ein Schema modellieren, wenn ein bestimmtes neuronales Muster mehrmals aktiviert und daher stabilisiert wird. Aus konnektionistischer Sicht wird ein Schema nicht mehr gespeichert, gelagert und abgerufen. Damit wird ein flexibleres Bild von Informationsverarbeitungsprozessen gezeichnet (Smith, 1996; Wirth, 1997). Zudem ist dieser Ansatz erklärungskräftiger, wenn es um das Lernen von neuen Informationen geht.
2.3.4 Mentale Modelle
Einen weiteren prominenten Ansatz zur mentalen Repräsentation von Informationen bilden mentale Modelle. Mentale Modelle enthalten Vorstellungen über komplexere Teilbereiche der Realität, die sich aber nicht nur auf Strukturen beziehen können, sondern auch auf (komplexe) Prozesse (vgl. ausführlicher Wirth, 1997). Mentale Modelle beinhalten Realitätsbereiche, die aufgrund ihrer Komplexität relativ unanschaulich sind, beispielsweise Problemsituationen oder unsere Vorstellungen über die Funktionsweise von elektrischem Strom oder eines Autos. Im Vergleich zu den vorher erwähnten Repräsentationen können mentale Modelle vor allem Problemlöseverhalten erklären. Im Unterschied zu Schemata sind mentale Modelle zudem flexibel und leicht änderbar. Mit mentalen Modellen wird ein komplexer Prozess vor dem inneren Auge simuliert (z. B. die Vorstellung einer Wohnung). In der Rezeptionsforschung erklären mentale Modelle, wie Rezipienten Nachrichteninformationen oder beispielsweise auch zeitlich strukturierte Geschichten verstehen und repräsentieren. Sie können beispielsweise ein mentales Modell über diesen Text ausbilden – den Text mit seiner Vielzahl an Informationen speichern sie zusammenfassend als Textrepräsentation ab. Dies nennt man ein mentales Modell.
2.4 Erinnerung, Abruf und Vergessen
Das Erinnern beinhaltet den Abruf von gespeicherten Informationen aus dem Gedächtnis. Dabei wird das assoziative Netzwerk nach spezifischen Informationen abgesucht und diese werden reaktiviert. Mit Reaktivierung meinen wir die Übertragung ins Arbeitsgedächtnis. Wovon hängt die Erinnerung von Medienbotschaften nun ab? Hierfür gibt es eine Reihe von Befunden, aus denen wir im Folgenden die wichtigsten herausgreifen.
Grundsätzlich zeigt sich, dass die Inhalte besser erinnert werden können, die ausführlicher und tiefer verarbeitet wurden (Lang, 2000). Dazu gehören Prozesse wie Interpretieren von Informationen, Nachdenken bzw. Elaborieren über Informationen, das Wiederholen von Informationen, das eigene Generieren von Wissenseinheiten sowie das metakognitive Überwachen und Steuern des eigenen Wissenserwerbs (vgl. ausführlicher Renkl, 2009). Es spielt also eine entscheidende Rolle, wie gründlich und sorgfältig die Informationsaufnahme erfolgt ist. Bei der Medienrezeption ist es durchaus denkbar, dass Informationen weniger sorgfältig verarbeitet und aufgenommen werden (vgl. Lang, 2000). Beispielsweise widmen wir uns beim Medienkonsum den Inhalten nicht immer mit voller Aufmerksamkeit (z. B. Zeitunglesen beim Frühstück während das Radio läuft). Oder eine Botschaft benötigt mehr Ressourcen, als uns zur Verfügung stehen, z. B. bei einem Nachrichtenbeitrag über Steuerpolitik nach einem anstrengenden Arbeitstag.
Aus dem oben beschriebenen assoziativen Modell des menschlichen Gedächtnisses geht auch hervor, dass die Erinnerung an einen Gedächtnisinhalt stärker ist, je mehr assoziative Verbindungen zu diesem Inhalt bestehen, also je stärker der Inhalt mit anderen Inhalten vernetzt ist (vgl. Lang, 2000). Weiterhin hängt die Erinnerung von der Reihenfolge der Darbietung ab. Die Kognitionsforschung hat gezeigt, dass vor allem zuerst genannte und zuletzt genannte Informationen am besten erinnert werden. Dies nennt man auch Primacy- bzw. Recency-Effekt. Dies lässt sich vereinfacht dadurch erklären, dass zuletzt genannte Informationen noch im Arbeitsgedächtnis abrufbar sind und daher leicht erinnert werden können. Die zuerst genannten Informationen hatten dagegen die insgesamt längste Verarbeitungszeit und damit die besten Chancen, ins Langzeitgedächtnis zu gelangen (vgl. ausführlicher Pieters & Bijmolt, 1997). In der Werbeforschung wurde beispielsweise nachgewiesen, dass Werbespots am Anfang und am Ende eines Blocks tatsächlich bessere Erinnerungschancen haben als die Spots, die in der Mitte ausgestrahlt werden (vgl. Pieters & Bijmolt, 1997; Zhao, 1997).
Merksatz
Menschen erinnern sich besser an Medieninformationen, wenn die gezeigten Informationen bereits stark mit anderen Konzepten im Gedächtnis verknüpft sind, wenn die Informationen am Anfang oder am Ende einer Sequenz gezeigt wurden, wenn die Informationen mit Emotionen verknüpft sind und wenn die Informationsaufnahme gründlich und motiviert erfolgt ist.
Auch können durch Medienbeiträge induzierte Emotionen die Erinnerungsleistung fördern. Studien zeigen, dass Emotionen die Verarbeitung und Abspeicherung einer Botschaft intensivieren können (vgl. Bradley, Angelini & Lee, 2007). Dies spielt vor allem im Kontext emotionalisierter Nachrichten, Werbungen oder Kampagnen eine Rolle.
Schließlich stellt sich die Frage, warum Menschen Informationen aus den Medien wieder vergessen und sie nicht mehr abrufen können. Obwohl es vorkommen kann, dass Informationen gewissermaßen gelöscht werden oder verfallen, ist es wahrscheinlicher, dass wir beim Vergessen nicht mehr auf eine gespeicherte Information zugreifen können, obwohl sie prinzipiell noch vorhanden ist. Vereinfacht kann man zwei Gründe ausmachen, warum Informationen aus den Medien vergessen werden. Erstens werden Informationen schwerer zugänglich, wenn sie über eine längere Zeit nicht mehr aufgerufen werden. Im assoziativen Netzwerk des Gedächtnisses wird die Suche nach diesen Informationen mit der Zeit schwieriger und daher ihre Aktivierung unwahrscheinlicher. Zweitens können zusätzlich aufgenommene Informationen den Zugriff auf die bereits gelernten Informationen behindern. Das kann passieren, wenn neue Informationen sehr ähnlich zu den bereits gespeicherten Informationen sind.
2.5 Zusammenfassung
In diesem Kapitel haben wir die wichtigsten Grundkonzepte der menschlichen Informationsverarbeitung von der Informationsaufnahme über die Speicherung bis hin zum Abruf kennengelernt. Wir haben gesehen, dass die Wahrnehmung von Medieninformation zwar schnell und automatisch abläuft, die Aufmerksamkeit für Medienreize jedoch willkürlich und bewusst gesteuert oder unwillkürlich und den Medienreizen folgend ablaufen kann. Die Ressourcen, die wir für die Informationsaufnahme, die Speicherung und den Abruf von Medieninformationen aufbringen können, sind aber nicht unendlich, sondern begrenzt. Je mehr kognitive Ressourcen auf einer Stufe verwendet werden, desto weniger ist für die anderen Stufen verfügbar. Zudem kann es auch sein, dass die vom Rezipienten zur Verfügung gestellten Ressourcen nicht ausreichen, um den Medieninhalt zu verstehen (beispielsweise wenn man wenig Ressourcen für die Radionachrichten verwendet, diese dann aber auch nicht mehr richtig versteht). Gespeichert werden Medieninformationen im Langzeitgedächtnis, dass wir uns als assoziatives Netzwerk von Gedächtnisinhalten vorstellen können. Die Gedächtnisinhalte sind untereinander durch Assoziationen verknüpft. Bestehende Gedächtnisinhalte, die als Schema vorliegen können, steuern die Aufnahme, die Interpretation und Speicherung von neuen Informationen. Was den späteren Abruf der Informationen betrifft, so werden die Informationen leichter erinnert, die stark mit anderen Konzepten im Gedächtnis verknüpft sind, die in der Rezeptionssituation am Anfang oder am Ende gezeigt wurden, die mit Emotionen verknüpft sind, und diejenigen, bei denen die Informationsaufnahme gründlich und motiviert erfolgt ist.
In der Medienrezeptionsforschung werden die hier vermittelten Kenntnisse aber nicht losgelöst von anderen Prozessen betrachtet. Vielmehr benötigen wir zum Verständnis der Medienrezeption einen umfassenden Blick auf das Zusammenspiel verschiedener Phänomene. Beispielsweise müssen neben den kognitiven Prozessen auch emotionale Vorgänge betrachtet werden, die keineswegs losgelöst von kognitiven Prozessen ablaufen. Dies ist beispielsweise in der Unterhaltungsforschung zentral. Auch sind die hier eingeführten Grundlagen ein wichtiges Fundament für zentrale Fragestellungen der Medienrezeptionsforschung wie die unterschiedliche Verarbeitung auditiver, visueller, textueller, audiovisueller oder interaktiver Stimuli. Ebenso bauen Forschungsarbeiten zu Einstellungen, Urteilen und Heuristiken sowie zu parasozialen Interaktionen auf den hier vermittelten Kenntnissen auf. Kognitive Prozesse wie Wissenserwerb sind oftmals die Grundlage für die Ausbildung oder Änderung von Einstellungen, wie sie beispielsweise in der Werbeforschung oder politischen Kommunikationsforschung untersucht werden.
Übungsaufgaben
1 Erklären Sie den Unterschied zwischen willkürlicher und unwillkürlicher Aufmerksamkeit. Wählen Sie ein Beispiel aus Ihrer täglichen Medienrezeption.
2 Stellen Sie sich vor, die Rezipienten werden stark mit Berichterstattung über das Thema Einwanderung konfrontiert. Erklären Sie an diesem Beispiel den Prozess des Primings. Was könnte Priming in diesem Kontext vorhersagen?
3 Erklären Sie mit Hilfe der Schema-Theorie, wie Menschen reagieren, wenn ihre Erwartungen bei einem Kinofilm in Bezug auf das Genre nicht erfüllt werden. Welche Konsequenzen hat das für die Verarbeitung und Aufnahme von Informationen während des Filmes?
4 Studien zeigen, dass in der Regel nur ein geringer Anteil der Fernsehnachrichten von den Rezipienten erinnert wird. Welche Erklärungen gibt es hierfür? Denken Sie dabei an die alltägliche Rezeptionssituation, die Funktionsweise des menschlichen Gedächtnisses sowie an Aufmerksamkeitsprozesse.
Zum Weiterlesen

Lang, A. (2000). The limited capacity model of mediated message processing. Journal of Communication, 50(1), 46–70.
Diesen Aufsatz kann man als Grundlagentext zur kognitiven Verarbeitung von Medieninhalten begreifen. Die Erkenntnisse und Befunde aus der Kognitionspsychologie werden für die Verarbeitung von Medienreizen aufbereitet und ausführlich erklärt.
Wirth, W. (2001). Aufmerksamkeit im Internet: Ein Konzept- und Theorieüberblick aus psychologischer Perspektive mit Implikationen für die Kommunikationswissenschaft. In K. Beck & W. Schweiger (Hrsg.), Attention Please! Online-Kommunikation und Aufmerksamkeit (S. 69–89). München: Reinhard Fischer Verlag.
Dieser Aufsatz schlägt eine Brücke zwischen der Beschäftigung mit Aufmerksamkeit in der psychologischen Forschung und der Rolle von Aufmerksamkeit bei der Medienrezeption. Insbesondere die Implikationen der psychologischen Grundlagentheorie für die kommunikationswissenschaftliche Forschung sind sehr lesenswert.
1 Das Kapitel beinhaltet Passagen des Kapitels »Kognition« von Jörg Matthes aus dem Buch »Handbuch Medienrezeption« (2014, hrsg. von Carsten Wünsch, Holger Schramm, Volker Gehrau und Helena Bilandzic), Nomos-Verlag. Wir danken Verlag und Autor für die Freigabe und die freundliche Kooperation.