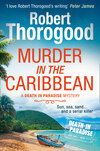Kitabı oku: ««Dies Kind soll leben»»

Schöffling & Co.

Helene Holzman, um 1950.
Erstes Heft
Vitam non mortem recognita
Dreimal schlug das Wasser Wellen,
Dreimal tauchtest du empor,
Dreimal hätt’ ich retten können,
Doch ich habe blind versagt.
Lautlos zogest du von hinnen,
Lautlos folg ich deiner Spur,
Lautlos glätten sich die Kreise,
Du und ich verrinnen beid.
Edwin Geist: Requiem
19. Juni 1941. Wir hatten nach langem Suchen endlich eine Wohnung [in Wilna] gefunden und schließlich auch ein Fuhrwerk, mit dem wir unsere Koffer und unsere anderen Habseligkeiten dorthin geschafft hatten, und fuhren mit dem Abendzuge [zurück] nach Kaunas.
Die neue Wohnung bestand aus einem einzigen Zimmer in einem altmodischen Hause unweit vom Bahnhof und war ein schlechter Tausch gegen unsere schöne, blanke Kaunaer Wohnung. Wir hatten uns aber schon damit abgefunden und uns ausgedacht, wie wir den großen Raum einteilen würden, so daß jeder seinen Platz darin haben würde. Im Sommer könnte man sich auf dem weiten, großen steinernen Altan aufhalten, der zu dem Zimmer gehörte, von dem man in die stille Straße und einen weiten Garten mit mächtigen Bäumen sah. Im Winter würden wir uns alle vier um den großen Kachelofen drängen, und die Abende würden warm und gemütlich sein.
Wir waren auf dieser zweistündigen Fahrt von Wilna nach Kaunas sehr vergnügt und voller Pläne. Wir hatten, nachdem unsere Buchhandlung» Pribačis «in Kaunas, die wir in fast zwanzig Jahre langer Arbeit aufgebaut hatten, nationalisiert worden war1, beide Arbeit in Wilna gefunden – mein Mann als Leiter eines großen staatlichen Antiquariats, ich als Lehrerin für Deutsch am Pädagogischen Institut. Einige Monate lang waren wir mehrmals in der Woche zwischen Kaunas und Wilna hin und her gefahren. Jetzt sollte das unbequeme Leben aufhören. Die beiden Mädchen hatten ihr Schuljahr beendet, und wir wollten alle zusammen in Wilna leben.
Im Abteil mit uns fuhr ein hoher Polizeifunktionär. Wir fragten ihn, ob er den Gerüchten über Truppenansammlungen des deutschen Heeres an der litauischen Grenze Wert beilege. Er lachte uns aus. Weder die Deutschen noch die Russen seien für einen gegenseitigen Krieg vorbereitet. Er selbst habe gerade Ferien bekommen und wolle auf die Kurische Nehrung fahren. Diese Nachricht beruhigte uns völlig. Wir wandten unsere Gedanken wieder unseren eigenen Angelegenheiten zu.
Zu Hause wurden wir mit großem Jubel empfangen.2 Marie hatte ihr Abitur gut bestanden – keine Kleinigkeit in der Abendschule neben der Tagesarbeit im Büro. Gretchen hatte auch gute Zensuren. Beide Mädchen freuten sich auf den Umzug in die neue Hauptstadt3, und wir alle [waren froh], daß wir wieder zu viert zusammen wohnen würden. Bevor wir unsere Möbel packten, wollten wir noch ein Abschiedsfest geben und alle Kaunaer Freunde dazu einladen. Keinem von uns kam eine Ahnung, daß dies die letzte fröhliche Stunde war, die wir zusammen verlebten.
Am nächsten Morgen schwirrten schon die Straßen von der Kriegserklärung Deutschlands an die Sowjetunion. Unsere Freunde, Doktor Zinghaus mit seiner Frau, kamen zu uns. Wir waren zunächst alle ganz fassungslos und in keiner Hinsicht darauf vorbereitet. Doktor Zinghaus, der mit seinen Eltern drei Jahre vorher aus Berlin geflüchtet war, sprach gleich von der Notwendigkeit, nach dem Innern der Sowjetunion zu flüchten. Die Sowjets seien nicht auf den Krieg vorbereitet und wahrscheinlich nicht imstande, die Front in Litauen zu halten.
Die ersten Bomben fielen. Die Bevölkerung beklebte ihre Fenster mit Papierstreifen. Unsere Freunde gingen nach Hause, um ihre Eltern zu holen, da sie sich in ihrer Wohnung nahe der Funkstation zu gefährdet glaubten.
Ich ging aus, um zum Mittagessen einzukaufen. Vor den Läden standen die Menschen in langen Schlangen. Jeder wollte noch schnell etwas erraffen. Sie standen dicht an die Häuser gedrückt, denn überall krachten die Bombeneinschläge, stiegen Rauchwolken auf, und mancher Straßengänger wurde von Splittern verletzt. Auf der Heeresstraße zogen die Soldaten westwärts nach der Front, immer neue, zu Fuß, mit Geschützen, zu Pferde.4 Mein Blick fiel zufällig auf einen kindlich jungen Reiter, der mit hellem Blick geradeaus sah. Werdet ihr der Wucht des Feindes widerstehen? Wißt ihr, ahnt ihr es, welche Gewalten gegen euch aufgestanden sind?
Die verschiedensten Gerüchte wurden laut. Memel sei bereits in den Händen der Sowjets. Nein, im Gegenteil, die Deutschen seien schon in Marijampole. Zu Hause waren alle sehr aufgeregt. Doktor Zinghaus war unterdessen im Nachrichtenbüro gewesen: Ja, der Feind rücke heran.
Er war nun da, der bange Augenblick, den wir schon seit vielen Jahren für möglich gehalten, den wir hundertmal mit den Freunden erwogen hatten, ohne an sein Herannahen ernstlich zu glauben. Während acht Jahren hatte sich der Nationalsozialismus gespenstisch immer mehr aufgebläht. Wir sahen bei unseren Reisen nach Deutschland, wie er die Menschen verdarb, verdummte, durch einen verlogenen Scheinsozialismus die Menschen betrog und [wie] der irre Antisemitismus immer erbarmungsloser Tausende von Deutschen, so gute Deutsche wie alle andern, hinwegmähte, nur weil sie nach der neuen Wahnidee keine» Arier «waren.
Die Volksdeutschen5 aller Länder waren von dem Wahn infiziert worden. Ich erlebte, wie meine Kollegen im Kaunaer Deutschen Gymnasium, die sich bis jetzt munter Demokraten genannt hatten, dem Massenwahn verfielen. Während der zehn Jahre, die ich dort Lehrerin gewesen war, hatten deutsche, jüdische, litauische, russische, polnische Knaben und Mädchen in fröhlicher Gemeinschaft die Schule besucht. Auch die Lehrer waren ein buntes Volksgemisch, und keinem war es je eingefallen, es sich anders zu wünschen.
Was geschah nun im Jahre 33? Die Deutschen, die bis jetzt im litauischen Staat blühten und gediehen, waren auf einmal unzufrieden. Sie fanden auf einmal, daß man sie unterdrücke. Man erkenne sie nicht an, man müsse sich neue Rechte verschaffen. Nach den ersten Pogromen in Berlin6 traten die jüdischen Schüler aus dem Gymnasium aus. Das war erst recht ein Grund für die Deutschen, ihren erwachten Antisemitismus zu nähren. Aus unserer Buchhandlung, die von Litauern, Juden, Deutschen gleichmäßig besucht wurde, zogen sich die deutschen Kunden zurück. Mein Mann, der bis jetzt für jeden ein Deutscher gewesen war, war auf einmal für die Deutschen keiner mehr – er war Jude.7
Die litauische Intelligenz kümmerte sich im allgemeinen nicht viel um diese Probleme. Unsere litauischen Freunde und Kunden blieben dieselben, und es gelang uns, die litauische Staatsangehörigkeit zu erwerben, die uns auch bei unseren Reisen durch Deutschland schützte.8 Als 1940 der litauische Staat eine Republik der Sowjetunion geworden war und die Deutschen in ihrer Gesamtheit» heim ins Reich«9 gewandert waren, hatten die Anfechtungen, unter denen wir und die Kinder gelitten hatten, aufgehört. Wir waren Menschen unter Menschen.10
Wir saßen, wie gestern abend, in unserer schönen Stube, vor uns Marie und Gretchen, schwesterlich einander ähnelnd. Die gestrigen Pläne waren zerflogen. Was tun? Ins Innere Rußlands flüchten? Wir konnten kein Russisch. Nein, wir wollten hier bleiben, vor allem zusammenbleiben, sich keinesfalls trennen. So würden wir auch schwere Zeiten überwinden.
Am Nachmittag begannen wir, zusammen mit unserem Wirt vor dem Haus einen Schützengraben zu graben. Max als erfahrener Weltkriegssoldat gab die Direktiven.
Freund Edwin Geist11, der Komponist, kam mit seiner Frau: Ob sie bei uns übernachten könnten? Leider nein, denn schon alle vier Zinghaus waren bei uns.
Am nächsten Mittag entschlossen sich Zinghausens, mit einem Zug, der auf dem Bahnhof bereit stand, in Richtung Minsk zu flüchten. Sie wollten nach Hause laufen, um in Eile kleine Köfferchen mit dem Nötigsten zu packen, und dann sofort zum Bahnhof eilen. Sollten wir nicht doch mitkommen? Wir sagten nein. Eiliger Abschied.
Nach einigen Stunden kamen die Eltern Zinghaus zurück. Sie seien zusammen in den überfüllten Zug eingestiegen. Immer neue Menschen hätten sich hineingedrängt, sich auf die Waggons gesetzt, an die Tür gehängt. Da habe sie, die Alten, eine solche Furcht vor dieser Fahrt ins Ungewisse überkommen, daß sie sich von ihren Kindern, die keinesfalls von ihrem Fluchtplan ablassen wollten, getrennt hätten und wieder ausgestiegen seien. Da saßen sie wieder bei uns. Der alte Herr, schon siebzig Jahre und gebrechlich, mit den dichten, borstigen weißen Haaren, weinend wie ein Kind, und seine Frau war besorgt um ihn und weinte auch, und wir trösteten sie.
Unsere Alten hatten aber keine Ruhe. Nach einigen Stunden beschlossen sie, noch einmal zum Bahnhof zu gehen. Vielleicht war der Zug noch nicht abgefahren, und sie könnten ihre Kinder noch einmal sehen und ihnen noch etwas Geld mitgeben. Sie kamen am Abend nicht zurück. So sind die Alten also doch mitgefahren, dachten wir und gelobten uns zum wiederholten Mal, auf jeden Fall zusammenzubleiben, komme, was wolle.
Dann kam der Dienstag.12 Auf den Straßen vollzog sich die Revolution. Ein bewaffnetes Heer, Zivilkleider, eine Binde am Arm, war aus dem Boden gewachsen, die Partisanen.13 Wir hatten keine Vorräte im Haus, und ich ging einholen. Wieder standen lange Schlangen vor den Läden. Überall knallte, dröhnte es. Das Heer der Rotarmisten füllte die Straße, diesmal als Rückzügler. Unter den schnell reitenden Kavalleristen glaubte ich wieder den jungen Reiter zu erkennen, der vor zwei Tagen westwärts geritten war. Der deutsche Einfall war gelungen. Drei entsetzliche Jahre mußten vergehen, ehe die Rote Armee durch diese Straße wieder hergezogen kam – als Sieger.
Ganz in der Nähe platzte eine Bombe. Ich stand in der Menge an eine Hauswand gedrückt. Da sah ich Max kommen. Er fand es zu gefährlich, auf der Straße zu stehen, und holte mich ab.
Dem deutschen Heer war der schreckliche Geier, der Judenhaß, mit schwarzen Schwingen vorangeflogen. Schon bevor die deutschen Soldaten einrückten, hatten die Partisanen ihre antisemitischen Befehle bekommen. Viele von den Juden, die in diesen Tagen noch zu fliehen versuchten, [wurden] von den Partisanen aufgehalten, festgenommen oder zur Rückkehr gezwungen. Ein furchtbarer Anblick: die Züge von Juden, die aus der Stadt flüchteten. Die Kühneren, auf Fahrrädern, wollten ins Innere Rußlands. Viele gedachten, nun in die Provinz zu ziehen. Vielleicht hofften sie dort auf mehr Schutz durch die litauische Bevölkerung, denn gerade auf dem Lande waren die Beziehungen zwischen Litauern und Juden oft sehr freundlich gewesen.
Marie wollte am Nachmittag durchaus zur Mutter eines Freundes gehen, der geflüchtet war und ihr Grüße für die Mutter aufgetragen hatte.14 Ich wollte sie begleiten, damit sie nicht allein geht. Unsere Straße war menschenleer. Von allen Seiten tönten Schüsse. Als wir in die breite Straße einbogen, die vom Grünen Berge15 in die Stadt führt, rief uns ein Partisan an:»Was habt ihr auf der Straße zu suchen?«– Wir hätten einen wichtigen Gang. Er solle uns vorbeilassen.
Da erkannte er Marie.»Bist du nicht die Kommunistin? Warte, dir wird es jetzt schlecht ergehen.«16 Aber er ließ uns weitergehen. Wir stiegen einen kleinen Treppenpfad direkt zur Stadt hinunter. Unten wieder ein Partisan. Er ließ uns nicht durch, und wir mußten umkehren.
Mein Mann hatte sich schon Sorgen um uns gemacht. Noch einmal freuten wir uns, wieder vereinigt zu sein, und wir nahmen uns vor, ein paar Tage gar nicht auszugehen und erst einmal abzuwarten. Am Abend ließen die Deutschen eine große weiße Leuchtkugel aufsteigen zum Zeichen, daß die Stadt eingenommen war.
Mittwoch (25. Juni).17 Mein Mann hielt es nicht zu Hause aus. Er wollte in den Staatsverlag, dessen Angestellter er war, gehen und sich besprechen. Wir hatten von privilegierten Mischehen in Deutschland gehört. Mein Mann war im Leipziger Buchhändlerbörsenverein bis zuletzt ein hochangesehenes Mitglied. Aus Holland wußten wir, daß Juden zum Teil in Stellungen belassen waren, und wenn nicht, so würde ich doch wahrscheinlich weiter Lehrerin sein können.
Er und Marie gingen zusammen fort. Ich sollte unterdessen etwas zu Mittag kochen. Ich ging in den Garten, sammelte Brennesseln und Ackermelde für Spinat. Im Keller waren Kartoffeln. Als ich vom Garten heraufkam, standen die beiden alten Zinghausens vor der Tür.
Sie waren völlig erschöpft und verzweifelt. Als sie am Montag auf den Bahnhof gekommen sind, war der Zug schon abgefahren. Im Augenblick, wie sie zurückgehen wollten, wurde der Bahnhof bombardiert. Sie flüchteten mit vielen andern Menschen in einen Hauskeller, wo sie die Nacht und auch den folgenden Tag und die Nacht unbequem sitzend verbrachten. Die Straßen um den Bahnhof wurden gesperrt. Für Zivilisten war kein Durchkommen möglich. Sie konnten in ihrem Versteck Wasser bekommen und auch ein paar Semmeln kaufen. Am Morgen wollten sie dann in ihre Wohnung gehen.
Der Hausmeister wollte sie nicht hereinlassen. Man hätte geglaubt, daß sie geflohen seien, und die Wohnung sei bereits von deutschen Offizieren beschlagnahmt. Nach vielem Bitten und einem großen Trinkgeld erklärte er sich schließlich bereit, sie einzulassen. Sie fanden ihre Wohnung vollständig ausgeplündert. Alle Schränke waren ausgeräumt, alle Wäsche, Kleider, Schuhe, Betten, Decken, alles Geschirr und Küchengerät verschwunden. Im eingebauten Küchenschrank fanden sie ein paar einzelne Teller und Messer und Gabeln. Der Hausmeister vertrieb sie bald mit groben antisemitischen Beschimpfungen, und so waren sie wieder zu uns gekommen.»Wir waren wohlhabende Leute, jetzt sind wir von einem Tag zum andern Bettler geworden.«
Während sie sich wuschen und ausruhten, kochte ich schnell Mittagessen. Wo blieben nur mein Mann und Marie so lange? Ich lief vor Ungeduld auf die Straße, bis zur Hauptstraße. Dort stand ich und wartete, wartete – anfangs nur ärgerlich, daß sie so säumten, aber allmählich mit immer wachsender Angst. Ich sah die ersten deutschen Soldaten. Um einen hatten sich Leute versammelt. Er erzählte laut, wie er versteckte Russen aufgefunden und umgebracht hätte.»Und die Juden? Ich sehe ja gar keine. Sie haben sich wohl alle davongemacht oder in ihren Schlupfwinkeln versteckt. «Alle lachten laut und roh. Der Soldat trug den Hals weit ausgeschnitten und ein buntes Halstüchlein. Ich sah das zum ersten Mal.
Es war drei Uhr. Ich lief nach Hause, bewirtete die beiden alten Gäste, zwang mich, auch zu essen, um sie nicht mit meiner Angst aufzuregen. Vor Gretchen konnte ich sie nicht verbergen. Noch immer kommen unsere beiden nicht. Ich lief in die Stadt herunter. Schon vom Berg sah ich die Hakenkreuzfahne auf dem Kriegsmuseum wehen. Die Laisves Allee18 voller Menschen. Die deutschen Soldaten wurden enthusiastisch als» Befreier «begrüßt. Alle Menschen waren erregt und die meisten vergnügt.
Ich traf den Rechtsanwalt Stankevičius mit seiner Tochter.»Haben Sie meinen Mann gesehen?«Er wurde sofort bedenklich. Es seien viele Juden auf der Straße verhaftet.
Ich jagte durch alle Straßen, fragte alle Bekannten, keiner hatte die beiden Unseren gesehen. Dann hetzte ich wieder nach Hause. Vielleicht sind sie unterdessen gekommen? Nichts. Den Gästen Abendbrot gemacht, ein wenig gesprochen, wieder auf die Straße, bis es dunkel wurde.
Am nächsten Tag hörte man von allen Seiten von großen Judenverfolgungen. Aufrufe: Juden hätten auf deutsche Soldaten geschossen. Für jeden getöteten Soldaten werde man 100 Juden töten. Die Zeitungen, Flugblätter enthielten fast nichts anderes als die furchtbarsten antisemitischen Exzesse.
Ich lief zur litauischen Polizei, traf vor der Tür einen litauischen Kriminalbeamten, der meinen Mann gut kannte. Er versprach, sich zu erkundigen, wo die Meinen seien, und mir Nachricht zu geben. Er hat nichts von sich hören lassen. Ich traf ihn später noch oft. Er vermied [es], mit mir zu sprechen.
Drei Tage lief ich so umher, zu Hause die beiden alten Freunde, die auch getröstet werden wollten. Gretchen half mir überall. Wir verstanden uns ohne Worte. Am dritten Tag ging mittags das Telefon. Marie!» Mutti? Ich bin da. Ist Vater bei euch? Ich komme gleich nach Hause.«
Unsere alten Freunde umarmten mich. Ich sagte aber gleich, es ist ein schlechtes Zeichen, daß Marie allein da ist. Da war sie schon, die gute Marie, erhitzt, verschmutzt und mit leuchtenden Augen. Erst einmal sich waschen, duschen, sich umziehen und dann ordentlich essen. Aber beim Essen kann man schon erzählen.
«Als wir auf der Laisves Allee gingen, rief ein Partisan, der mein Kollege in ›Sodyba‹19 gewesen war: ›Du bist die Kommunistin, jetzt bekommst du deine Strafe dafür. Wer ist der Herr? Dein Vater? Er soll auch gleich mitkommen.‹ Man führte uns beide in das Polizeirevier. Dort wurden wir getrennt. Vater rief mir zu: ›Wer zuerst von uns freikommt, wird sich anstrengen, den andern freizubekommen!‹ Dann sah ich den Vater nicht mehr. Ich wurde mit vielen andern Frauen ins Gefängnis gebracht. Wir wurden alle zusammen in einen großen Raum gesperrt. Eine ältere Frau, die man als Kommunistin verhaftet hatte, gefiel mir besonders. Sie tröstete die andern und war so heiter und sicher, daß [sie] sich beruhigten. Auf der Erde lag Stroh als Lager. Man bekam mittags Suppe, früh Kaffee und Brot. Ich konnte nicht essen, dachte nur immer an euch und die Sorgen, die ihr euch um uns macht. Am zweiten Tag sagte ich zu dem Beamten, der zur Inspektion hereinkam: ›Ich bin Deutsche. Man hat mich aus Versehen verhaftet. Laßt mich sofort frei.‹ Man rief einen deutschen Polizeibeamten, auf den ich so lebhaft auf deutsch einsprach, daß er sich überzeugen ließ. Er sagte: ›Morgen kommen Sie frei.‹ Heute gegen zehn rief man mich und fragte noch mal, ob ich wirklich Deutsche sei. Dann ließ man mich frei.«
Da war es nun wieder, mein Sorgenkind, saß vor meinen Augen in der Küche und aß mit großem Appetit ihre Butterbrote.»Nun müssen wir den Vater erlösen.«
Ich lief noch am selben Tag in die deutsche Sicherheitspolizei.»Tritt nur recht sicher auf als Deutsche«, hatte mich Marie gelehrt. In einem Anmeldezimmer mußte ich lange warten, dann kam ein Beamter und fragte mich genau aus. Eine Deutsche im Ostgebiet ist verdächtig, denn die Deutschen waren alle ins Reich repatriiert.»Aha. Also wegen des jüdischen Mannes sind Sie hiergeblieben. Bringen Sie morgen ein schriftliches Gesuch um Befreiung Ihres Mannes.«
Am nächsten Tag ein neuer Beamter. Wieder alle Fragen von neuem.»Lassen Sie das Gesuch hier, wir werden uns erkundigen, ob Ihr Mann im Gefängnis ist. Kommen Sie übermorgen wieder.«
Übermorgen – da wußte kein Mensch etwas von meinem Gesuch. Wieder lauter andere SS-Beamte. Wieder alle Fragen von neuem.
Ich hatte die Stammrolle meines Mannes mitgebracht, aus der hervorging, daß er im Weltkrieg von August 1914 bis zum Kriegsende deutscher Soldat gewesen war und welche Ehrenzeichen er damals bekommen hatte. Der SS-Beamte warf einen Blick darauf, schob es mir hin und schnarrte:»Das können Sie sich wieder einstecken. Interessiert uns nicht. Jude bleibt Jude. Kommen Sie in ein paar Tagen wieder. «So ging es nicht.
Der Rechtsanwalt Stankevičius, der meinen Mann gut kannte und sehr schätzte, versprach, seinerseits einen Versuch zu machen. Er reichte zusammen mit Prof. P. [?] und dem Rechtsanwalt T. [?], alle drei bekannte Männer, eine offizielle Bitte um Befreiung meines Mannes ein, der eine sehr angesehene, politisch einwandfreie und von allen geschätzte Persönlichkeit sei, so daß seine Verhaftung nur auf einem Irrtum beruhen könne. Dieses Gesuch brachte er selber auf die Sicherheitspolizei. Es ist nie beantwortet worden.
Das nächste Mal traf ich in der Polizei einen Beamten, der mein Schüler im Deutschen Gymnasium gewesen war. Er gab mir die Hand. Das war ungewöhnlich, denn diese Beamten vermeiden das sonst. Er schickte mich zu einem andern Beamten. Man wußte weder etwas von meinem Gesuch noch von dem Gesuch der drei litauischen Koryphäen.»Kommen Sie nach einer Woche. Wenn Ihr Mann da ist, werden wir ihn nach Hause schicken.«
Ich jagte von einer Stelle zur andern. Auf den Straßen wurde regelrechte Jagd auf Juden gemacht. Partisanen drangen in jüdische Wohnungen ein, gaben einen Schuß zum Fenster hinaus und verhafteten oder erschossen die ganze Familie unter dem Vorwand, daß die Juden selbst auf deutsche Soldaten geschossen hätten. Die jüdischen Wohnungen wurden geplündert. Litauische Partisanen und deutsche Soldaten forderten Abgabe von Geld, Uhren, Schmuck, steckten sich ein, was ihnen gefiel.
Durch die Straßen wurden größere und kleinere Trupps von Juden zum Gefängnis geführt, von dort oder oft auch direkt zum VII. Fort. Auf dem Savanoriu-Prospekt, der breiten Landstraße, die ostwärts führt, auf der sich die russische Armee zurückgezogen hatte, auf der die unvorbereiteten Familien der russischen Armee, der russischen Beamten geflohen waren, auf der Hunderte von Juden sich noch bis in die letzten Stunden vor [dem] Einmarsch der Deutschen – sogar viele auch später noch – gerettet hatten, auf dieser Straße wurden immer neue Trupps von Juden, Männer, Frauen, nach dem VII. Fort getrieben. Sie gingen sprachlos, wie entgeistert über das unfaßbare Dunkle, das über sie hereingebrochen. Die Frauen manchmal in leichten Sommerkleidern, ohne Mantel. Die Männer ohne Kopfbedeckung. Andere trugen [einen] Mantel und in der Hand ein Bündel. Hinter und neben ihnen Partisanen, das Gewehr in der Hand, mit harten, grausamen Gesichtern und überzeugtem Schritt, wie die Schächer auf einer mittelalterlichen Kreuzigung von Multscher.20 Ach, solche Leidenswege sollten hier jetzt tausendmal wahr werden. Kein Bild kann diese tierische Grausamkeit, diese abgründigen Leiden darstellen.
Ich stand am Straßenrand und suchte in den traurigen Zügen, sah darunter Bekannte. Manche grüßten verstohlen. Den ich suchte, sah ich nicht. Wir gingen zu dritt. Auch Maries und Gretchens Augen prüften die Vorbeigehenden. Keiner von uns sprach aus, was er dachte.
Ich lief in die neu geschaffenen Behörden, bis zum General Raštikis21, wartete lange im Vorzimmer. Dort umarmten sich angesehene Litauer und beglückwünschten sich zu den neuen Stellungen, in die sie das neue Regime gesetzt hat. Ich stand starr daneben und sah mir ihre hohle Freude an. Einige dieser neuen Koryphäen sollten sehr schnell zur Einsicht kommen, von welcher Art diese» Befreiung «war.
Zu Raštikis selbst wurde ich nicht gelassen. Sein Stellvertreter. Ich merkte gleich, diese Leute haben nichts zu sagen. Sie handeln nach den Befehlen der Eroberer. Der Mann notierte sich auf, und ich fühlte, daß nichts geschehen werde. Aber auch Juden kamen doch heraus auf Empfehlung. Ich hörte von verschiedenen Fällen.
Da traf ich auf der Laisves Allee den jungen Architekten Moschinskis, erzählte ihm in Eile, und er war sofort bereit, mir zu helfen. Wir gingen zusammen in das Gefängnis. Er kannte den Direktor persönlich.»Ja«, sagte der,»das Gefängnis ist seit zwei Tagen in den Händen der Gestapo. Wir haben nichts mehr zu sagen.«
Wir gingen zusammen in die Kriminalpolizei. Auch dort wurde Moschinskis als bekannte litauische Persönlichkeit begrüßt. Er schilderte meinen Mann als Menschen hoher Kultur, unpolitisch usw.»Seit einer Woche im Gefängnis?«sagte der Beamte bedenklich.»Von denen sind wenig übriggeblieben. «Er nahm den Hörer und rief das Gefängnis an. Max Holzman? Ja. Der ist noch da.»Seien Sie beruhigt, Frauchen. Morgen mittag um zwölf ist Ihr Mann wieder zu Hause.«
Ich schüttelte dem Beamten die Hand und verabredete mit Freund Moschinskis, der außerhalb der Stadt wohnte, daß er in einer Stunde zu uns zum Mittagessen kommen soll, und lief nach Hause zu den Kindern, um ihnen die frohe Nachricht zu bringen. Wir saßen auf dem Balkon. Nur erst wieder vereint sein, dann wollten wir schon gemeinsam überlegen, wie wir dem Schicksal trotzen könnten. In Deutschland, hatten wir gehört, gab es Ausnahmegesetze für Mischehen.22
Am nächsten Morgen ging ich früh auf den Markt. Es gab kein Gemüse, kein Obst. Schließlich bekam ich am Rande der Stadt von Bauern, die mit ihren Wagen hereinfuhren, frische Walderdbeeren. Ich eilte zurück. Vielleicht ist mein Mann schon gekommen. Nein, niemand ist gekommen. Ich ging mit den Kindern auf die Straße. Wie immer seit dem Einzug der Deutschen waren fern und nah Schüsse zu hören: Jagd auf verstreute russische Soldaten, auf Juden. Wir gingen die Straße auf und ab, auf und ab, standen lange an der Straßenkreuzung, wo ich schon einmal stundenlang gewartet hatte.
Dort speit alle fünf Minuten der elektrische Aufzug, der die Stadt mit dem Grünen Berg verbindet, einen Strom von Menschen aus. Manchmal glaubten wir, den Vater zu erkennen. Kam dort nicht eilig ein Herr mit einem weißen Panama? Aber nein, ein wildfremder. Wir standen und standen, bis wir endlich stumm, todmüde nach Hause gingen.
So warteten wir noch den ganzen nächsten Tag. Dann ging ich wieder auf die litauische Polizei. Man war nicht mehr freundlich, tat so, als wüßte man von nichts, und gab unklare Antworten, die nichts versprachen. Ob Moschinskis vielleicht mehr erreicht? Man kennt ihn überall, und er hat eine so überzeugende Art zu sprechen. Algis wohnte in Panemune, gute anderthalb Stunden von der Stadt entfernt. Ich ging die staubige Landstraße in der glühend heißen Sonne, ging und ging. Trupps deutscher Soldaten laut singend, nein, grölend von der» kleinen Ursula«. Sind diese Horden wirklich meine Landsleute?
Algis war nicht zu Hause. Seine schöne Frau saß groß und ruhig vor dem Hause mit ihren blühenden Kindern. Was wißt ihr von meinen Sorgen? dachte ich. Aber das friedliche Bild war eine Täuschung. Frau Moschinskis erzählte, daß ihr jüngster Bruder als Mitglied der kommunistischen Jugendvereinigung von Partisanen gemordet wurde. Ihre Eltern hielten sich bei ihnen versteckt. Ihr Vater, Arzt in einer Provinzstadt, war als Freund der Sowjets bekannt und wagte es vorläufig nicht, in seine Praxis zurückzukehren.
Da kam Algis mit nacktem Oberkörper, sonnenverbrannt, von seiner Wiese, die er gemäht hatte. Er versprach, am nächsten Morgen mit dem Rade in die Stadt zu kommen, um mit mir noch einmal in die Behörde zu gehen.»Nichts unversucht lassen, bis wir Erfolg haben«, tröstete er mich.
Ich lehnte ihre Einladung, zu bleiben und mit ihnen zu essen, ab, wollte so schnell wie möglich wieder bei den Kindern sein. Der Rückweg noch ermüdender, glühende Sonne, Staub und viele Soldaten. Am Straßenrand eine Pumpe. Ich trank das kalte Wasser. Mir schwindelte, ich hielt mich an einem Zaun, sah die Soldaten durch einen weißen Schleier, hörte deutsche Worte, sah deutsche Gesichter, so fremd, so fremd…
Am nächsten Tage trafen wir uns, liefen, sprachen, baten, ohne eine klare Auskunft zu erhalten. In der Stadt hatten sich schreckliche Szenen abgespielt. Auf der Bahnhofstraße war es auf dem Hof einer Autogarage zu einer regelrechten Schlacht der Partisanen gegen etwa… Juden gekommen, wobei die Juden, die ohne Waffen waren, sämtlich umgebracht wurden.23 Eine riesige Menschenmenge hatte sich versammelt, um dem entsetzlichen Schauspiel zuzusehen und die blinde Wut der Mörder mit ermunternden Zurufen zu schüren. Es gab auch Stimmen, die ihrer Empörung über diese Bestialität Luft machten.»Eine Schande für Litauen!«wagten Mutige zu sagen, wurden aber sofort zum Schweigen gebracht. Von allen Seiten drangen die Schrekkensnachrichten zu uns.
Die Kinder und ich wagten nicht, miteinander davon zu sprechen. Da stand die Glasschale mit den Erdbeeren, die wir zu Vaters Empfang bereitet hatten. Sie waren längst verfault, keiner räumte sie fort.
Ich ging wieder einmal in die Sicherheitspolizei. Man erinnerte sich meines vorigen Besuchs und gab mir eine Liste der jüdischen Insassen des Gefängnisses zur Durchsicht.»Wenn Sie ihn darunter finden, werden wir ihn sofort entlassen. «Sein Name war nicht darunter.
Ich ging langsam in der heißen Mittagssonne nach Hause. Er ist nicht mehr da, sagte ich immer wieder vor mich hin. Wie soll ich das den Kindern sagen? – Ich brauchte ihnen nichts zu sagen. Sie verstanden und schwiegen. Ich warf die alten Erdbeeren fort, kochte etwas zu Mittag wie alle Tage…
Vielleicht ist er auf dem VII. Fort? Dort hatte sich das Archiv wertvoller historischer Dokumente und Bücher befunden. Andern soll es gelungen sein, ihre Angehörigen dort zu sprechen. Gegen Abend stand ich vor dem Gitter des VII. Fort. Ich sprach mit der Wache, versprach hohe Bestechung. Gut, er wird suchen. Ich wartete, wartete. Schließlich erschien er wieder.»Nein, einen Max Holzman gibt es hier nicht.«
Ganz nahe beim Fort gab es einen kleinen Laden. Die Inhaberin, Wanda, ein wunderhübsches junges Mädchen, war im ganzen Stadtviertel eine populäre Erscheinung. Ihre kleine Bude war immer voller Menschen. Sie war nicht nur sehr geschäftstüchtig und verstand, mit jedem umzugehen, sondern hatte auch ein warmes Herz und einen klaren Verstand.
Dorthin kamen auch die Partisanen vom VII. Fort, um Zigaretten zu kaufen und mit Wanda zu scherzen. Wanda erfaßte sofort meine Lage und vermittelte mit ihnen. Die Partisanen versprachen, meinen Mann [zu] suchen und ihn frei[zu]lassen. Aber man fand ihn nicht.»Das hättet ihr uns früher sagen müssen«, meinte einer,»jetzt sind schon viele nicht mehr da.«—»Nicht mehr da?«fragte ich.»Wo sind sie denn jetzt?«Er gab keine Antwort.
Ich ging noch oft die breite Pappelallee zu Wanda, auf der man Hunderte von Juden getrieben hatte, von denen die meisten» nicht mehr da «waren. Darunter war einer, das war Max Holzman, das war mein Mann.
Oder war er vielleicht gar nicht hierher gekommen? Viele Juden waren irgendwohin in die Provinz zur Arbeit geschickt worden. Vielleicht lebt er und kommt wieder. Wenn er nur erst wieder bei uns ist. Wenn wir nur erst wieder vereint sind, dann sollen uns alle Leiden leicht werden…
Jeden Tag neue Schrecken, neues Entsetzen. Ein Anschlag mit riesengroßen Lettern in der ganzen Stadt. Alle Juden müssen auf der linken Brust einen gelben Stern tragen. Sie dürfen nicht auf dem Fußsteig gehen, sondern daneben, auf der rechten Seite der Straße, und zwar einzeln hintereinander. Es werden besondere Lebensmittelkarten für Juden ausgegeben und besondere Geschäfte eingerichtet. Sie bekommen weniger Brot, keinen Zucker, weniger Fett und Fleisch als die andern.