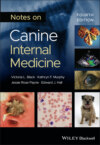Cilt 438 sayfalar

Kitap hakkında
"In drei Kladden hat Helene Holzman, Malerin, Buchhändlerin und Deutschlehrerin, gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aufgeschrieben, was sie in den Jahren zuvor an einem der finstersten Orte des Holocaust, im litauischen Kaunas, erlebt und erlitten hat.Im Juni 1941, unmittelbar nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht, verschwindet ihr jüdischer Mann für immer. Kurz darauf wird ihre ältere Tochter, die neunzehnjährige Marie, verhaftet und später erschossen.Helene Holzman lebt weiter. Sie überwindet ihre Verzweiflung und beschließt, nicht nur die eigene jüngere Tochter Margarete zu retten, sondern mit ihr so viele andere Gefährdete und Bedrohte wie nur eben möglich – vor allem Kinder aus dem Ghetto von Kaunas."DIES KIND SOLL LEBEN" wurde 2000 mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Die Jury urteilte: «Als authentische Chronik, aber auch als tief berührendes individuelles Zeugnis steht es neben den Tagebüchern von Anne Frank und Victor Klemperer.»