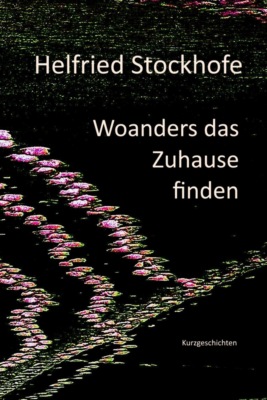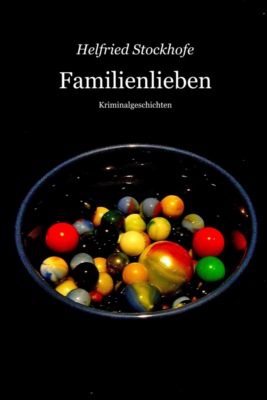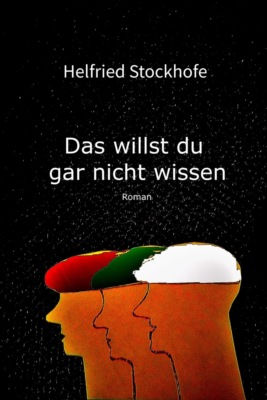Kitabı oku: «Begegnungen im Bayerischen Wald», sayfa 2
Geld hatte der Vater trotz seines Nebenerwerbs selten dabei, weil er alles in den grenznahen Casinos verspielte oder beim Straßenstrich ließ.
Wie durch ein Wunder war es viele Jahre gut gegangen.
Doch: Eines Tages konnte dann der Vater nicht mehr den Kachelofen einheizen. Und auch sein erstes neues Auto, das er bestellt hatte, konnte er nicht mehr fahren!
Über das alles dachte Maximilian nach, als er die Kachelofentür öffnete. Er zog am klemmenden Aschekasten, der mit einem Ruck und einer Staubwolke heraussprang. Voller Wut stieß er das Blechding zurück und hieb auch die Kachelofentür zu. Warum musste sein Vater so blöd sein! Wenigstens seine Waffe hätte er steckenlassen können! Offenbar war es dem scheißegal, welche Folgen sein kriminelles Verhalten für seinen Sohn bedeutete. Behauptet hatte der Vater allerdings oft das Gegenteil. Besonders wenn er betrunken war, wurde er wehmütig. Er klagte darüber, dass das Schicksal ihm seine Frau genommen hatte. Das Schicksal! Geblieben sei ihm nur sein Maxi. Und der sei ihm das Wichtigste im Leben. Eines Tages würde es ihnen besser gehen. Wenn sie einmal zu genügend Geld gekommen wären, würde er sich mit ihm auf die Suche nach lieben Frauen machen, so wie es die Mutter war… Aber bis es so weit wäre, wolle er immer mit ihm zusammenbleiben, eine richtige Männer-WG, egal, was die Leute im Dorf dazu sagen, die ihm sowieso am Arsch vorbeigingen.
Dummes Gerede! Nicht nur von den Leuten im Dorf! Maximilian wurde traurig. Er vermisste seinen Vater sehr. Insgeheim hatte er doch gehofft, dass an dessen Suff-Geschwätz etwas dran sein könnte.
Er zog den Aschekasten wieder heraus. Mit einem kleinen Besen kehrte er die herabgefallene Asche zusammen und bugsierte sie mit der Kaminschaufel wieder hinein in den vollen Behälter. Dann holte er einen Müllbeutel, den er über den Aschekasten stülpte, um ihn staubfrei aus dem Haus zu tragen. Und da kam ihm die Idee!
Werner gehörte zur anderen Seite. Er war Polizeihauptmeister bei der Bundespolizei. Auch er hatte einen Sohn. Der Sohn Alexander war jetzt auch schon einige Jahre Polizist und hatte das Schlimmste erlebt, was einem passieren konnte. Zum Glück wurde er nur leicht verletzt. Aber der Sohn war noch krankgeschrieben und verbrachte mehr Zeit mit dem Psychologen als mit der Waffe.
Werner selbst war noch nie etwas passiert, obwohl die verdeckte Fahndung im Grenzbereich voller Gefahren war. Man musste auf alles gefasst sein. Bei Fahrzeugkontrollen stand ein Kollege stets mit der Hand an der Waffe daneben und beobachtete, wie das Fahrzeug überprüft wurde. Sie hatten schon unzählbar viele Straftaten aufgedeckt, vom einfachen Zigaretten- bis zum Menschenschmuggel. Wichtig sei die Spürnase, hatte er auch seinem Sohn immer gepredigt, die Spürnase, welche Autos sich lohnen und welche Insassen gefährlich sein könnten.
Heute fuhr Werner mit seinem Kollegen hinter einem Golf mit einem hiesigen Kennzeichen. Er überquerte den Sattel, der in den Lamer Winkel hinausführte und bog ab in Richtung Arber. Die Beamten hatten das Gefühl, dass das Auto irgendwie unruhig fuhr, mal schneller, mal langsamer. Der Fahrer schaute oft in den Rückspiegel und war offenbar irritiert vom dunklen BMW, der ihm folgte. Dann hielt der Golf an einer Bushaltestelle. Werner fuhr mit seinem Kollegen daran vorbei. Sie schauten dem jungen Mann ins Gesicht. Der nickte kurz mit dem Kopf – ein nervöser Gruß.
„Frag mal das Kennzeichen ab!“
„Hast wieder so ein Gespür?“, flachste der Kollege.
„Oben auf der Scheibn warten wir, ob er kommt!“
Auf der Scheiben war ein Langlaufzentrum mit einem großen Parkplatz. Seit Wochen war der Betrieb eingestellt, denn nach einem ungewöhnlich warmen Februar war inzwischen auch auf tausend Meter Höhe keine brauchbare Piste mehr vorhanden.
Als Maximilian mit dem Golf die Scheiben erreicht hatte, sah er den BMW auf dem Parkplatz stehen. Fast hätte er deswegen den Beamten überfahren, der mit einer Polizeikelle auf der Straße stand und ihn hereinwinkte. Er musste scharf abbremsen und hörte, wie der Beamte draußen fluchte. Trotzdem wurde Max einigermaßen freundlich angeredet, zeigte seine Papiere und öffnete den Kofferraum.
Er war sehr nervös. Er hatte richtig Angst!
„Was ist denn das?“, wollte der Polizist wissen. Dabei zeigte er auf eine größere Kaufhaustüte, die seltsam breitgedrückt im Kofferraum lag. Max zuckte mit den Schultern.
„Machen`S die bitte mal auf!“, forderte Werner.
Max holte die Tüte heraus und Werners Kollege nestelte nervös an seiner Waffe herum.
Max wurde immer ängstlicher. Dann öffnete er zitternd die Tüte und ließ Werner hineinschauen.
„Was ist denn das?“, fragte der wieder.
Max zog aus der Kaufhaustüte eine zweite Tüte heraus, die durchsichtig und offenbar vollgefüllt mit Asche war. Die hielt er wieder den Beamten hin.
„Das ist wohl die Asche vom Opa?“, frotzelte der Polizist im Hintergrund.
„Ich hab die wohl aus Versehen reingelegt!“, erwiderte Max.
„Ich hab morgens daheim den Kachelofen eingeheizt und wollte die Asche entsorgen.“
„Oben auf dem Arber?“, mischte sich wieder der Kollege rein und grinste.
Der Polizeihauptmeister ließ die Tasche auf den Boden stellen und fuhr mit dem Kugelschreiber vorsichtig durch den grauen Staub.
„Nichts drin!“, stellte er fest.
„Natürlich nichts drin“, entgegnete Max. „Was soll denn drin sein?“
Die Polizisten ließen den aufgeregten Maximilian samt der Asche weiterfahren, fuhren aber hinterher. Max bog am Brennes-Sattel Richtung Arber ab und fuhr noch einige Kilometer weiter. Die Polizei hinterher: Am Arber vorbei, hinunter zum Arbersee und wieder hinauf zum Bretterschachten. Auf dem Parkplatz dieses Langlaufzentrums war auch nichts los. Max hielt an und überlegte. Die Polizei fuhr weiter Richtung Bodenmais.
Die beiden Beamten spekulierten fleißig über die Möglichkeiten des Schmuggels in Asche. So etwas hatten sie noch nicht erlebt. Mehr als seltsam erschien ihnen die Einheiz-These des jungen Mannes, zumal es schon später Nachmittag war.
In Richtung Zwiesel strahlte noch die März-Sonne. Sie hatte viele in den Nationalpark gelockt. Als die Polizei wieder in Richtung der tschechischen Grenze fuhr, kamen deshalb den Beamten viele Autos entgegen. Werner und sein Kollege bogen in Bayerisch Eisenstein nach links ab und fuhren erneut zum Brennes hoch, diesmal von der anderen Seite. Dort postierten sie sich, um noch einige Fahrzeuge zu kontrollieren, die vermeintlich über den Grenzübergang in Bayerisch Eisenstein gekommen waren.
Die Sonne war hinter dicken Wolken verschwunden und deshalb dämmerte es schon, als der Golf den Berg heraufkam. Es war das letzte Auto, das sie heute kontrollierten wollten.
„Was wollen Sie denn schon wieder von mir?“, fragte Maximilian, schon etwas mutiger als vor einigen Stunden.
„Dasselbe wie vorhin!“
Max öffnete den Kofferraum. Werner stutzte. Er winkte seinen Kollegen näher und zeigte auf die Tüte.
„Das war doch vorhin anders!“, wandte er sich mehr behauptend als fragend an Max.
„Ich seh nichts anderes!“, erwiderte der.
Werner hob die Tüte heraus und hielt sie seinem Kollegen vor die Nase.
„Jetzt ist die durchsichtige Abfalltüte außen und in der steckt die Einkaufstüte mit Asche! Vorhin war es umgekehrt!“
Der Kollege erinnerte sich. „Wollen Sie uns veräppeln?“, fragte er den Maximilian.
„Ich find das gar nicht lustig!“, sagte Werner irritiert. „Ich nehme die Tüten mit!“
„Ja…, aber…, wozu denn das?“, stotterte Max.
Werner stocherte noch einmal ergebnislos in der Asche herum, dann sagte er wieder. „Wir nehmen das mit!“
„Aber ich versichere Ihnen, dass da nichts drin ist!“, beteuerte Max.
„Hier, haben Sie eine Quittung!“ Werner ließ sich nicht abbringen. „Ich schreibe drauf Zwei Einkaufstüten mit Asche.
Die können Sie bei uns in der Dienstelle, die ist ja bei Ihnen gleich um die Ecke, wieder abholen. Wir benachrichtigen Sie, wenn es so weit ist!“
Dann ließen sie den verdutzten Max stehen und fuhren davon.
Werner hatte die Tüte über Nacht unter seinem Schreibtisch stehen und wollte sie zur kriminaltechnischen Untersuchung weitergeben. Womöglich versteckte sich Rauschgift in der Asche. Das wäre ein neuer Trick: Mit gewöhnlicher Asche nach Tschechien fahren und Rauschgift holen, das als Asche getarnt ist. In der Tat hatte er den Eindruck, als ob bei der ersten Kontrolle die Asche eine andere gewesen wäre. Allerdings hatte er einige Hemmungen. Sein Kollege hatte ihm verdeutlicht, welchem Gespött sie ausgesetzt sein würde, wenn alles harmlos wäre. Werner hatte seinen Kollegen darauf eingeschworen, vorerst alles für sich zu behalten.
Was hatte der junge Mann vor? Und warum ist die Asche dem so wichtig?, fragte er sich.
Daheim hatte Werner andere Sorgen. Sein Sohn Alexander weigerte sich, über die schlimme Sache vor einigen Wochen zu reden. Werner meinte, es hätte doch lieber ihm, dem Alten, passieren sollen! Er hatte auch schon die Waffe ziehen müssen, aber zum Glück war das ohne Folgen geblieben. Bei der Schießerei seines Sohnes wurde jedoch der Drogendealer getötet und Alexander von der Kugel gestreift.
Schlimmer als die körperlichen waren für Alexander aber die psychischen Folgen.
Und als Werner daheim über das alles nachdachte, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Deshalb kam mir der Name des aschefahrenden Golffahrers so bekannt vor!
Als Max die Asche in den nächsten Tagen abholte, wusste er nicht, dass Werner in seiner Angelegenheit nichts unternommen hatte. Der Beamte wünschte ihm sogar noch alles Gute! Er meinte zwar, er habe alle Augen zugedrückt und schaute ihn so an, als wüsste er Bescheid. Werner wusste, dass er dem Max vermutlich schwer etwas hätte nachweisen können. Aber es lag ihm auch nicht mehr daran. Manche Vorschriften hielt auch er für überholt.
Werner dachte, dass Max die Asche im Garten verstreuen oder auf einem Berg vom Böhmischen Wind verwehen lassen würde. Max aber verfrachtete sie in den Kachelofen. Dort, wo sie seiner Meinung nach hingehörte, beließ er sie den ganzen Sommer und überlegte, wie er im nächsten Winter damit verfahren sollte. Vielleicht würde er den Ofen nie mehr anheizen!
5. Toni und der Doppelgänger
Wenn man die richtigen Stellen kennt oder wenn man tiefer hineinfährt in den Bayerischen Wald, dorthin, wo er schon zum Böhmerwald gehört, kann man abseits jeglichen Straßenlärms auf steinigen Wegen oder zwischen alten Wurzeln und Heidelbeersträuchern hinaufsteigen zu den Gipfeln. In lichten Wäldern rauscht dabei der Wind in hohen alten Bäumen und den Eichendorff-Kennern unter den Wanderern fällt unmittelbar sein Abendlied ein:
Schweigt der Menschen laute Lust:
Rauscht die Erde wie in Träumen
Wunderbar mit allen Bäumen,
Was dem Herzen kaum bewusst,
Alte Zeiten, linde Trauer,
Und es schweifen leise Schauer
Wetterleuchtend durch die Brust.
Wenn nicht gerade ein wunderschöner Sonn- oder Feiertag ist, dann ist man dort meist allein und glücklich – was nicht heißen muss, dass es nicht auch schöne Begegnungen geben kann.
Toni war ein richtiger Naturbursche, der eigentlich Antonia hieß, aber wegen der burschikosen Ausstrahlung manchmal wirklich einen zweiten Blick auf sich zog, der dem Erkennen des Geschlechts diente. Dabei war die Toni als Frau nicht unattraktiv, sie trug aber die Haare ganz kurz und in ihrer Kleidung bei Arbeit oder Freizeit wirkte sie nicht grazil, sondern zupackend-kräftig. Außenstehende hielten sie manchmal für homosexuell, aber das war nicht zutreffend. Allenfalls könnte ein Psychologe sagen, dass Toni unbewusst diesen Eindruck vermitteln wollte, vielleicht um einer allzu schnellen Anmache durch Männer aus dem Weg zu gehen.
Der Wanderer, der auf dem Weg zum Gipfel lange in einem gewissen Abstand hinter Toni lief, so als wäre ihm eine Begegnung unangenehm, holte sie schließlich doch ein, nachdem sie sich einige Male fragend nach ihm umgeblickt hatte. Er grüßte sie freundlich, war erstaunt über die hohe Stimme dieses „Mannes“, bis er erkannte, dass Toni eine Frau war. Vielleicht ließ das ihn etwas langsamer hochsteigen, seinen Schritt anpassen und beim Gehen ein kurzes Gespräch führen. Vielleicht wollte er aber auch nicht auffallen mit einer Unruhe, die ihn offenbar umtrieb. Immer wieder schaute er sich suchend um, so dass Toni fast danach gefragt hätte. Keiner der beiden konnte das Alter des anderen gut einschätzen, es lag wohl bei beiden so um die 40, war aber in diesem Moment nur von sekundärer Bedeutung. Beide glaubten, den anderen schon einmal gesehen zu haben, aber sie forschten weiter nicht nach, sondern unterhielten sich kurz über das Wetter, die wunderbare Stimmung und freuten sich auf die Aussicht droben auf dem Gipfel. Dann beschleunigte der Mann doch seinen Schritt, vielleicht weil er seine Höflichkeitspflicht erfüllt hatte oder auch weil er merkte, dass Toni ihn keinesfalls aufhalten wollte. Ihr ging es offenbar doch mehr um das Naturerlebnis als um einen Kontakt. Außerdem spürte sie, dass etwas Ungewöhnliches, ja Bedrohliches diesen Mann umgab – und sie war froh, dass er weiterging. Als Toni den Aufstieg geschafft hatte und auf dem Grat der Tausender die weite dunstig-blaue Hügelkette des Vorderen Bayerischen Waldes gegen die sich neigende Sonne vor sich sah, vermisste sie ein wenig einen Begleiter, mit dem sie diesen grandiosen Blick hätte teilen können. Der Seltsame war aber schon den Weg durch die Baumgerippe hindurch auf dem Grat weitergegangen. Die vor dem Borkenkäferbefall einst stolzen Fichten verjüngten sich zwischen jungen Buchen, Ahornbäumchen und Vogelbeersträuchern.
Toni arbeitete als Malerin in einem Handwerksbetrieb. Zusammen mit einem Kollegen weißelte sie schon wochenlang in Häusern einer Wohnungsbaugesellschaft. Mittags gönnte sie sich eine Pause in einer kleinen Kneipe. Und dort sah sie ihn! Nun wusste sie, warum ihr der fremde Wanderer bekannt vorgekommen war. Sie schaute genau hin. Saß er nun wirklich dort oder sah der andere ihm nur ähnlich? Als der Gast gegenüber einmal in ihre Richtung zu blicken schien, hob sie kurz die Hand zum Gruß, aber der reagierte nicht.
Für den Mann war es wichtig, immer wieder in dieser Kneipe zu sein. Man kannte ihn, ließ ihn aber in Ruhe. Ihm war es nicht recht, dass es da diese etwa gleichaltrige Frau gab, die ihm ab und an zunickte oder gar zuwinkte. Wenn er in den folgenden Tagen wieder dort war, hob er einfach seinen Blick nicht mehr, um nicht irgendeinen Kontakt mit der Frau zu provozieren. Sprach ihn einer an, dann gab er stets kurze, manchmal auch barsche Antworten und erreichte, dass sich der Anfragende nie mehr annäherte. Bis auf wenige Ausnahmen! Es gab komische Typen, die seltsame Gespräche mit ihm führen wollten. Als er merkte, dass es darauf hinauslief, dass er Rauschgift kaufen sollte, fauchte er sie an, dass er nichts brauche, er sei clean.
Seine Zugfahrt dauerte über eine Stunde. Er war sich fast sicher, dass ihm die Frau gefolgt war. Was wollte die von ihm? Am Ziel angekommen, schlug er einige Haken und schüttelte sie ab. Dort in seiner Geburtsstadt kannte er sich aus.
Toni war schon immer so: Geheimnissen wollte sie auf den Grund gehen! Ihr Kollege hatte sie anfangs belächelt, als sie den Wanderer mit dem Mann in der Kneipe in Verbindung brachte. Später hatte er sie gewarnt und an unliebsame Situationen erinnert, in die sie wegen ihrer Kriminalisiererei geraten war. Aber er wusste ja, dass es nichts half. So bat er sie, ihm wenigstens über ihre Abenteuer zu berichten.
Toni hatte herausbekommen, dass der Mann öfters zum Bahnhof eilte. An einem Samstagnachmittag war es ihr möglich: Sie verfolgte ihn und fuhr mit dem Bayernticket im selben Zug mit ihm in Richtung Norden. Nach dem Aussteigen verlor sie ihn aber, was sie natürlich beträchtlich ärgerte. Sie hatte ihn nie angesprochen, weil es ihr klar war, dass er den Kontakt zu ihr meiden wollte. Nun ging sie in dieser Stadt umher, die sie kaum kannte, allenfalls als Bahnstation. Sie suchte ihre Rückfahrtverbindung heraus und begab sich für die Wartezeit in ein Café, von dem sie vorher nicht wusste, dass es zu den Lokalitäten gehörte, in das auch die Honoratioren gehen, besonders, wenn sie als Politiker sich dem Wahlvolk der Stadt zeigen wollten. Erst vor kurzem wurde hier der neue Bürgermeister gewählt. Darum war der etwa 65-jährige Mann, der nun ins Café kam, allen bekannt. Mit „Grüß Gott, Herr Bürgermeister! Schön, dass Sie uns wieder beehren!“ wurde er zu einem guten Platz geleitet, der offenbar sein Stammplatz geworden war.
Toni bekam mit, dass der Bürgermeister noch jemand erwartete. Trotzdem bestellte der schon Kaffee und ein Stück Torte, das etwas groß geraten war, jedenfalls größer als Tonis Stück. Schließlich kam der andere hinzu, ein Mann um die 40, sein Sohn, überkorrekt gekleidet. Auch der grüßte jeden Gast im Lokal, das liegt bei Politikerkindern offenbar in den Genen.
Als sich ihre Blicke kreuzten, stutzte der Bürgermeistersohn sichtlich erschrocken. Toni war ebenso perplex: Es war ihr Wanderer! Seinen pseudofreundlichen Gruß erwiderte sie mit „Hallo!“ und schob noch nach: „Welch ein Zufall!“ Ein Politikersohn kann sich da natürlich nicht entziehen! So blieb er kurz stehen und sagte: „Die Welt ist eben klein!“ Er hatte sie also erkannt!
Es war Toni unmöglich, sich den noblen Leuten aufzudrängen. So beobachtete sie ihn und seinen Vater aus der Entfernung. Beide schauten sich gelegentlich auffällig unauffällig nach ihr um. Dann wurde es Zeit und Toni verließ, nochmals grüßend, das Lokal und fuhr mit der Bahn wieder nach Hause.
Noch im Zug berichtete sie telefonisch ihrem Arbeitskollegen und begann mit ihm zu spekulieren.
„Das war er, ganz sicher!“, behauptete sie.
„Aber du sagtest doch, der war ein vornehmer Pinkel! Und unser Mann hier in der Kneipe ist doch eher ein Freak!“, entgegnete der Kollege.
„Aber ich bin ihm doch nachgereist. Der ist doch dort ausgestiegen!“, argumentierte sie.
„Na, so klein ist die Stadt auch wieder nicht, da gibt es sicher ein paar Leute, die ähnlich ausschauen.“
„Nein, nein, ich bin mir ganz sicher.“ Toni ließ sich nicht abbringen. „Der führt ein Doppelleben, glaub es mir!“
„Ach du mit deiner Fantasie!“, stöhnte der Kollege. „Was soll ihm das bringen? Meinst du der hat zwei Frauen? Hast du ihn mit einer Frau gesehen?“
Toni dachte nach. Und kam mit der nächsten Theorie: „Oder es ist ein Zwilling! Und keiner weiß vom anderen!“
„Ja klar. Und gerade du musst denen das jetzt beibringen!“
„Okay, lass mich noch etwas überlegen. Ich krieg`s schon noch raus!“, beendete sie das Telefonat.
Wenn es derselbe Mann ist, dann ist das Ganze mysteriös. Dann verleugnet der Bürgermeistersohn in seiner Rolle als Freak, dass er mich kennt. Warum? Ja, klar. Sonst würde er auffliegen! Bleibt die Frage, warum der ein Doppelleben führt.
Wenn es Zwillinge sind, dann ist der Unterschied im Lebensstil zwischen den beiden auffällig. Aber das soll es geben. Ihr tat es fast Leid, dass sich das Rätsel womöglich banal auflösen sollte.
Und wirklich: Tonis Kollege rief sie am Abend an: „Also, liebe Toni, ich habe recherchiert!“
„So? Lass Hören!“
„Im Internet kann man ja alles finden. Und ich hab herausbekommen, dass dein Bürgermeister tatsächlich zwei Söhne hat. Ob sie Zwillinge sind, weiß ich nicht. Aber auf einem Foto aus früheren Jahren sieht man den Bürgermeister mit seiner Frau und zwei jungen Männern, die sich total ähneln. Auf späteren Familienfotos ist nur noch der eine mit drauf. Wahrscheinlich war dann der Freak für die Politikerkarriere nicht mehr förderlich. Du kannst dich also beruhigen. Da steckt nichts Besonderes dahinter!“
„Schade!“, seufzte Toni. „ Das habe ich schon befürchtet. Aber ich glaube, ich traue mich jetzt trotzdem, den Freak aus der Kneipe einmal anzusprechen, immerhin bin ich mit seinem Bruder gewandert. Und das ist doch ein Anknüpfungspunkt.“ Aber so oft Toni auch in den folgenden Wochen Ausschau hielt: Der Freak tauchte nie mehr auf! Obwohl ihr das merkwürdig vorkam, hätte sie die ganze Angelegenheit fast schon beiseitegelegt, wenn sie nicht wieder ein sonniger Tag in den „Wald“ gelockt hätte.
Und es schweifen leise Schauer
Wetterleuchtend durch die Brust.
Sie konnte es beim Hochsteigen richtig spüren, dass etwas Unheimliches ihre Brust belastete. Das war mehr als ein Wetterleuchten. Sie hörte die Krähen, sah, wo sie sich versammelt hatten und näherte sich. Obwohl sie in angemessener Entfernung stehen blieb, erkannte sie schnell, dass der Boden aufgescharrt und das dort Vergrabene für die Aasfresser zugänglich geworden war. Als sie einige menschliche Zehen erkannte, begann sie zu würgen.
6. Die letzten Tage des Freaks
Nachdem er mitbekommen hatte, dass sein Dealer von der Polizei erschossen worden war, wurde es schwieriger, zuverlässig an Stoff zu kommen. Schließlich bekam er den Tipp, dass auf dem Friedwald in Bayerisch-Eisenstein eine Urne als toter Briefkasten für Rauschgift gedient haben könnte. Wenn er dieses Versteck finden würde, könnte er den getöteten Dealer beerben und kosten- und risikolos an seine stattliche Urnenladung gelangen.
Sein suchtbedingter Drang kontrastierte zu seinem zunehmenden Lebensunwillen. Und so schwankte er in ständiger Unruhe zwischen Suche und Lethargie, beides gleichermaßen quälend. Er schleppte sich schließlich doch zu dem besagten Friedhof, der sich als dichter Wald mit hohen Bäumen entpuppte, die hinüber grüßten auf den Grenzort und zum Arber, dem radarkuppelgekrönten König des Bayerwalds. Wie um Himmels Willen sollte er zwischen all diesen Bäumen und aufkommenden Sträuchern die richtige Urne finden?
Er stapfte orientierungslos umher – bis er hörte, dass ein Auto vom schlaglochübersäten Parkplatz kommend sich dem Vorplatz des Friedwalds näherte. Er versteckte sich. Er konnte nicht ahnen, wer aus dem Auto aussteigen würde. Er musste öfters hinschauen, bevor er den Fahrer, der ihm irgendwie bekannt vorkam, in sein löchrig gewordenes Gehirn einordnen konnte. War das nicht ein Bekannter seines Dealers? Oder gar sein Sohn, denn er sah ihm sehr ähnlich. Einige Male hatte er die beiden zusammen gesehen und jetzt kam der alleine hierher. Und was wollte der? Natürlich! Der wusste, wo der Dealer-Vater den Stoff gelagert hatte! Vorsichtig ging und kroch er ihm hinterher. Der Sohn war selber sehr vorsichtig, schaute sich oft um, hörte Geräusche, die er letztlich Waldtieren zuschrieb und nicht einem menschlichen Beobachter. Dann grub der Sohn eine Urne aus, öffnete mit einem Werkzeug den verschweißten Deckel und nahm aus einer mitgebrachten Tüte eine zweite Tüte heraus, die mit etwas gefüllt war. In die jetzt leere erste Tüte schüttete er die Asche aus der Urne hinein. Ja, es war nur Asche, das war deutlich genug zu sehen, auf keinen Fall sah es aus wie irgendeine Form von Rauschgift. Dann leerte er die mitgebrachte Asche aus der anderen Tüte in die Urne, verschloss die und vergrub sie wieder in das runde Erdloch.
Der hatte also nur Asche ausgetauscht! Wie seltsam! Wie enttäuschend! Oder erfreulich? Denn vielleicht wusste der ja nichts vom Versteck des anderen. Auf jeden Fall war der nicht in einer Rauschgiftaktion unterwegs gewesen. Eigentlich schade, denn so war nun auch diese Chance vorbei, das Versteck zu finden.
Und der Rauschgiftkranke mit dem löchrigen Gehirn hakte schließlich diese Besorgungsmöglichkeit endgültig ab. Bevor ihn wieder die Melancholie übermannte, ließ er sich noch ein letztes Mal inspirieren von diesem wunderbaren Wald mit seinen natürlichen Schätzen. Es gab Kräuter und Pilze, die man nur kennen musste…
Aber schon hatte der Wald mit den Toten seine Sehnsucht nach der ewigen Ruhe wieder nach oben gespült. Wen würde es schon kümmern, wenn es ihn nicht mehr gäbe? Die paar Leute, die ihm immer wieder in der Kneipe begegneten? Dort war ja noch die einzige Gelegenheit des menschlichen Kontakts – soweit die Bezeichnung Kontakt da überhaupt angebracht erschien. Viel weniger Kontakt hätte er in einem Friedwald auch nicht, da gäbe es auch rundherum Wesen. Womöglich würden die sich spiralförmig kringelnd aus den Urnen in die Höhe heben, wenn er in seinem letzten Rausch nach ihnen riefe.
Würde es seine Eltern kümmern? Oder seinen Zwillingsbruder? Die wären doch froh, das schwarze Schaf endgültig verloren zu haben. Ganz zu schweigen von den Geldzahlungen, die sie dann nicht mehr zu leisten bräuchten. Eine Art Schweigegeld im Rahmen eines Stillhalteabkommens, das die politische Karriere des Vaters absichern sollte. Stand da nicht gerade eine Wahl an?
Sein Vater, der zukünftige Bürgermeister mit seinem Vorzeigesohn… Was würde geschehen, wenn gerade unmittelbar vor der Wahl der andere Sohn, der Versager, sich als Totgefixter outen würde?
Er spürte, wie die Wut in ihm hochkochte. Wann hatte das alles angefangen? Und warum? In den ersten Lebensjahren hatten seine Eltern doch sicher Kapital daraus geschlagen, eineiige Zwillingssöhne zu haben. Stets gleich angezogen, gleich behandelt, selten verwechselt – zumindest von der Verwandtschaft. In der Schule gab es dann die ersten Verwechslungsarrangements, die viel Spaß machten. Wann schlich sich der Unterschied ein? Sicher, beiden ging es irgendwann auf die Nerven, immer nur ein Teil des Zwillingspaares zu sein, keine Individualität darüber hinaus zu besitzen, Verschiedenheiten vermeiden zu sollen. Vermutlich war es allen aber klar, es würde keine Verschiedenheit ohne ein besser und schlechter geben. Dazu war das Elternhaus zu sehr auf Bewertung fixiert, nicht auf Gleichwertigkeit des Verschiedenen, Toleranz gegenüber dem Andersartigen. Wer sich zuerst bewegt, verliert! Wer den Gleichschritt verlässt, sei es auch nur durch ein ungewolltes Stolpern, könnte ganz vom Weg gestoßen werden. Das galt nicht nur für die Zwillinge, sondern für seine ganze Familie als System. Wann war er gestolpert?
Sicher hatte es schleichend begonnen. Vielleicht durch den Fahrradunfall, der ihn hinderte, bei einer wichtigen Einladung dabei zu sein. Während der Bruder dort seine erste große Liebe kennen lernte, lag er mit einem Kerl im Krankenzimmer, der ihm über ein anderes Leben erzählte. Und während der Bruder mehr und mehr Zeit mit dem Mädchen aus reichem Hause verbrachte, tastete er sich unvorsichtig und naiv mit „Freunden“ in eine fremde Welt hinein. Er geriet auf Abwege, genoss das Anderssein. Wenn ein Dominostein fällt, werden andere mitgerissen. Und wie schnell hatte man ihn aufgegeben! Er störte doch zu sehr die guten Entwicklungen der anderen Familienmitglieder. Und es gab ihn ja sowieso doppelt, in guter und schlechter Ausführung.
Keiner hatte etwas dagegen, dass er sich auch räumlich davonmachte. Das ließ sich sein Vater auch einiges kosten. Als Stachel im Fleisch der Familie war er aber geblieben, vielleicht nur als finanzieller Stachel. Mit Drohungen hatte man dann seine räumliche Anwesenheit, seine Annäherungsversuche unterbunden. Erst da hatte er kapiert, dass es vorbei war. Erst da litt er unter einem Gefühl des Ausgestoßenseins. Nun erst spürte er den Schmerz, seine Familie verloren zu haben. Er schloss sich mehr und mehr einer anderen Familie an, die Familie der Versager, ohne Ehrgefühl und mit geringem Zusammengehörigkeitsgefühl. Er kannte kaum irgendwelche Ideale, die ihn in andere Gemeinschaften gebracht hätten, hatte keine religiöse, politische oder andere Ideologien entwickelt. Er konnte keinen Halt finden in Vereinen oder extremistischen Gruppierungen. Verloren in der Welt berauschte er sich mit allem, was sein Budget hergab. Die Gefühle, die er noch entwickeln konnte, wurden immer wieder vernichtet oder ersetzt durch andere, die ihn überwältigten und in andere Sphären brachten.
Fast war er froh darüber, dass er sich immer wieder seiner Enttäuschung und seinem Hass stellen konnte. Das machte ihn „normal“. Wäre es nicht an der Zeit, jetzt das Ding durchzuziehen? Jetzt endlich gäbe es doch wieder einmal einen Zeitpunkt, zu dem er sich rächen könnte. Jetzt endlich könnte er wieder deutlicher wahrgenommen werden als Teil dieser Saubermann-Familie! Mit einem letzten großen Auftritt – zur Unzeit.
Der Junkie quälte sich den Berg hinauf. Er schnaufte und dachte an den Aufstieg zum Kickelhahn. Da kam ihm der Blinde in den Sinn – und er lächelte. Es war rührend und komisch zugleich, dass der blinde Sommelier, während er den teuren Wein kredenzte, Goethe rezitiert hatte. Aber sein Vater hatte dem ja das Stichwort geliefert: Wir waren auf dem Kickelhahn! „Ach dort, wo der Goethe sein Gedicht an die Wand der Jagdhütte geschrieben hat?“, hatte der Blinde rhetorisch gefragt und gleich weitererzählt: „50 Jahre später hat er es dort wieder entdeckt – und er hat geweint!“ Dann hatte der Blinde eine Kunstpause gelassen, mit seinen leeren Augen durch die Sonnenbrille gestarrt und vergeblich auf eine Reaktion seiner noblen Kundschaft gewartet. „Da war Goethe schon über 80 und wusste, dass seine Zeit bald gekommen war!“, erklärte er den Kulturbanausen.
Um welches Gedicht es sich denn gehandelt habe, hatte sein Vater, der Bürgermeister, gefragt. Und dann hatte der Blinde seufzend losgelegt:
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Ein zynisches Lächeln huschte jetzt über das Gesicht des Junkies.
Der Kickelhahn und das Nobelrestaurant! Das waren die letzten gemeinsamen Ausflüge mit seiner Vorzeige-Familie! Auch hier im Bayerwald war es heute windstill – und alle Vögel schwiegen.