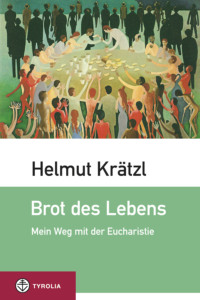Kitabı oku: «Brot des Lebens», sayfa 2
Um der Erstkommunion willen getauft
Die Zahl der ungetauften Kinder nimmt in der Großstadt immer mehr zu. In der zweiten Volksschulklasse, in der die Kinder zur Erstkommunion gehen, wird dies manchen Eltern erst bewusst. Sie wollen ihrem Kind die große Feier im Rahmen der ganzen Klasse nicht vorenthalten und entschließen sich, das Kind nun taufen zu lassen.
Die Beweggründe der Eltern mögen bedenklich sein, aber ihr Wunsch bietet den Seelsorgern einen Anlass, um mit ihnen über Glaube und Taufe und ihre Verantwortung für das Kind zu reden. Jedenfalls habe ich schon öfter erlebt, wie die Taufe mit der ganzen Klasse vorbereitet und gemeinsam gefeiert wird. So erleben die anderen Kinder in der Klasse, was und wie Taufe ist. Erstaunlich, dass offenbar die Kommunion den sonst gar nicht so gläubigen Eltern einen unerwarteten Weg zur Taufe ihres Kindes auftut. Die Bedeutung der Erstkommunion für das Leben der Menschen, der Kirche ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Darum predige ich auch bei Visitationen immer darüber und wie Erstkommunion zur eucharistischen Besinnung für die ganze Gemeinde werden kann.
Beichte vor der Erstkommunion?
Ich mache mir Sorgen, dass eine schlechte Beichtvorbereitung den Kindern die Freude an der Kommunion raubt und ihnen sogar für ihr ganzes Leben ein falsches Gottesbild vermittelt. Und diese meine Sorge ist in letzter Zeit größer geworden.
Verunglückte Beichtvorbereitung
Bei der Visitation einer Pfarre im südlichen Anteil der Erzdiözese Wien erlebte ich, wie ein sehr frommer Pfarrer, der sonst sehr viel auf die Verehrung der Eucharistie hält, in der Erstkommunionvorbereitung den Akzent auf die Beichte legte. Im Schlussprotokoll der Visitation regte ich an, den Schwerpunkt doch deutlich auf die Eucharistie zu legen und in den Kindern eine große innere Freude zur Begegnung mit Christus in der Eucharistie zu wecken. Sie sollen nicht den Eindruck haben, Eucharistie brauche immer vorher Beichte, oder dass man in der Begegnung mit Christus immer zugleich auch die Sünde betont. In einer anderen Pfarre hörte ich die Eltern klagen, dass der Pfarrer bei der Erstkommunionvorbereitung in übertriebener Weise von Sünde und schwerer Sünde redet, sodass die Kinder Angst bekommen, Angst auch vor einem strafenden Gott.
In Wien mussten wir, Kardinal König und ich als Generalvikar, einen Pfarrer absetzen, weil er trotz heftiger Einsprüche von uns den Erstkommunionkindern Bilder von blutigen abgetriebenen Embryonen zeigte, um sie, wie er meinte, rechtzeitig immun zu machen vor einer Verharmlosung dieser so schweren Sünde. Die Eltern schickten ihre Kinder aus Protest in eine andere Pfarre, da sie zu Recht fürchteten, ihre Kinder würden ein unheilbares Trauma im Hinblick auf Sexualität und Elternschaft bekommen.
Woher kommt die so enge Bindung zwischen Beichte und Kommunion?
Freilich sind die erwähnten Beispiele Ausnahmen, der letzte Fall sogar eine extreme. Aber es bleibt die Frage, ob der Erstkommunion immer die sakramentale Beichte vorausgehen muss. Dies scheint der Kirche aber so wichtig zu sein, dass sie es sogar in ihrem offiziellen Rechtsbuch (CIC 1983) festgehalten hat. Dort wird in can. 914 den Eltern sowie dem Pfarrer zur Pflicht gemacht, die Kinder, die zum Vernunftgebrauch gelangt sind, gehörig vorzubereiten und „möglichst bald, nach vorheriger sakramentaler Beichte, mit dieser göttlichen Speise“ zu stärken. Das hat seine Wurzel in der bewegten Geschichte der Beichte, als man begann, sie als notwendige Voraussetzung für den Kommunionempfang anzusehen. Diese Lehre geht schon auf die Mitte des 8. Jahrhunderts zurück und im 4. Laterankonzil kam es 1215 zur gesetzlichen Verpflichtung, dass jeder Gläubige vor Ostern bei seinem zuständigen Pfarrer zur Vorbereitung auf die vorgeschriebene Osterkommunion „all seine Sünden“ beichten müsse. Da die Gläubigen damals sehr selten kommunizierten, blieb der Brauch, jedes Mal vor der Kommunion zur Beichte zu gehen. In den orthodoxen Kirchen gilt das heute noch.
Versuche, Beichte und Erstkommunion zu entkoppeln
Pius X. (1903–1914) hat die Gläubigen zu häufigerer Kommunion ermutigt und das Zweite Vatikanische Konzil hat eine tiefere Einsicht in Eucharistie und Bußsakrament bringen wollen. De facto wurde in der Konstitution über die heilige Liturgie die enge Verbindung zwischen Kommunion und Beichte entkoppelt.
Der „Rahmenplan für die Glaubensunterweisung“, der 1967 vom Deutschen Katechetenverein erstellt und von den katholischen Bischöfen Deutschlands herausgegeben wurde, sah vor, die Erstkommunion im zweiten Schuljahr zu halten, die Erstbeichte aber erst im vierten. In vielen Pfarren hielt man sich daran. 1972 hat sich die römische Kleruskongregation dagegen ausgesprochen, aber ohne es direkt zu verbieten. 1973 jedoch forderte Rom die Beendigung dieses Experimentes. Das führte zu erheblicher Unruhe in vielen Pfarren Deutschlands. Die gemeinsame Synode der Bistümer Deutschlands 1971–1975 in Würzburg sah die Bußerziehung als „durchlaufende Aufgabe der christlichen Erziehung“, getragen von der ganzen Gemeinde. Für den Zeitpunkt von Erstbeichte und Erstkommunion sei die konkrete Glaubenssituation des Kindes und vor allem seiner Familie entscheidend. Dennoch mahnte die Synode, „in der Regel“ die Hinführung zum Bußsakramente mit der Vorbereitung auf die Erstkommunion zu verbinden. Die Praxis blieb unterschiedlich.
In der Erzdiözese München beispielsweise wurde unter Kardinal Julius Döpfner eine Neuregelung zum Bußsakrament „ad experimentum“ eingeführt. Beichte und Erstkommunion wurden getrennt, um die Kinder nicht zu überfordern. Als Joseph Ratzinger 1977 Erzbischof wurde und nach drei Monaten auch Kardinal, stoppte er auf Weisung Roms dieses Experiment. In einem Brief an die Pfarrer argumentierte er, dass es dagegen auch theologische Gründe gebe. Nicht alle Pfarrer folgten dieser Anweisung, später kam es zu einem Kompromiss.
Auch in Österreich haben manche Pfarrer die Beichte in die vierte Klasse verschoben. Ich glaube nicht, dass theologische Gründe dagegen sprechen, eher pastorale. Gerade im Erstkommunionjahr ist die Hinwendung der Kinder und ihrer Familien zum Glauben, zu Kirche und Gemeinde sehr stark, sodass auch die Beichte in diesem Rahmen größere Aufmerksamkeit erfährt. Aber das Schwergewicht müsste doch auf der Hinführung zur Begegnung mit Christus im Altarsakrament liegen. Eine Feier der Versöhnung kann verschiedentlich aussehen, es muss nicht immer die Beichte sein.
Unvorbereitet zur Kommunion gehen?
„Jeder soll sich selbst prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken“, rät der Apostel Paulus der Gemeinde von Korinth (1 Kor 11,28) und bei Matthäus mahnt Jesus, sein Opfer erst zum Altar zu bringen, wenn man sich versöhnt hat (vgl. Mt 5,23). Auch Kinder können verstehen, dass man nicht in die Tischgemeinschaft mit Jesus passt, wenn man mit anderen in Zwist und Streit lebt. Dass das Mahl der Liebe nur würdig empfangen wird, wenn man um Liebe bemüht ist. Daher sollte in der Vorbereitung auf die Erstkommunion ernst über Versöhnung gesprochen werden und dann auch ein schönes Fest der Versöhnung gefeiert werden. So nennt man heute übrigens auch die Beichte. Aber vielleicht ist eine gemeinschaftliche Feier erlebnisreicher als die individuelle Beichte. Schließlich hat uns gerade das Konzil gelehrt, wieder die verschiedenen Formen der Sündenvergebung zu feiern. Auch dort werden Sünden vergeben, so es nicht „schwere“ sind. Übrigens ist nach CIC can. 988 § 1 die Beichte nur für schwere Sünden verpflichtend. Und kommen diese im Leben eines siebenjährigen Kindes überhaupt vor? Für die Sünden eines Kindes passt nicht das Bild des „verlorenen“ Sohns mit dem barmherzigen Vater, der neu mit dem Festtagskleid, der Gnade, bekleidet werden muss. Eher doch das Bild der Kinder, die zu Jesus drängen und die er umarmt und vor den Eltern segnet.
Neun Mal Kommunion am Herz-Jesu-Freitag – Garantie für die Seligkeit?
Jugendliche tun sich heute schwer mit der heiligen Messe. Sie haben nur selten eine innere Beziehung zum Geheimnis der Eucharistie gefunden, beurteilen die Messe daher vor allem nach der äußeren Gestaltung. „Warum ist die Messe immer so schnarchlangweilig?“, schrieb mir ein Mädchen vor der Firmung. Ich bewundere ihre Wortschöpfung, bin aber traurig über diesen Eindruck. „Die Pfarrer sollten kreativer sein“, klagt ein anderer Firmling. „Ich gehe regelmäßig zur Messe“, teilt mir stolz ein Jungscharführer mit, „einmal im Monat“. Ja, das ist auch regelmäßig, aber was ist an den anderen Sonntagen? Und selbst wenn der Wille da wäre, die Beginnzeiten der Sonntagsgottesdienste sind für Jugendliche heute immer zu früh. Das wird noch ärger, wenn Priester immer mehr Pfarren betreuen und ihren Sonntag in einer Pfarre schon um 7.30 Uhr beginnen müssen.
Jugendliche tun sich heute schwer mit der Messe. Das war aber nicht immer so. Als junger Priester habe ich das anders erlebt.
Was hat früher die Messe attraktiver gemacht?
In meiner Kaplanszeit in den 1950er Jahren habe ich eine Jugend erlebt, die ein ungezwungenes Verhältnis zur heiligen Messe hatte. Grund dafür war nicht die „alte Messe“, der heute wieder manche, auch Jugendliche, nachtrauern, es waren verschiedene Umstände, die gleichsam zur Messe „einluden“.
Da war einmal die Tatsache, dass die Eucharistiefeier in der Gesellschaft eine besondere Wertschätzung erfuhr. Die Sonntagsmesse war für viele eine Selbstverständlichkeit, nicht wenige feierten sogar an Wochentagen mit. Dann war die erlebte Gemeinschaft. Jungschar- und Jugendgruppen nützten viele Gelegenheiten, zusammenzukommen, so auch Andachten und Gottesdienste. In meiner Jugendzeit hatten wir in der Pfarre St. Ulrich jeden Mittwoch um 6.15 Uhr eine Jugendmesse. Es kamen erstaunlich viele, auch weil wir uns treffen wollten. Und schließlich machte oft der Jugendkaplan die Messe „attraktiv“. Nicht durch ein besonderes Ritual oder gewagte Experimente, sondern – wie erstaunlich – durch die Predigt. Als ich in meiner Jugendzeit mit der Pfarre auf Sommerlager war, feierten wir ohne Frage täglich die Messe und hörten unseren jungen „Pater“ gerne. Als Kaplan fuhr ich auf Jungscharlager und auch dort feierten wir täglich die heilige Messe. Es gab kein Murren, es gehörte einfach zum Tagesablauf dazu. Manche gingen sogar während des Lagers zwischendurch zur Beichte.
Es war erfreulich, dass die Jugend der Messe aus diesen Gründen näherkam. Bedenklich aber ist, wenn es dabei bleibt und die jungen Leute nicht auch zur persönlichen Begegnung mit Christus kommen. So schien eine versäumte Messe dann eher den Gemeinschaftssinn zu verletzen oder den Kaplan zu kränken, wurde aber nicht als Geringschätzung der Einladung durch Christus, den Gastgeber, empfunden.
Herz-Jesu-Verehrung verständlich für Jungscharkinder?
In den 1950er Jahren wurde die Herz-Jesu-Verehrung besonders betont. Unter anderem wurde eine der vielen Verheißungen an die hl. Margareta Maria Alacoque (1647–1690) verbreitet. Die Verheißung verspricht: „Wer an neun aufeinanderfolgenden ersten Monatsfreitagen die heilige Kommunion empfängt, wird eine gute Todesstunde haben und die Seligkeit erlangen.“ Als junger Kaplan gefiel mir diese Verheißung sehr und ich erzählte sie meiner großen Jungschargruppe. Zu meiner Überraschung waren etliche bereit, auf diese Verheißung einzugehen. Sie kamen am Herz-Jesu-Freitag regelmäßig zur Messe, beichteten vorher und gingen zur Kommunion. Ich weiß nicht, wie viele die neun Freitage „aufeinanderfolgend“ durchhielten. Sonst hätte man ja laut Verheißung wieder von vorne anfangen müssen. Aber ich freute mich riesig, für die Jugend ein neues Motiv für Messe und Kommunion gefunden zu haben.
Heute wäre solches sicher nicht mehr möglich. Ich würde es auch nicht mehr tun. Denn rückblickend bekomme ich auch schwere Bedenken. Einmal, dass ich den Eindruck erweckte, man könne sich sein Heil „verdienen“. Zum anderen habe ich es versäumt, gerade an diesen neun Freitagen die Jugendlichen dem Geheimnis der Eucharistie persönlich näherzubringen, in der wir ja das Gedächtnis dessen feiern, der „sein Herzblut für alle vergossen“ hat.
2. Kapitel
Das Messverständnis, als ich Priester wurde
Während meiner 60 Priesterjahre hat sich der Ritus der Messe in der lateinischen Kirche mehrmals verändert. Ich musste einige Male „umlernen“. Es war einerseits ein Zeichen der Lebendigkeit der Kirche, andererseits aber auch das Ringen, das Wesen der Eucharistie immer deutlicher werden zu lassen, dem immer näher zu kommen, was Jesus uns zu seinem Gedächtnis hinterlassen hat.
Wie ich im Priesterseminar Messe „lesen“ lernte
Alle, die etwas von Liturgie verstehen, werden mich rügen, dass ich Messe „lesen“ schreibe. Die Messe feiert man doch. Das weiß ich. Aber was ich in Vorbereitung auf meine Priesterweihe lernte, war tatsächlich, die Messe zu „lesen“. Es waren die genauen Vorschriften für den Priester, wie er den Ritus der Messe zu vollziehen habe.
Minutiöse Regieanweisungen für den Vollzug der Messe
Im letzten Jahr vor der Priesterweihe gab es viele sogenannte Hausstunden, die uns in den Vollzug der Messe einführten. Man sagte uns, wie wir die Hände halten müssen: gefaltet oder ausgebreitet und dann in welcher Höhe. Daumen und Zeigefinger müssen wir nach der Wandlung, da wir ja die heilige Hostie berührten, geschlossen halten bis nach der Kommunion. Hierauf wird über die Finger Wein und Wasser gegossen, und die Ablutio, wie es fachmännisch heißt, trinkt dann der Priester. Jetzt ist man sicher, dass auch nicht das kleinste Stückchen der Hostie mehr an den Fingern klebt.
Es gibt drei Arten von Verneigungen: die kleine, die mittlere und die ganz tiefe. Das Messbuch muss einmal rechts, dann links stehen. Die Auswahl der Gebete ist streng vorgeschrieben. Vor der Kommunion der Gläubigen betet der Ministrant noch einmal wie beim Stufengebet das Confiteor und der Priester darauf erneut die Vergebungsbitte. Obwohl seit Pius X. die Kommunion der Gläubigen häufiger war, erinnert dieser doppelte Ritus der Vergebungsbitte (Stufengebet und jetzt) daran, dass nach der ursprünglichen Form der „tridentinischen“ Messe die Kommunion des Volkes innerhalb der Messe gar nicht vorgesehen war.
Eine Reihe von Gebeten mussten wir auswendig lernen, so zum Beispiel jene, die beim Anlegen der liturgischen Gewänder zu beten waren. Etwa beim Schultertuch, das zuerst über den Kopf zu ziehen war, beteten wir: „Leg mir o Gott den Helm des Heiles auf das Haupt, um den Anfeindungen des Teufels widerstehen zu können.“ Beim Binden des Zingulums beteten wir: „Umgürte mich Herr mit dem Gürtel der Reinheit und lösche in meinen Lenden die Quellen der Begierlichkeit, damit in mir die Tugend der Enthaltsamkeit und Keuschheit bleibe.“
Nach der Messe wurden wir verpflichtet, uns auf die Stufen des Altares zu knien und die sogenannten Leonianischen Gebete zu verrichten. 1884 hatte sie Leo XIII. vorgeschrieben, daher ihr Name. Es war das einzige Gebet, das wir mit der Gemeinde in der Muttersprache verrichteten. Wir beteten drei Ave Maria, dann das Salve Regina und schließlich ein Gebet zum Erzengel Michael. Es war eigentlich ein Exorzismus gegen „alle bösen Geister“: „Heiliger Michael, verteidige uns im Kampf gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels. Stoße den Satan und die anderen bösen Geister durch die Kraft Gottes in die Hölle.“ Zuerst war dieses Gebet für die Bekehrung der Sünder gedacht, dann gegen die Feinde im Kirchenstaat, schließlich unter Pius XI. und Pius XII. für die Bekehrung Russlands und damit gegen den Kommunismus. Den Kommunismus hatte die Kirche damals mehr gefürchtet als den wachsenden Faschismus. Gleich zu Beginn des Konzils – ich erlebte das in Rom – wurden diese Gebete abgeschafft. Vor wenigen Jahren aber traf ich bei einer Visitation in Wien einen Pfarrer, der das Gebet zum hl. Michael mit seinen Ministranten nach jeder Messe in der Sakristei betete. Ich weiß nicht, mit welcher Intention oder welchen Teufel er seinen Schützlingen da an die Wand gemalt hatte.
Am Rückweg vom Altar war der Lobpreis der drei Jünglinge im Feuerofen zu beten mit Psalm 150 und eine darauf folgende Oration. Dafür hatte Papst Pius XI. am 3. Dezember 1938 einen Ablass von fünf Jahren gewährt, und wenn man dies einen ganzen Monat tat, konnte man sogar einen vollkommenen Ablass gewinnen. Darüber hinaus sah das Messbuch noch eine Reihe sehr schöner Gebete als Vorbereitung und Danksagung der Messe vor, die man nach eigenem Gutdünken auswählen konnte. Als Ministrant erlebte ich noch, dass die Steyler Missionare aus St. Gabriel, die unsere Pfarre betreuten, tatsächlich vor und nach der Messe still hinknieten und diese Gebete andächtig verrichteten. Zerstreuendes Geschwätz vor der Messe in der Sakristei gab es damals keines.
Was lernte man da eigentlich für die Messe?
Wenn ich das jetzt hier niederschreibe, wundere ich mich, dass wir bei diesen Hausstunden nicht mehr Kritik geübt haben. Wir waren doch alle durch die Liturgische Bewegung eines Pius Parsch auf eine Erneuerung der Eucharistiefeier vorbereitet und hatten schon sogenannte Betsingmessen erlebt und mitgestaltet. Das setzte man im Priesterseminar offenbar voraus, und solche Messen wurden in der Seminargemeinschaft am Morgen ja auch immer wieder gefeiert. Notwendig erschien aber, uns nun das starre Gerüst von Vorschriften und Rubriken beizubringen, was uns nicht weiter störte. Wir wollten alle Priester werden und unsere große Sehnsucht war, dazu geweiht zu werden, die heilige Messe feiern zu können. Es war uns klar, dass wir das im Auftrag der Kirche und in Verantwortung ihr gegenüber tun. Ihr also steht es zu, die Ordnung für die Sakramente aufzustellen und zu achten, dass sie würdig und gültig vollzogen werden. Dazu wussten wir uns mit den Priestern der ganzen Welt, so sie dem lateinischen Ritus angehörten, bis ins kleinste Detail verbunden. Der Panzer der liturgischen Vorschriften schützte den Vollzug der Messe vor Eigenwilligkeiten. Die Strenge, mit der die Rubriken vor dem Konzil oft eingeklagt wurden, hat auch die Ehrfurcht vor dem heiligen Geschehen bewusst werden lassen. Dennoch klage ich darüber, dass damals die heilige Messe nur vom Priester her gesehen wurde und die Gültigkeit des sakramentalen Geschehens von äußerer Erfüllung abhängig gemacht wurde. Das hat dazu geführt, dass die Messe vor dem Konzil eine reine Priesterliturgie war, bei der die Gläubigen, so sie da waren, der Messe „anwohnten“ und sie „anhörten“, wie es in den Kirchengeboten wörtlich hieß, aber sich sonst nicht beteiligten.
Das betont sogar noch die Enzyklika Mediator Dei von Pius XII. aus dem Jahr 1947, die sonst erste Anstöße zu einer Liturgieerneuerung gab. Dort heißt es: „Das erhabene Altarssakrament wird mit der Kommunion der göttlichen Speise abgeschlossen. Um jedoch die Vollständigkeit dieses Opfers zu erreichen, ist, wie alle wissen, lediglich erforderlich, dass sich der Priester an der himmlischen Nahrung erquickt, nicht aber, dass auch das Volk – was übrigens höchst wünschenswert ist – zur heiligen Kommunion hinzutritt“ (DH 3854). Betont wird das eucharistische Opfer: „Das heilige Mahl aber gehört zu seiner (= des Opfers) Vervollständigung und zur Teilhabe (am Opfer) durch die Vereinigung mit dem erhabenen Sakrament, und während sie für den Diener, der das Opfer darbringt, ganz und gar notwendig ist, ist sie den Christgläubigen lediglich nachdrücklich zu empfehlen“ (ebd.).