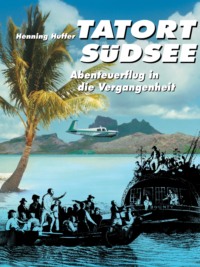Kitabı oku: «Tatort Südsee»

Henning Huffer
Tatort Südsee
Abenteuerflug
in die Vergangenheit
Vorwort
Bis heute zählt die Meuterei auf der Bounty zu den bekanntesten Schiffsrevolten der christlichen Seefahrt. Seit im Jahre 1789 jene Handvoll Männer den Dreimaster in ihre Gewalt brachte und sich auf eine Reise ohne Wiederkehr begab, ist die Südsee der Inbegriff nostalgischer Verheißung.
Vieles von dem, was sich damals zwischen Tonga und Tahiti zugetragen hat, zerfloß mit der Intuition kreativer Romanschreiber. Anderes verschwand hinter der Fassade glitzernder Hollywood-Produktionen. Einiges ist noch heute dunkel und geheimnisvoll.
Wieviel vom Bounty-Mythos ist Wahrheit, wieviel Legende? Was sind das für Inseln, die der Bounty zum Schicksal wurden? Welches waren die wirklichen Hintergründe der Meuterei? Und: Was ist aus den Meuterern und ihren Nachkommen geworden?
Dort, wo alles geschah, habe ich versucht, Antworten zu finden. Die Ereignisse, denen ich nachgegangen bin, sind Geschichte. Und doch sind sie voll lebendiger, mitreißender Anziehungskraft. Kaum jemand, der inmitten der vielen so vollendet ineinander greifenden Sachzwänge nicht selber schon mit der Idee geliebäugelt hat, einen Strich zu ziehen, auszubrechen aus dieser spröden Assekuranzwelt, irgendwo auf einem fernen, sauberen Stückchen Erde neu anzufangen. Und wer spürt nicht dann und wann in sich die Sehnsucht nach dem großen Abenteuer?
Mir ist es so ergangen. Mein Element wurde die Fliegerei. Und beim Entdecken neuer Horizonte kam es zu diesem Flug in die Vergangenheit, zu einer Zeit, als die Satellitennavigation noch nicht in Gebrauch war.
Henning Huffer
„Das ist die beste Beschreibung, welche ich von diesen Inseln zu geben vermochte und von ihren Bewohnern, die zweifellos die Glücklichsten sind auf dem Antlitz der Erde.“
Aus dem Tagebuch von Bounty-Meuterer James Morrison, 1792
In der Hoffnung, daß es nach 200jähriger Kolonialepoche auch den letzten Bewohnern der Südseeinseln gelingt, aus noch immer andauernder französischer Abhängigkeit freizukommen.
Henning Huffer, 1998
1. Begegnung in Tonga
Es war Mitsommernacht gegen 3.00 Uhr morgens. Über zehn Stunden saß ich bereits im Cockpit, umgeben von Zusatztanks und in einem Zustand visionärer Müdigkeit. Unter mir, knapp 4 km weg, lag der Stille Ozean in samtenem Schwarz, darüber wölbte sich ein sternenklares Firmament von poetischem Tonus. Nach meinen Berechnungen befand ich mich halbwegs zwischen Samoa und Hawaii.
In dieses Schweben zwischen Wachsein und Traum stiegen Erinnerungen auf an meine zu Ende gegangene Zeit in der Inselwelt der Südsee, von der ich mit geschätzten 230 km/h in Richtung Norden Abstand gewann. Einer, der mir dabei in den Sinn kam, war Bill Verity. Der Amerikaner durchstreifte damals auf ähnlich unkonventionelle Weise den Pazifik wie ich. Ihm war es geglückt, einer Fernsehgesellschaft ein bescheidenes Reisebudget abzuhandeln mit der Idee, in einem offenen, bloß 7 m langen Boot von Tonga 6000 km über offene See nach Indonesien zu kreuzen. Er nahm aus freien Stücken das bedauernswerte Los einer Gruppe von Seeleuten auf sich, die diese halsbrecherische Tour vor 200 Jahren unfreiwillig durchstehen mußten. Es war die Fahrt von Captain Bligh und seiner Getreuen, die Verity sich zur Nachahmung auserwählt hatte. Diese Herren waren bekanntlich im Anschluß an eine Meuterei mitten im Pazifik in einem Ruderboot ausgesetzt worden.
Ich war Verity zufällig auf Tonga begegnet, einige Tage vor meinem Abflug. Schon ein kursorischer Blick auf sein Duplikat des Bounty-Kutters weckte Zweifel, ob Verity sich wirklich mit der nötigen Präzision dem Original verpflichtet fühlte.
„Hm, ich bin nicht sicher, Bill“, gab ich vorsichtig zu bedenken „ob Captain Bligh damals einen Außenbordmotor mit ...“
„Dafür hatte er 18 Begleiter in seinem Boot, die er bei Windstille abwechselnd rudern ließ“, fiel Verity mir ins Wort und zog trotzig an seiner Pfeife.
Okay, den Motor konnte man durchgehen lassen. Denn Verity nahm tatsächlich keine Ruderer mit. Nicht so gut konnte er freilich seine 5 m hohe Gitterantenne am Heck des Bootes verteidigen, die zusammen mit einem Funkgerät die Verbindung zur Außenwelt sicherte. Ansonsten war aber das Schiffchen samt Ausrüstung der historischen Vorlage exakt nachempfunden, wie Verity seinen Besuchern anhand eines zeitgenössischen Bauplans nachwies.
Obwohl das Vorhaben keine besondere Faszination auf mich ausübte, hätte ich hier oben in meinem Cockpit gerne gewußt, wie es Verity unterdessen ergangen war und wo in diesem endlos weiten Weltmeer er sich mit seinem Boot gerade befand.
Mein Flugzeug jedenfalls lag gut in der Luft, ruhig wie ein Brett. Der Motor lief gleichmäßig. Die Breiten um den Äquator („Kalmen“) sind ja bekannt für Windstillen, früher ein spürbares Handikap für die Seefahrer.
Warum es Verity ausgerechnet das strapaziöse Erlebnis des harschen Kapitäns angetan hatte? Mein Interesse und meine Sympathien galten eher den Meuterern. Diese Leute hatten sich gewiß eine prächtige Zeit gemacht, nachdem sie den alten Scharfmacher los waren.
Ich vermochte mich mühelos in ihre Lage zu versetzen. Ja, es bedurfte nicht viel Phantasie, genau das Empfinden aufkommen zu lassen, welches diese Männer gehabt haben mußten: allein inmitten eines unermeßlichen Ozeans, abgeschnitten von allen Verbindungen zur Heimat, die Inseln der Träume in Griffweite und doch insgeheim die Angst vor einer ungewissen Zukunft. Sicher war für sie nur eines: Ein Zurück gab es nicht mehr. Immerhin war nicht ausgeschlossen, daß Capt. Bligh nach England durchkam. Und dann würde die britische Admiralität gewiß nichts unversucht lassen, dieser Männer habhaft zu werden.
Wenn alles nach Plan lief, lagen noch rund 11 Stunden Flugzeit, also etwas mehr als die Hälfte der Strecke vor mir. Der rückwärtige Zusatztank, ein 200-Liter-Faß, war bereits leer geflogen. Der Tank rechts neben mir, wo sich normalerweise der Copilotensitz befand, sollte noch etwa dreiviertel voll sein, und die beiden Standardtanks in den Tragflächen waren noch unangetastet. Insgesamt konnte ich noch mit einem Spritvorrat von ca. 350 Litern rechnen. Das entsprach 12 Stunden Flugzeit und ergab, wenn die meteorologischen Daten zum Höhenwind zutrafen, eine Reserve von einer guten Stunde.
Was wohl aus den Bounty-Meuterern geworden ist? Die Frage begann mich zu beschäftigen. Wie hatten sie ihr Los gemeistert? Auf welchen Inseln hatten sie Zuflucht gesucht? Vielleicht war eine darunter, auf der auch ich gewesen bin und gleichfalls mit dem Gedanken gespielt habe, nicht mehr nach Hause zurückzugehen.
Situationen so überwältigender Verlassenheit öffnen das Gemüt offenbar besonders tief für Eingebungen jenseits von Zeit und Raum. In mir jedenfalls setzte sich in jener Nacht eine sehnsuchtsvoll-schwerblütige Neugier nach dem Geschick der Bounty-Meuterer fest.
Über 21 Stunden Flugzeit waren es am Ende, als ich zur Mittagsstunde in Honolulu eintraf. Einige Tage später brachte ich auch die 4000 km nach San Francisco hinter mich. Nach drei ruhelosen Monaten in Amerika traf ich Ende Oktober auf meinem Heimatflugplatz Karlsruhe ein. Und noch immer gingen mir die Bounty-Meuterer durch den Sinn und jene nächtlichen Träumereien über dem Pazifik.
Die Idee saß tief. Das Herz war voll. Die Sehnsucht brannte. Ein intensives Arbeitspensum, unerwartet günstige Geschäfte, eine Reihe intelligenter Weichenstellungen mit diversen Geldgebern und schon sieben Monate später fand ich mich wieder hinter dem Steuerknüppel meiner Mooney, um in der Südsee nach den Spuren längst verstorbener Seefahrer zu suchen, nach den Schicksalen der Bounty-Meuterer, denen ich mich schon so nahe gefühlt hatte.
2. Gegenwart und Geschichte
„Ich benötige Material über Capt. Bligh und die Bounty“, sagte ich. Dr. Vincent S. Kitching, ein jüngerer Gelehrter mit weit geschnittener, brauner Tweedjacke und moosgrünem Binder, war augenblicklich im Bilde. Er entfernte sich mit einem kurzen, indifferenten Kopfnicken. Zehn Minuten später erschien er wieder und legte behutsam einen schweren, handgeschriebenen Folianten auf den Tisch: das Original-Logbuch der Bounty, verfaßt von Captain William Bligh.
Mein Anliegen war vordergründig nicht das Analysieren historischer Dokumente. Entschieden mehr zog mich der Gedanke an, die Uhr in jene Zeit zurückzudrehen und ebenso verwegen wie die Bounty-Besatzung, sozusagen mit der Hand am Pulse des Lebens, der Vergangenheit vor Ort auf den Grund zu gehen. In der endlosen Weite des Stillen Ozeans wollte ich herausfinden, womöglich nacherleben, was jener Handvoll Männer widerfahren war, als sie in einem spontanen Handstreich der Heimat für immer Lebewohl sagten und ihre lebenslange Flucht im sagenumwobenen Inselreich der Südsee besiegelten.
Gleichwohl: Ganz ohne Quellenstudium einem so geschichtsträchtigen Ereignis nachzuspüren, erschien mir dann doch zu oberflächlich. Als ich an einem sonnigen Maitag am Flugplatz Karlsruhe den Triebwerkshebel auf Vollgas schob und meine kleine Mooney Chaparral steil in Gottes blauen Himmel zog, hatte ich mir bereits vorgenommen, erst einmal in London Station zu machen und nach bewährtem wissenschaftlichem Brauch in den Archiven der britischen Admiralität den Forscherpult zu drücken.
Um hohe Landgebühren und Wartezeiten in der Luft zu vermeiden, entschied ich mich für Stansted, den ruhigsten der vier Londoner Flughäfen. Stansted liegt 40 km nordöstlich von London. Mein Flug dauerte etwas über drei Stunden. Ein Taxi brachte mich in das nahe gelegene Städtchen Bishop’s Stortford. Dort nahm ich einen Vorortzug, der nach einer knappen Stunde Fahrzeit in den belebten Bahnhof Liverpool Street Station in Londons Stadtzentrum einrollte.
Am Beginn der Chancery Lane, nur ein paar Straßenecken entfernt von der Stelle, wo ich nach kurzer Fahrt im ersten Obergeschoß eines scharlachroten Doppeldeckerbusses mich zu Fuß weiterbegab, dirigierte mich ein hilfsbereiter Passant zum Public Record Office, dem meine Reise galt.
In diesen düsteren Mauern wob der Geist der Geschichte. Man brauchte nur den Fuß über die Torschwelle des neugotisch gestalteten, reich verzierten Baues zu setzen, um den Atem vergangener Jahrhunderte zu spüren. Bis unters Dach waren die weitläufigen Lesesäle und Wandelgänge des königlich-britischen Staatsarchivs gefüllt mit Urkunden, Büchern und Handschriften, unbestechlichen Zeugen von Englands leuchtender Vergangenheit.
In einer ebenmäßigen, leicht lesbaren, wenn auch stark vergilbten Schreibschrift war auf dem schweren Pergament des Logbuchs minuziös der wechselvolle Verlauf von Capt. Blighs Fahrt in die Südsee aufgetragen. Doch nicht nur das. Das Logbuch enthielt umfangreiche völkerkundliche Detailschilderungen, liebevoll eingeflochtene Beobachtungen aus der Tierund Pflanzenwelt. Es war gleichzeitig noch Tagebuch und Reisebericht.
Ausgiebig schildert Capt. Bligh die Meuterei und liefert genaue Personenbeschreibungen der Meuterer. „Piraten“ brandmarkt er sie, weil sie ihm ja nicht nur das Kommando entrissen, sondern obendrein noch das Schiff weggenommen haben.
Noch während ich staunend dieses erstaunliche Schriftwerk in mich aufnahm, ließ Dr. Kitching durch einen Mitarbeiter bereits das nächste Aktenkonvolut auf meinem Lesepult absetzen. Es enthielt die Originalprotokolle des Kriegsgerichtsverfahrens, in dem die Meuterei auf der Bounty verhandelt worden war. Auch darin fand sich eine Fülle aufregenden Lesestoffs. Bei den umfangreichen Zeugenverhören, Urkundenverlesungen und Plädoyers, die peinlich genau aufgezeichnet waren, blieb kaum ein Detail des dramatischen Geschehens unerwähnt.
Das Public Record Office entpuppte sich als eine Fundgrube von Format. Ich fand mehrere Briefe, die Capt. Bligh von unterwegs an die Admiralität geschrieben hatte. Selbst ein vergleichsweise so nebensächliches Schriftstück wie die Musterrolle der Bounty war noch erhalten. Sie gab Auskunft über die Namen aller Besatzungsmitglieder, ihren Rang, ihr Alter. Sogar ihre Geburtsorte waren notiert.
Dr. Kitching wies mich darauf hin, daß zu diesen Originalia populärwissenschaftliche Abhandlungen und Monografien erschienen waren. So wechselte ich später zur Bibliothek im Britischen Museum und begann, das Bounty-Schrifttum zu sichten. Das erwies sich als eine literaturwissenschaftliche Aufgabe ungeahnten Ausmaßes. Was seit 1789 zu diesem Thema (ganz überwiegend in englischer Sprache) publiziert worden ist, läßt sich nicht mehr überblicken. In mein Literaturverzeichnis trug ich ein: „Die wahre Geschichte der Meuterei auf der Bounty“, „Die Ursachen der Bounty-Meuterei“, „Was geschah auf der Bounty“, „Die ereignisreiche Historie der Meuterei und des Piratenraubs der H.M.S. Bounty“ und Ähnliches in großer Zahl. Mit jedem weiteren Buch, das ich aufschlug, stieß ich auf neue, verblüffende Quellen.
Drei Wochen sah man mich als emsigen Bücherwurm von früh bis spät zwischen Public Record Office und Britischem Museum hinund hereilen im eifrigen Bemühen, den Überblick über die immer weiter anschwellende Literatur zu behalten.
Es kam die Zeit, die Gedanken auf die Reiseroute zu richten. Daß ich meinen Transport in eigene Hände genommen hatte, erwies sich als eine Maßnahme von feinem Gespür. Nur wenige Inseln, an denen die Bounty anlegte, lassen sich ohne weiteres mit dem erreichen, was man gemeinhin unter öffentlichen Verkehrsmitteln versteht. Vorteile versprach vor allem der kompakte Zuschnitt meines Flugzeugs. Diese Eigenschaft ermöglichte mir Zugang auch zu den lauschigen Korallenpisten entlegener Atolle, dorthin also, wo Interkontinentaljets für immer ausgeschlossen waren.
Auf der anderen Seite finden sich im Pazifik Strecken von beträchtlicher Abmessung. Hier hätte unstreitig ein stabileres Gefährt die Aussichten auf eine sichere Rückkehr in die Heimat vergrößert. Freilich ohne den Kitzel des Abenteuers, ohne das schwärmerische Gefühl, sich den Pazifik mit eigener Kraft und Tüchtigkeit zu erobern, äußert eine solche Reise nur den halben Reiz.
Beladen mit Manuskripten, Büchern und neuen, beachtlichen Geschichtskenntnissen strebte ich von der Themsestadt in Richtung Schweden.
3. Nach dem höchsten Willen seiner Majestät
„Seine Majestät der König geruhet gnädigst die Vorstellung der Kaufleute und Pflanzer seiner westindischen Besitzungen für gut zu finden, daß die Einführung des Brotfruchtbaumes in den dortigen Inseln den Einwohnern eine Art Nahrung und dadurch den wesentlichsten Vorteil gewähren würde. So werdet Ihr, Lieutenant William Bligh, hiermit, zufolge des höchsten Willens seiner Majestät, requiriert und angewiesen, mit dem Euch untergebenen Schiffe in See zu gehen und Euch so schnell als möglich um das Kap Hoorn nach den im Südlichen Ocean gelegenen Societätsinseln zu begeben, woselbst zufolge der Nachrichten des seligen Capt. Cook der Brotfruchtbaum in seinem üppigsten Wachstum angetroffen wird. Nachdem Ihr so viele Bäume und Schößlinge, als nöthig erachtet werden dürfen, an Bord genommen habt, sollt Ihr um das Vorgebirge der Guten Hoffnung nach Westindien gehen und die alsdann noch am Leben gebliebenen, vorerwähnten Bäume in Seiner Majestät botanischen Gärten zu St. Vincent und zu Jamaica abliefern.
Gegeben, den 20sten November 1787.
Die Lordscommissarien der Admiralität von Großbritannien und Irland.“
Mit dieser schriftlichen Order an Bord ließ Capt. Bligh am 29. November 1787 in Spithead, dem Ankerplatz der südenglischen Hafenstadt Portsmouth, Segel setzen. Das ihm untergebene Schiff war die Bounty, zu deutsch „Wohltat“. Sie galt schon damals als nicht gerade groß. Ganze 28 m war sie lang und wog 250 Tonnen, also so viel wie ein heutiger Hafenschlepper. Das Marinedirektorium hatte den Dreimaster gebraucht zum Preis von 1950 Pfund Sterling gekauft, für Umbau und Ausrüstung allerdings über 4000 Pfund aufwenden müssen. Ein Großteil davon war in die Vorrichtungen geflossen, die der Aufnahme und dem sicheren Transport der Brotfruchtpflanzen dienen sollten. Die große Kajüte, die den gesamten rückwärtigen Teil des Schiffes einnahm, war dafür in eine Art Treibhaus umgewandelt worden. Stellagen für über 1000 Töpfe, Zuber und Kasten füllten den Raum bis zum letzten Winkel. Es gab Öffnungen für Licht und Luft sowie ein feinsinniges Röhrensystem, welches das von den Pflanzen ablaufende Wasser zur Wiederverwendung in Tonnen ableitete.
Zweck aller früheren Reisen in die Südsee, so Capt. Bligh, war die Erweiterung der Wissenschaft und die Vermehrung der Kenntnisse gewesen. Die jetzige Reise hingegen stelle eigentlich die erste dar, die zur Absicht habe, aus den gemachten Entdeckungen in fernen Gegenden Vorteile zu ziehen. Um was für Vorteile es sich dabei handelte, war in dem königlichen Erlaß mit majestätischer Noblesse umschrieben. Bei genauerem Hinsehen entpuppte sich das Unternehmen aber als gar nicht so edel und selbstlos, wie die galanten Formulierungen glauben machen könnten. In dem Brotfruchtbaum, der in Westindien unbekannt war, erhofften sich die englischen Plantagenbesitzer nämlich nichts anderes als eine neue, billige Nahrungsquelle für ihre Negersklaven.
Den Anstoß hatte ein zeitgenössischer Bericht gegeben. Wenn jemand, heißt es darin, in seinem Leben zehn Brotfruchtbäume pflanzt, wozu er allenfalls eine Stunde benötigt, so hat er für seine Familie und kommende Generationen seine Pflicht so vollständig erfüllt wie ein Bewohner unseres weniger gemäßigten Himmelsstrichs, der im kalten Winter pflügt und in der Sommerhitze die Ernte einbringt, so oft diese Jahreszeiten wiederkehren.
Was ist das für eine erstaunliche Pflanze, der Brotfruchtbaum?
Von den Seefahrern, die im 17. und 18. Jahrhundert die großen Entdeckungsreisen in den Pazifik unternahmen, stammen die ersten genauen Beschreibungen des Brotfruchtbaumes. Danach läßt er sich am ehesten mit einer mittelgroßen Eiche vergleichen. Gewöhnlich hat er eine weit ausladende Krone. Seine Blätter werden bis zu einem halben Meter lang und haben tiefe, bogenförmige Einschnitte. Wie Feigenblätter geben sie einen weißen Milchsaft von sich, wenn man sie verletzt. Die Früchte selbst haben die Größe und Gestalt eines Kinderkopfes. Sie wachsen allein und bilden keine Trauben. Ein feines, netz förmiges Gewebe überzieht ähnlich wie bei einer Trüffel die hellgrüne Oberfläche.
Ehe man die Brotfrucht ißt, wird sie im Feuer geröstet. Dabei verkohlt die Rinde. Zieht man die äußere schwarze Borke ab, kommt das Eßbare zum Vorschein. Es ist weiß wie Schnee und hat beinahe die Festigkeit von frisch gebackenem Brot. Die Frucht enthält weder Samen noch Steine, sondern alles ist reine, brotähnliche Masse. Außer vielleicht einem geringen Grad von Süße besitzt das Fruchtfleisch keinen hervorstechenden Geschmack.
Mit diesem Manna, das sich buchstäblich vom Baume pflücken ließ, sollte also fortan das Gesinde auf den westindinischen Baumwollplantagen seinen Hunger stillen.
Kaum daß die Bounty ihre Anker gelichtet hatte, änderte sich das bis dahin so günstige Wetter. Ein genau von vorn einfallender, stürmischer Wind hinderte das Schiff immer wieder daran, aus der Meerenge zwischen Portsmouth und der davorliegenden Insel Isle of Wight herauszukommen. Mehr als drei Wochen lavierte Bligh mit seinen Leuten zwischen St. Helens und Spithead hin und her, ehe er am 23. Dezember 1787 bei günstigerem Wind endlich offene See gewann und im Ärmelkanal seinen Kurs in Richtung Südatlantik aufnehmen konnte.
Die Bounty hatte Proviant für ein halbes Jahr an Bord. Weil damals noch keine Kühleinrichtungen existierten, klingt die Auswahl an Lebensmitteln, mit denen die Vorratskammern im Schiffsbauch bestückt waren, für Feinschmeckerohren einigermaßen deprimierend. Neben dem obligaten Schiffszwieback fanden sich dort etwa Sauerkraut, Suppengallerte, getrocknetes Malz, Käse, Gerste und Weizen. Allerdings war Vorsorge getroffen, daß das Menü dann und wann durch eiweißreichere Kost ergänzt wurde. Zum Proviant gehörten nämlich auch einige Stücke lebendes Vieh. Leider gerieten diese armen Schweine, Schafe und Hühner bei monotoner Kost, eingepfercht in dunkle, enge Käfige und verängstigt durch das Schwanken des Schiffs, so aus ihrem seelischen Gleichgewicht, daß, wenn sie schließlich in den Kochtopf gelangten, nur selten eine größere Ausbeute an genießbarem Frischfleisch zu erzielen war.
Um mit den Insulanern Handel treiben zu können, hatte Bligh von der Admiralität einen Vorrat an Spielsachen und Eisenwaren mitbekommen. Dort, wo die Bounty hinsegelte, herrschte Steinzeit, und so konnte man die Eingeborenen mit einem Nagel, einer Schere oder ein paar Glasmurmeln in einen Taumel der Begeisterung versetzen.
Das Gebiet, in dem diese Steinzeitmenschen lebten und in dem der Brotfruchtbaum so prächtig gedieh, hieß damals der „Südliche Ocean“, heute bekannt unter dem Namen Südpazifik, kurz auch Südsee geheißen. Es ist der südlich vom Äquator liegende Teil des größten Weltmeeres. Im Westen von Australien und Asien, im Osten von Amerika begrenzt, bedeckt der Stille oder Pazifische Ozean mehr als ein Drittel der gesamten Erdoberfläche.
Die Mehrzahl der zigtausend kleinen und kleinsten pazifischen Inseln liegt in der Südsee, so auch die Gruppe der Societätsinseln, zu denen die Bounty unterwegs war. Dieses Archipel, das in modernen Karten den Namen Gesellschaftsinseln trägt, besteht aus 14 Inseln. Die größte und bekannteste unter ihnen ist Tahiti, und auf ihr sollte sich Capt. Bligh die Brotfruchtbäume besorgen.
18000 km waren es bis Tahiti, vorausgesetzt die Reise verlief nach Plan. Doch kaum auf hoher See wurden Bligh und seine Männer bereits auf die erste Zerreißprobe gestellt. Einen Tag nach dem Weihnachtsfest, das sie noch froh hatten begehen können, wurden sie von einem gewaltigen Sturm überrascht.
„Eine Welle brach über uns und schwemmte unseren Vorrat an Stengen und Rahen von einer Seite des Püttings gänzlich mit sich fort; eine andere noch furchtbarere Welle kam in das Schiff und zertrümmerte unsere Boote. Einige Fässer mit Bier, die wir auf dem Verdecke befestigt hatten, wurden losgerissen und weggeschwemmt, und es kostete viel Mühe und Gefahr, die Boote so zu sichern, daß sie nicht ganz über Bord gingen.“
Drei Tage wütete der Sturm, und die Mannschaft mußte viel ausstehen. Die Bounty schwamm auf der Höhe von Portugal, als sie von dem Unwetter heimgesucht wurde. Wie sich zeigte, war dies allerdings erst ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte.
4. Westwärts
Christer Friberg war Schwede und Seemann von Beruf. Das Leben zwischen Hafenstädten und Meer, Wohnen und Arbeiten in der Fortbewegung, verlangt eine elastische, leichtfüßige Wesensart. Sie war bei Chris spürbar.
Im Vorjahr, an einem klaren, sonnigen Morgen, hatte er mich auf der Uferpromenade in Samoa unweit des Aggie Grey’s Hotels angesprochen. Ihm war zu Ohren gekommen, daß zu der kleinen, überschaubaren Gemeinde durchreisender Weltenbummler einer gestoßen war, der diesen Ozean im Sportflugzeug durchquerte.
Ohne viel Umschweife äußerte er seine Interesse, sich mir anzuschließen, und er nannte auch gleich seine Vorstellungen, was das Reiseziel betraf: die Cook Inseln mit anschließendem Abstecher nach Tahiti.
Ich befand mich damals im Zustand nie gekannter Glückseligkeit, trotz verfahrener Lage. Meine Südsee-Expedition ging in den achten Monat, mehr als das Doppelte dessen, was das Reisebudget selbst bei gewagter Kalkulation hergab. Für den gut 25000 km langen Heimflug incl. fälliger Wartungsarbeiten an meinem Flugzeug reichte die verbliebene Liquidität schon nicht mehr.
Obwohl sich mit jedem weiteren Südseetag die Deckungslücke vergrößerte, war mein Gemüt von Sorge oder gar Zukunftsangst frei. Ich hatte ich mich lose mit der Idee angefreundet, die Passage quer über den Pazifik zu wagen und in den USA auf eine glückliche Fügung meines Geschicks zu vertrauen. Diese Route machte freilich den Einbau weiterer Zusatztanks notwendig, auf Samoa keine im Handumdrehen lösbare Aufgabe.
Meine mit geringem Enthusiasmus vorangetriebenen Planspiele wurden schlagartig Makulatur, als Chris seinen Vorschlag mit der Erklärung verband, „selbstverständlich“ für alle weiteren Reisekosten aufzukommen. Er hatte erst wenige Tage zuvor abgeheuert und nach elfmonatigem Dienst auf dem Tanker eine Brieftasche mit vielen frischen Dollarnoten im Gepäck.
Unser aus dem Stand heraus eingegangenes, zufälliges Interessenkonsortium ging ganz unverhofft in eine runde, kurzweilige Abenteurergemeinschaft über. Ihr vorzüglicher Kameradschaftsgeist überdauerte unsere gemeinsame zweimonatige Exkursion durch Polynesien und hielt sich, nachdem jeder von uns wieder in sein bürgerliches Leben eingetreten war, über einen regelmäßigen Briefwechsel lebendig. Hierbei hatte ich Chris beiläufig von meinen neuen Reiseplänen wissen lassen. Postwendend meldete er sich per Fax von hoher See: „Ich fliege mit. Wann ist Starttermin?“
Sein Heimatort Kalmar an der schwedischen Südostküste war als Treffpunkt bestimmt worden. Und dorthin begab ich mich auf direktem Weg nach Abschluß meines Londoner Studienaufenthalts.
Der Zwischenstopp in dem hübschen skandinavischen Städtchen gestaltete sich länger als erwartet. Kaum von Bord hatte Chris sein Herz an das blonde, gefühlvolle Mädchen Christina Haglind verloren. Die Beziehung war allem Anschein nach der Grund, daß er seine Reisevorbereitungen noch nicht abgeschlossen hatte, als ich in Kalmar eintraf.
Nach Erledigung der notwendigen Geschäfte und Förmlichkeiten war das traditionelle schwedische Mitsommerfest in unmittelbare Nähe gerückt und nötigte uns, den Abflug ein weiteres Mal hinauszuschieben.
Die innige Verbundenheit des jungen Liebespaares, das beständig die Hände ineinander verschlungen hielt und sich mit seelenvollem Blick süße Dinge sang, ließ mir im Verlauf dieser durchaus schönen, erlebnisreichen Tage bewußt werden, daß im Grunde ich es nun war, der dieses junge Glück so jäh unterbrach.
„Keine Sorge“, beschwichtigte mich Chris, als ich meine Bedenken zu artikulieren suchte, „wenn ich zurückkomme, heirate ich Stina. Gestern habe ich ihr den Verlobungsring geschenkt.“
„Das ist ein feiner Zug von dir“, sagte ich und ergriff seine Hand, „eine schöne Entscheidung. Ich werde euer Trauzeuge sein.“
Ein Blick auf den Globus veranschaulicht, wie weit die Südsee und Europa auseinander liegen. Die ozeanische Inselwelt findet sich einen netten halben Erdumfang von uns entfernt auf der anderen Seite dieses Planeten. Was die Distanz angeht, ist es deshalb einerlei, ob man den Weg über Amerika oder in die entgegengesetzte Richtung über Asien einschlägt. Ganz nebenbei und ohne Extrakosten eröffnet eine Südseereise den Bewohnern unseres Kontinents das Zusatzerlebnis, den Erdball zu umrunden.
„Hallo Südsee, hier kommen wir“, rief Chris vergnügt beim Abheben von der Startbahn und wies mit beiden Daumen nach oben.
Sein Abschied von Christina, von Mutter Inez, Schwester und Nichten war intensiv gewesen, aber schmerzfrei. Die Sonne lachte, als wir das traute Kalmar hinter uns ließen, und es war sommerlich warm.
Mit überschlägig veranschlagten drei Wochen fiel die Zeitspanne, die unsere Flugreise von Schweden zu den Inseln im Stillen Ozean in Anspruch nehmen würde, beträchtlich aus dem heute im Luftverkehr üblichen Rahmen. Insgesamt lagen mehr als 200 Flugstunden über Meere und Kontinente vor uns.
Gemessen an dieser Wegstrecke war unser weiß-grünes Reisegefährt nichts weiter als ein Knirps. Bei einer Länge von 7 m kam das Höchstabfluggewicht des von Mooney Aircraft in Texas hergestellten Tiefdeckers auf 1160 kg zu stehen, entsprach also gerade demjenigen eines Kleinwagens. Die Kabine bot Platz für drei schlanke Passagiere und einen Piloten. Maximal 50 kg Gepäck faßte der kleine Kofferraum hinter den Rücksitzen. Den Antrieb besorgte ein 200 PS-Einspritzmotor, der je nach Triebwerkeinstellung und Flughöhe Geschwindigkeiten von immerhin 230 bis 270 km/h ermöglichte.
Die ersten Ausläufer des norwegischen Mittelgebirges zeichneten sich am Horizont ab, als sich der Himmel zu verdüstern begann. Mehr und mehr Gewölk schob sich in unsere Flugbahn und ließ meine anfängliche Zuversicht schwinden, in dem Labyrinth pilzförmig emporquellender Cumuli noch einen Pfad zu finden, der den Namen Sichtflug verdiente.
Ein kurzer Druck auf den Steuerknüppel ließ die Flugzeugnase nach unten tauchen. Auf über 350 km/h schnellte die Tachonadel hoch. Rund 1000 m tiefer hörten die Wolken auf, und dort fühlten wir uns beträchtlich wohler.
Was sich unserem erstaunten Auge darbot, war ein Anblick von bizarrer Schönheit. Zum Greifen nah breitete sich ringsum eine kahle, menschenleere Bergwelt aus. Vereinzelte Schneefelder unterstrichen den Eindruck von Strenge und Unwirtlichkeit. Aus der wie mit dem Lineal gezogenen Wolkendecke brach sich die Sonne Bahn und durchschnitt in einem fächerartigen Strahlenkranz das fahle, beklemmende Zwielicht. Kleine, verschwiegene Seen verstärkten den Zauber geheimnisvoller Unberührtheit. Die Szenerie erinnerte intensiv an Götterdämmerung und hätte jeden Liebhaber von Wagner-Opern in einen Taumel schaurigen Entzückens versetzt.
„Zum Kuckuck! Hier kommen wir nicht durch“, entfuhr es mir in die heilige Stille.
„Sieht so aus, als ob die Wolken da vorn irgendwo aufliegen“, sagte Chris, der den hartnäckig zum Schlechteren geneigten Wettertrend ebenfalls erfaßt hatte.
„Damit müssen wir rechnen. Der Abstand zu den Bergspitzen nimmt jedenfalls seit einer Viertelstunde ständig ab. Noch eine Viertelstunde so weiter, und es macht rums.“
„Am besten wir kehren um“, sagte Chris und kratzte sich am Kopf.
„Das wäre eine Möglichkeit“, gab ich zurück. „Aber wollten wir nicht in die Südsee?“
Mit Hilfe zweier Funkpeilungen ermittelte ich geschwind unsere genaue Position, notierte auf meinem Kniebrett verschiedene Flugdaten und griff dann zum Mikrofon: