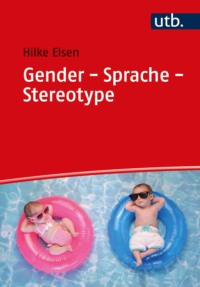Kitabı oku: «Gender - Sprache - Stereotype», sayfa 5
3.5 EvolutionEvolution, aber nicht Determiniertheit
Schließlich vertreten einige Ansätze die Meinung, dass biologische Faktoren nicht irrelevant sind. Auf der Suche nach Erklärungen, warum es etwa im Gesprächsverhalten zu Unterschieden kommt, flossen auch evolutionsbedingte Gründe mit ein, da die Arbeiten der Feministischen Linguistik für viele keine zufrieden stellenden Erklärungen für die Beobachtungen lieferten, weil sie lediglich Thesen und Vermutungen aufstellten und nicht nach Ursachen suchten. Auch der Doing gender-Ansatz erfährt Kritik: Die Universalität, die Stabilität und die psychischen Verankerungen der Geschlechterhierarchien werden nicht erklärt und dem Einzelnen wird zudem ein zu großer Handlungsspielraum beigemessen (Rendtorff 2006: 137f.). Deswegen versucht u.a. Locke (2011) zu zeigen, dass sich die großen Unterschiede zwischen Männer- und Frauengesprächen nicht über Gendereffekte, sondern über unterschiedliche biologisch bestimmte Eigenschaften erklären lassen, die ihren Ursprung in den verschiedenen Aufgaben bei der Fortpflanzung haben – „men and women speak in fundamentally different ways largely because they are outfitted by Nature to do so“ (Locke 2011: 9). Locke sieht in den Unterschieden jedoch keine Rechtfertigung für Ungleichbehandlung, vielmehr will er Frauen und Männer als sich gegenseitig ergänzend begreifen. Er betont die Vorzüge des Zusammenwirkens.
Bereits zu Zeiten der Jäger und Sammler(innen), die damals noch als egalitär zu betrachten waren, bedingten die biologischen Unterschiede vor allem die klassische Arbeitsteilung (Wood/Eagly 2012). Sie führten aufgrund des je anderen Evolutionsdrucks über viele tausende von Jahren hinweg zu Unterschieden von Körper und GehirnGehirn. Locke führt zahlreiche Belege zu universellem Verhalten, Parallelen bei anderen Spezies, höheren Testosteronwerten im Zusammenhang mit Dominanz und kindlicher Entwicklung an.
Besonders die sehr stark verbreiteten Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Sprachstilen lassen sich seiner Meinung nach schlecht als je unmittelbar konstruiert verstehen. Hier sieht Locke weniger psychologisches als vielmehr biologisches Erklärungspotenzial. Auffälligerweise sprechen kulturübergreifend Frauen eher ungern vor vielen Menschen, während Männer dazu tendieren, den öffentlichen Rahmen für die Selbstdarstellung und verbale Wettkämpfe zu nutzen, dazu gehören auch Witze, lange Monologe und Herumalbern. Wie die EvolutionEvolution uns lehrt, haben stärkere und intelligentere TiereTier bessere Überlebenschancen. Kämpfe, die jedoch nicht tödlich enden, und laute und gefährlich klingende Drohgebärden dienen dazu, den Stärksten und damit Statushöchsten auszuhandeln und damit weibliche Tiere zu beeindrucken und für die Fortpflanzung zu gewinnen. Diese wiederum bevorzugen möglichst starke Partner, die das Wohlergehen des Nachwuchses für längere Zeit gewährleisten. Bei den Menschen ersetzen verbale Gefechte die körperlichen Auseinandersetzungen. Dominanz und StatusStatus korrelieren mit Testosteron. Beispielsweise weisen Berufsschauspieler, Berufsfußballer und Prozessanwälte1 wesentlich höhere Testosteronwerte auf als andere Berufsgruppen (Locke 2011: 93). Das viele Sprechen über sich selbst, das verbale Dominanzverhalten und Statussichern entspricht der körperlichen Selbstdarstellung, etwa bei der WerbungWerbung, während das kooperative Verhalten Beziehungsgeflechte pflegt, die für die Aufzucht des Nachwuchses zwischen den weiblichen Mitgliedern einer Gruppe unentbehrlich waren.
So sieht es auch Scheunpflug (2004). Um das Überleben über erfolgreiche Reproduktion zu sichern, müssen männliche Individuen stark, gesund und schnell sein. Sie treten gegen viele andere Konkurrenten an und demonstrieren entsprechend ihre Vorteile wie körperliche Kraft oder beim Menschen hohes Einkommen und andere vergleichbare Leistungen. Sie wollen ihre Energie in möglichst junge (und viele) gesunde Weibchen investieren, müssen aber dafür lediglich Kraft für WerbungWerbung aufbringen. Im Gegensatz dazu wenden weibliche Säugetiere sehr viel Energie für Mutterschaft, Geburt, Stillen und Betreuung auf. Sie produzieren nur wenig Nachkommen und diese sind oft sehr unselbstständig und benötigen Schutz. Außerdem ist, je weniger Nachwuchs ein Weibchen hat, dieser umso wertvoller. Wenn sich das Weibchen um den Nachwuchs kümmern muss, benötigt es ebenfalls Schutz. Die weiblichen TiereTier sind deswegen auf die Hilfe durch die anderen weiblichen Mitglieder der Gruppe und das möglichst starke und mächtige Männchen angewiesen. Sie investieren darum ganz anders in den Partner: Er will sorgfältig ausgesucht sein, weil er für längere Zeit für die Gruppe bzw. das Weibchen sorgen soll, denn das Überleben der Kinder hat absolute Priorität.
Die Gruppe, die aus anderen weiblichen Mitgliedern bestand, die bei der Betreuung des Nachwuchses zusammenarbeiteten, stellte ein komplexes soziales Netzwerk dar, in dem sich die Einzelne kooperativ platzieren musste. Einige Ansätze gehen deswegen davon aus, dass die soziale Entwicklung über die weiblichen Mitglieder entstand. Die soziale Intelligenz, die mit der Größe der Gruppen korreliert, entwickelte sich zunächst über höhere kognitiveKognition, kognitiv Ansprüche und entsprechend größerem Gehirnbereich auf der Seite der weiblichen Primaten (Lindenfors et al. 2004, Lindenfors 2005, Locke 2011: 144).
Das viele Reden über Beziehungen und zwischenmenschliche Ereignisse bei Frauen entspricht einem Pflegen sozialer Bindungen, das viele Reden über sich selbst bei Männern der Selbstdarstellung und der StatusStatusdemonstration. Beides ist interpretierbar als sprachliche Entsprechung des evolutionärEvolution bedingten geschlechtstypischen Verhaltens mit dem Ziel, optimal zu reproduzieren und damit letztendlich die Art zu sichern.
Entsprechend lassen sich auch die unterschiedlichen Interessen schon im KindergartenKindergarten – Schönheit vs. Stärke – erklären: Da Männchen ihre Energie (Samen) optimal anlegen wollen, müssen die Weibchen gesund und im richtigen (jungen) Alter sein. Das Interesse auch kleiner Mädchen am Äußeren ist in diesem Ansatz ein Relikt aus den Zeiten, in denen das Äußere die für die Fortpflanzung grundlegenden Eigenschaften Jugend und Gesundheit signalisierte. Da die Weibchen um Männchen konkurrieren, mussten sie ihr Äußeres effektiv in Szene setzen. Andersherum benötigten Weibchen starke und gesunde Partner, die die Chancen auf erfolgreiche Aufzucht des Nachwuchses verbesserten. Ein starkes Männchen hat mehr Chancen bei den Weibchen. So erklärt sich die ständige Konkurrenz, die sich schon im Kindergarten zwischen Jungen oft auf körperlicher Ebene zeigt. Sie äußert sich später in StatusStatus, erfolgreicher Karriere, Einkommen und großen Autos oder aber Gewalt.
Da Männer bei der Partnerwahl potenziell das Risiko tragen, leer auszugehen, war es für sie in der Geschichte der männlichen EvolutionEvolution vorteilhaft, neben dem kommunikativen Konkurrenzverhalten eine hohe Risikobereitschaft zu entwickeln. Zudem kann die geschlechtsspezifisch hoch signifikante männliche Gewaltbereitschaft als ein Ausdruck innergeschlechtlicher Konkurrenz interpretiert werden (Scheunpflug 2004: 208).
Biologisch-evolutionäre Gründe für Unterschiede zwischen Frau und Mann werden gern dazu missbraucht, bestehende Statusunterschiede zu rechtfertigen und Veränderungen zu blockieren, die die männlichen Machtpositionen schwächen könnten. Dieser Missbrauch ist ein wichtiges Motiv für die vielfach vehemente Ablehnung des Ansatzes.
Der evolutionäre Ansatz ist nicht als Entschuldigung für stereotype Verhaltensweisen misszuverstehen, sondern als wichtig für Wissenserweiterung und die Möglichkeit, die Beobachtungen der Geschlechterforschung zu verstehen.
Zweifellos überlagert der kulturelle Fortschritt viele der angeborenen Tendenzen oder macht sie obsolet. Die durch unsere moderne Entwicklung nötige und/oder forcierte Flexibilität relativiert die genetischen Anlagen. Ganz aber verschwinden sie nicht, sonst gäbe es kein Streiten um Frauen und Macht und keine Vergewaltigungen mehr. Wir können unsere Handlungen selbst bestimmen, und je mehr wir über möglicherweise angeborene Zwänge wissen, umso eher können wir uns dagegen entscheiden und uns auch gegenseitig besser verstehen. In diesem Ansatz geht es nicht primär darum, dass Frauen und Männer nicht gleich sind. Sie sind trotz aller Unterschiede gleichberechtigt.
3.6 Abgrenzungen
Im Rahmen der verschiedenen Diskussionen werden wir auch mit thematisch nahestehenden, aber nicht unbedingt gleichzusetzenden Begriffen von Gender oder Genderstudien konfrontiert, die an dieser Stelle geklärt werden, und zwar Sexismus in der Sprache, Gender Mainstreaming und Queer Studien.
Zu Sexismus als Verhalten oder auch Ideologie zählen sexuelle Belästigung und alle offenen und unterschwelligen Formen der Benachteiligung und Unterdrückung, auch die Verweigerung von Gleichbehandlung. Dies kann sich sprachlich äußern, etwa durch Beleidigungen, üble Nachrede, falsche stereotype Beschreibungen, abfällige oder lächerlich machende Bemerkungen, Herabwürdigung von Leistungen, Ablenken von relevanten Aussagen, UnterbrechungenUnterbrechung, Ignorieren, sprachliches Unsichtbarmachen.
Gender Mainstreaming stellt eine offizielle Richtlinie der EU dar (Amsterdamer Vertrag, 1997). Es ist keine Theorie, nicht akademisch oder theoretisch, sondern als politisch-gesellschaftlicher Gleichstellungsansatz praktisch ausgerichtet. Es handelt sich um eine Strategie, mit der die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen, auch als politische Vorgabe, umzusetzen ist. Es strebt umfassend und präventiv die Gleichstellung im öffentlichen KontextKontext an und betrifft alle politischen Bereiche.
Die Queer Studies als wissenschaftliche Disziplin entstanden Anfang der 90er Jahre aus den Gay und Lesbian Studies im philosophischen und literaturwissenschaftlichen KontextKontext und beschäftigten sich weniger mit dem Gender-Aspekt als vielmehr mit Sexualität. Engl. queer ‚eigenartig, seltsam‘, aber auch ‚schwul‘, vor allem geringschätzend, bezeichnet sexuelle Randgruppen und als Queer Studies auch das theoretische Konzept. Es wertet das Thema zu einem Forschungsgegenstand auf, der sich mit Brüchen zwischen sex, gender und Begehren bzw. Praxis befasst (Jagose 2005: 15).
Jeder Ansatz hat seine eigene Vorstellung davon, wie und in welchen Gewichtungen Geschlecht und Gesellschaft interagieren. Entsprechend anders gestaltet sich aus den verschiedenen Perspektiven die Möglichkeit, zu intervenieren und für Chancengleichheit zu sorgen. Dabei wird manche eher extreme und sehr umstrittene Vorstellung wie die von Butler im vorliegenden Buch nicht behandelt.
Gender entwickelt sich immer mehr zu einem interdisziplinären Forschungsgegenstand. Grundsätzlich erweist es sich als plausibel, neben den biologischen Faktoren Unterschiede in der Sozialisation zu erkennen. Verantwortliche Erwachsene müssen daher zunächst sensibilisiert sein, um zu verstehen, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen können, Mädchen und Jungen gleichberechtigt zu fördern. Ob die BiologieBiologie dann einen großen oder kleinen Anteil zum typisch männlichen oder weiblichen Verhalten beisteuert, kann momentan nicht entschieden werden. Wie die weiteren Kapitel zeigen, gibt es durchaus angeborene Faktoren, die uns beeinflussen. Nichtsdestotrotz sind wir als vernunftbegabte, kulturell entwickelte Individuen in der Lage, uns darüber hinwegzusetzen, wenn wir denn wissen, wie und wo wir dabei ansetzen müssen.
Zunächst sollten wir erkennen, dass ganz im Sinne des Doing gender-Gedankens Geschlecht nicht einfach biologisch, binär und statisch und von Anfang gegeben ist, sondern dass es in der Gesellschaft und im Miteinander konstruiert wird. Die Erklärungen für Verhaltensweisen sowie die Erwartungen dürften nicht auf einem der beiden Endpunkte angeboren – anerzogen zu finden sein. Vielmehr ist es nötig, beide Aspekte in Betracht zu ziehen. Eine einfache Unterscheidung von erworben oder angeboren gibt es nicht, dazu ist das Zusammenwirken der verschiedenen Aspekte zu komplex. Auch Stereotype beeinflussen unsere Erwartungen, diese wiederum das Verhalten und die Wahrnehmung des Verhaltens.
Auch wenn die genetischen Anlagen viele unserer Reaktionen steuern, ist jederzeit ein Eingreifen möglich. Viele kleine Schritte im privaten und öffentlichen Alltag können mithelfen, für mehr Chancengleichheit zu sorgen, und jede/r kann dazu beitragen.
3.7 Zusammenfassung
Die Forschung zu Sprache und Geschlecht hob zunächst den Dominanzaspekt hervor, dann den der Differenz, um danach sozial-performative Faktoren, Variabilität und ständiges Neukonstruieren von Gender zu betonen und auch die verschiedenen Möglichkeiten von Diversität zu beachten.
Die frühe feministische Sprachwissenschaft konzentrierte sich noch auf einzelne Beobachtungen von Sprechen über und von Frauen. Die männliche Sprache galt als Norm, von der Frauen abwichen und dadurch Nachteile hatten. Dieser Zusammenhang zwischen sprachlichen und gesellschaftlichen AsymmetrienAsymmetrie bildete den Ausgangspunkt für die Feministische LinguistikFeministische Linguistik und für die sich daraus entwickelnde kritische Haltung mit dem Ziel, Gleichbehandlung zu erreichen. In der Folge wurde die Sprache der Frauen und Männer mehr und mehr als stilistisch zwar unterschiedlich, aber als gleichwertig aufgefasst.
Zum Ende der 90er Jahre hin löst der Begriff der Genderstudien den der Feministischen Linguistik langsam ab. Das Geschlecht gilt nicht mehr als gegeben, sondern als Konstruktion, als sozial bedingtes Handeln. Es ist damit breiter, variabel und abhängig auch von anderen Faktoren wie EthnieEthnie, sozialer Schicht und ReligionReligion. Die Genderstudien arbeiten interdisziplinär. Die politisch-kritische Perspektive jedoch bleibt. Das Genderkonzept gibt zunächst die (für einige) gewaltsame Zweiteilung auf, will dann aber auch die AsymmetrienAsymmetrie anprangern, die damit zum Nachteil aller, die nicht zur Kategorie des „richtigen“ (weißen Mittelschicht-) Mannes zählen, verbunden sind.
Mit Gender als sozial konstruierter Größe, mit Diskriminierung und Macht beschäftigen sich viele andere Disziplinen, so dass die feministischFeminismus-linguistische Sicht innerhalb der Genderstudien nur noch eine von vielen ist. Sie nähern sich aufgrund der Breite der Themenfelder stark den Kulturwissenschaften an. Die verschiedenen Erklärungsansätze setzen außerdem unterschiedliche Schwerpunkte: von erlernt und erworben bis hin zur völligen Negation angeborener Aspekte im philosophischen Rahmen. Es ist aber fraglich, inwiefern die biologischen Unterschiede in der Praxis völlig ausgeblendet werden sollten/können. Außerdem scheint es auch evolutionsbedingte unterschiedliche Tendenzen im Verhalten zu geben, aber sie sind den Auswirkungen durch kulturellen Fortschritt untergeordnet. Wir sollten sie kennen, um besser damit umgehen zu können, nicht, um die Errungenschaften jahrzehntelanger Arbeit um Gleichberechtigung und Chancengleichheit zu bagatellisieren oder uns aus unserer Verantwortung, diese umzusetzen, herauszureden. Dies kann nicht oft genug betont werden.
3.8 Forschungsaufgaben
Der soziolinguistischeSoziolinguistik, -isch Ansatz von Eckert/McConnell-Ginet (1999) dürfte für diejenigen relevant werden, die mit heterogenen Gruppen arbeiten. Allerdings ist die Situation in den USA nicht auf die deutschsprachigen Länder übertragbar. Hier müssen eigene Studien zeigen, wie EthnienEthnie und Dominanzstrukturen in Abhängigkeit der Herkunftsländer und der spezifischen Migrationssituation auf das Verhalten Einzelner innerhalb der Gruppe wirken und welche Rolle die Sprache spielt. Gergen (2010) diskutiert Prinzipien, Typen und Fragestellungen der qualitativen Forschung, Murnen/Smolak (2010) die der quantitativen Ansätze in der Genderforschung, sie können als Anstoß für eigene Vorhaben dienen. Auch in Nentwich/Kelan (2014: 132) finden wir Forschungsfragen.
3.9 Literatur
Zur Vertiefung vgl. Meissner (2008). Nentwich/Kelan (2014) geben einen Überblick über Studien und Themen des Doing gender-Konzepts mit Schwerpunkt auf englischsprachigen Arbeiten. Sammelbände stammen von Braun/Stephan (2006), Günthner et al. (2012), Bergmann et al. (2012). Zu Feministischer LinguistikFeministische Linguistik vgl. Samel (2000), zu Queer Theory vgl. Laufenberg (2017), zu „Queerer Linguistik“ vgl. Motschenbacher (2012). Die Kritik an dem evolutionären Ansatz ist teilweise vehement und unterstellt zu starke Annahmen, für eine relativierende Position sei Newcombe (2010) genannt.
Bucholtz (2014) skizziert verschiedene feministische Strömungen, die auch Sprache mitberücksichtigen, aus US-Sicht. Sie zeigt, dass vermehrt die ethnische Perspektive, soziale Schicht, masculinity- sowie queer-studies in die Theoriebildung einfließen können und dass es sehr unterschiedliche Sichtweisen zum Verhältnis der Geschlechter untereinander sowie zu Macht und Gesellschaft gibt.
4. Sprache und Denken
4.1 Die Sapir-Whorf-HypotheseRelativität, sprachliche, Relativismus, Sapir-Whorf-Hypothese
Für viele Linguist/innen gilt es heute als selbstverständlich, dass sich neurologische, kognitiveKognition, kognitiv und soziale Aspekte beim Sprechen verbinden. Das GehirnGehirn verarbeitet gleichzeitig Weltwissen, kontextuell-gesellschaftliche Zusammenhänge, persönliche Informationen der Sprecher/innen und Sprache. Alles trifft gleichzeitig im Informationsverarbeitungssystem ein, wird verwaltet und zum Dekodieren von Mitteilungen herangezogen. Die modernen neurobiologischen und kognitiven Wissenschaften liefern hierzu immer mehr Beweise.
Innerhalb der (Sprach-)Wissenschaft ging jedoch nicht immer jede/r davon aus, dass zwischen Denken, Handeln und Sprache eine Verbindung bestehen könnte. Schon seit Aristoteles wird immer wieder die Auffassung vertreten, Sprache und KognitionKognition, kognitiv seien vielmehr getrennte Systeme und wechselseitige Einflüsse eher nicht anzunehmen. Demnach ist Sprache in sich geschlossen, objektiv fassbar und unabhängig vom Sprechen und von den Sprecher/innen. Also benötigen wir für das Denken keine Sprache, und Sprache bildet lediglich die Gedanken ab. Sprache folgt ihren eigenen Regeln, die bei allen Menschen gleich sind (sprachlicher UniversalismusUniversalismus). Diese Ansicht fand seit Mitte des letzten Jahrhunderts große Verbreitung durch die Dominanz amerikanischer Sprachwissenschaftler, die sich primär auf das Englische stützten.
Demgegenüber vertraten andere die Auffassung einer direkten Verbindung. Neben einigen frühen Vorläufern wie Gottfried Herder oder Wilhelm von Humboldt gingen Franz Boas (1858–1942), Edward Sapir (1884–1939) und Benjamin Lee Whorf (1897–1941) Anfang des letzten Jahrhunderts explizit davon aus, dass Sprachen auf ihre Sprecher/innen einwirken. Dadurch können sie das Denken beeinflussen und mithin das Handeln ebenfalls. Somit ist die jeweilige Wirklichkeit eine relative und abhängig von Sprache und Kultur. Jede Kultur ermöglicht eine etwas andere Sicht der Welt, die sie unter anderem durch Sprache vermittelt. Eine Kultur, die in Schnee und Eis überlebt, muss zwangsläufig mehr Wörter für Schnee haben. Eine Kultur in der Wüste verfügt über mehr Begriffe von Brauntönen. Jede ist im Prinzip dazu in der Lage, die Dinge der Welt zu sehen, aber kulturell wählt sie nur bestimmte aus, die sie versprachlicht. Das gilt auch für grammatische Strukturen. Die Sprache filtert die Wahrnehmung, was unterschiedliche Realitäten in den Köpfen der Menschen mit sich bringt. Ein absolutes, einzig wahres Bild der Dinge gibt es daher nicht.
Ausgangspunkt in den USA waren ethnologische Beobachtungen mit der Erkenntnis, dass fremde Kulturen und ihre Sprachen einige bisher als selbstverständlich geltende Dinge anders ausdrückten und auch anders sahen, sowie der Versuch, möglichst objektiv-beschreibend und ohne Vorurteile vorzugehen. Denn zu diesem Zeitpunkt wurden die indigenen Völker und ihre Sprachen noch als weniger wertvoll als das Englische betrachtet und somit negativ bewertet.
Für die Vertreter der später so genannten Sapir-Whorf-HypotheseRelativität, sprachliche, Relativismus, Sapir-Whorf-Hypothese gilt der Einfluss der Sprache auf das Denken als zentral (sprachlicher Relativismus). Das beinhaltet jedoch nicht die Bestimmung, Abhängigkeit bzw. Festlegung des Denkens durch die Sprache (sprachlicher DeterminismusDeterminismus) (vgl. auch Elsen 2014: 75ff.). Letzteres impliziert, dass Denken ohne Sprache nicht möglich ist, und schließt Änderungen der durch die Sprache vermittelten Auffassung der Welt aus, etwa durch den Erwerb einer weiteren Sprache. Damit wäre die geistige Freiheit gar nicht gegeben, aus dem durch die eigene Sprache auferlegten Gefängnis herauszukommen. Dies war jedoch gerade nicht im Sinne der Vertreter der Sapir-Whorf-Hypothese. Sie gingen vielmehr davon aus, dass die Beziehung zwischen Sprache und Denken eben eine relative ist und neue Sprachen, neue Strukturen, Wörter und Konzepte die bereits vorhandenen relativieren und erweitern.
Die Versprachlichung bestimmter Inhalte zwingt die Menschen dazu, darüber nachzudenken. So ist es im Deutschen zunächst unwichtig, ob wir gerade oder grundsätzlich etwas tun, während im Englischen wegen der Unterscheidung she eats meat oder she is eating meat durchaus darüber nachgedacht werden muss, weil immer eines von beiden formuliert wird. Ebenso sind für Spanischsprachige die beiden Zeitangaben mañana und madrugada selbstverständlich zu differenzieren, also, ob der Morgen früher oder später ist. Im Deutschen ist das nicht in jeder Situation relevant, und dann können wir auch immer noch anhand einer Zeitangabe präzisieren, welchen Zeitabschnitt wir meinen. Auch räumliche Angaben lassen sich unterschiedlich ausdrücken, etwa relativ zur eigenen Person oder anderen Orientierungspunkten wie im Englischen oder Deutschen, vgl. links von, vor. Daneben gibt es absolute Referenzrahmen, beispielsweise die Beschreibung mithilfe von Himmelsrichtungen, vgl. „‚[t]here’s an ant on your south-east leg‘ or ‚Move the cup to the north-northwest a little bit‘“ (Boroditsky 2009: 121) in Pormpuraaw, Australien. Die Sprecher/innen dort müssen sich stets über ihre lokale Position im Klaren sein, was dazu führt, dass sie sich auch besser in unbekanntem Terrain zurechtfinden im Vergleich zu Sprecher/innen des Englischen oder Deutschen. Versuche ergeben, dass wir beim Erwerb einer neuen Sprache auch entsprechende kognitiveKognition, kognitiv Fähigkeit erlernen (Boroditsky 2009, dort weitere Beispiele). „In practical terms, it means that when you’re learning a new language, you’re not simply learning a new way of talking, you are also inadvertently learning a new way of thinking“ (Boroditsky 2009: 125). Weiterhin hat sich gezeigt, dass Sprecher/innen von Sprachen mit grammatischem Geschlecht ein stärkeres Genderbewusstsein entwickeln, was eine geschlechtsspezifische Voreingenommenheit nach sich zieht, sogar bei nicht belebten Objekten (Sato et al. 2017).
Die theoretischen Annahmen zur Beziehung zwischen Sprache und Denken und Wirklichkeit lassen sich, verkürzt gesprochen, zusammenfassen in keine (UniversalismusUniversalismus), eine relative (RelativismusRelativität, sprachliche, Relativismus, Sapir-Whorf-Hypothese) und eine bestimmende (DeterminismusDeterminismus) Beziehung.
In der Folge zeigten vergleichende Studien und psycholinguistischePsycholinguistik, -isch Experimente immer mehr den Einfluss der Sprache auf das Denken. Die sprachphilosophischen Überlegungen sind für die gesamte Debatte um AsymmetrienAsymmetrie in und durch Sprache grundlegend, weil die relativistische Sicht sprachliche, kulturelle und biologische Systeme durchlässig macht und für einander öffnet. Gleichzeitig aber werden auch sprachtheoretische Begründungen ins Feld geführt, um die Verweigerung von Änderungen zu rechtfertigen (vgl. Kap. 5.3.3, 5.5).